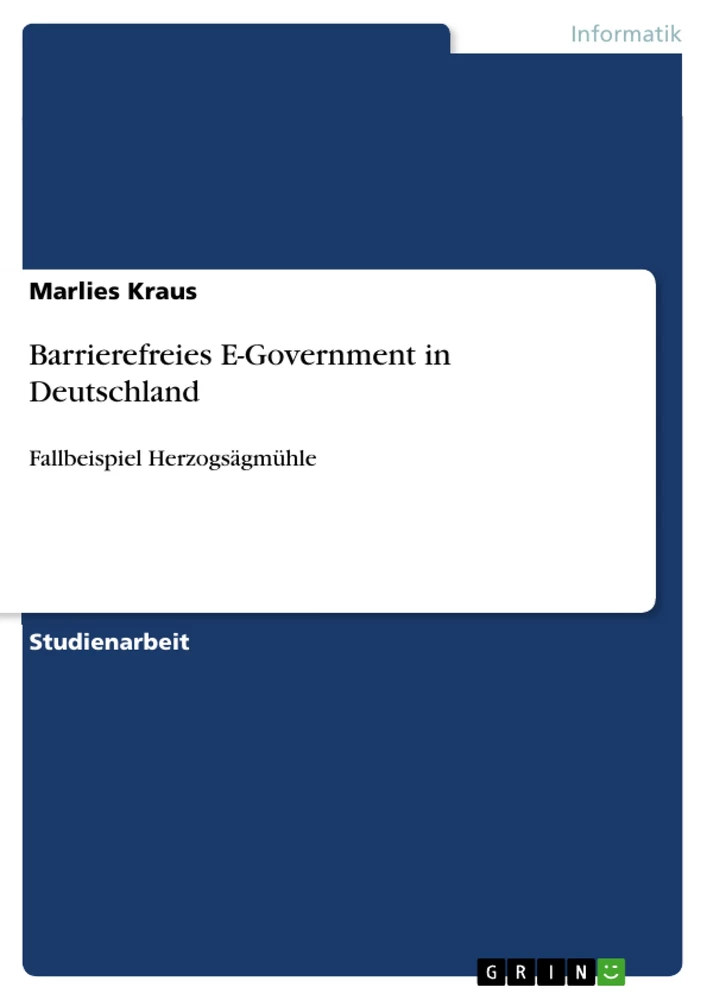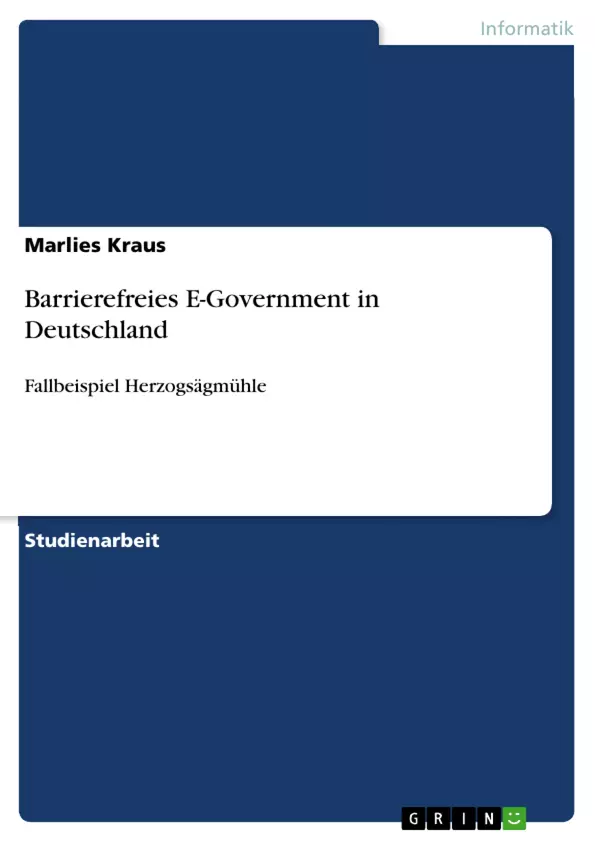Die Erfindung von Massenmedien ist stets mit einer fortschreitenden Entwicklung der Gesellschaft verbunden. Die Erfindung des Buchdrucks ermöglichte breiten Schichten den Zugang zu mehr Wissen, die Telefonie überwand räumliche Distanzen, und Radio sowie Fernsehen führten zu einer bislang unbekannten medialen Nähe zwischen den Regierenden und der Bevölkerung.
Die Bedeutung des Internets kann noch nicht abschließend beurteilt werden; dafür ist dieses Massenmedium noch zu jung. Doch stellt sich jenseits des Unterhaltungs- und Informationswertes dieses Mediums die Frage, welchen Mehrwert das Internet der Bürgergesellschaft bringen kann.
Seit Ende der 90er Jahre kursiert der Begriff des Electronic Governments (E-Government), der sowohl die Verbesserung von arbeitsinternen Abläufen bei staatlichen Institutionen als auch eine Erweiterung der Demokratie durch das Internet umfasst.
Mehr Demokratie für die Bevölkerung also. Doch wie ist es um den Teil der Bevölkerung bestellt, der aufgrund einer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung keinen oder nur sehr erschwerten Zugriff auf Online-Angebote von Bund, Ländern und Gemeinden hat? Sollen diese Menschen nicht teilhaben an mehr Demokratie?
Die technischen Möglichkeiten sind längst vorhanden, um den rund 8 Millionen behinderten Menschen in Deutschland barrierefreien Zugang zu Informationen zu ermöglichen. Doch muss in vielen Programmiererköpfen noch die Einsicht reifen, diese Möglichkeiten auch umzusetzen. Projekte wie Barrierefrei Informieren und Kommunizieren (BIK) und der BIENE-Award sollen dieses Umdenken fördern.
Auch in Herzogsägmühle ist die Zeit nun reif für barrierefreies Denken. Als Einrichtung, die mit und für behinderte Menschen arbeitet, möchte man an der Spitze der Bewegung für barrierefreie Informationstechnik stehen. Deshalb wird das Projekt „Pfaffenwinkel barrierefrei“ nun auch mit einem barrierefreien Internetauftritt umgesetzt, der sowohl den Anforderungen der BITV als auch den Richtlinien der WAI genügen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Begriffe
- 1.1 E-Government
- 1.1.1 Barrierefreiheit
- 1.1.2 Barrierefreiheit im E-Government
- 1.1.3 EQUAL
- 1.2 An wen richtet sich E-Government?
- 1.2.1 Die Vorteile von E-Government für Bürger
- 1.2.2 Die Vorteile von E-Government für die Wirtschaft
- 1.2.3 Die Vorteile von E-Government für Behörden
- 2 Barrierefreie Informationstechnik in Deutschland
- 2.1 Wie viele Behinderte leben in Deutschland?
- 2.1.1 Sehbehinderung
- 2.1.2 Hörschädigung
- 2.1.3 Körperliche Behinderung
- 2.1.4 Geistige Behinderung
- 2.2 Schritte zur Barrierefreiheit
- 2.3 Vorstellung dreier verwendeter Online-Checktools zum Test auf Barrierefreiheit
- 2.3.1 Der Barrierefinder
- 2.3.2 A-Prompt Screenreader
- 2.3.3 Barrierefreies E-Government
- 3 Barrierefreies E-Government
- 3.1 Der BIENE-Award
- 3.2 Das Projekt BIK
- 3.3 Fallstudie: Barrierefreies E-Government in Herzogsägmühle
- 3.3.1 Das Dorf Herzogsägmühle
- 3.3.2 Die EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL
- 3.3.3 Der aktuelle Webauftritt des Europa Projektbüros Herzogsägmühle
- 3.3.3.1 Nachteile für Sehbehinderte
- 3.3.3.2 Nachteile für körperlich Behinderte
- 3.3.3.3 Nachteile für geistig Behinderte
- 3.3.4 Der zukünftige Webauftritt von „Pfaffenwinkel barrierefrei“
- 3.3.4.1 Wovon profitieren Sehbehinderte?
- 3.3.4.2 Wovon profitieren körperlich Behinderte?
- 3.3.4.3 Wovon profitieren geistig Behinderte?
- 4 Zusammenfassung
- 5 Zukünftige Projekte für barrierefreies E-Government in Herzogsägmühle
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Semesterarbeit befasst sich mit dem Thema barrierefreies E-Government in Deutschland, wobei der Fokus auf der Fallstudie Herzogsägmühle liegt. Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration von Menschen mit Behinderungen in die digitale Welt des E-Governments aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert den aktuellen Stand der Barrierefreiheit im E-Government in Deutschland und beleuchtet die Vorteile und Nachteile von barrierefreien Online-Angeboten für verschiedene Behindertengruppen.
- Barrierefreiheit im E-Government
- Die Integration von Menschen mit Behinderungen in die digitale Welt
- Die Vorteile und Nachteile von barrierefreien Online-Angeboten
- Die Fallstudie Herzogsägmühle als Beispiel für barrierefreies E-Government
- Zukünftige Entwicklungen im Bereich des barrierefreien E-Governments
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema E-Government und die Bedeutung von Barrierefreiheit in diesem Kontext ein. Sie stellt die Zielsetzung der Arbeit dar und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit.
Kapitel 1 definiert die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang mit E-Government und Barrierefreiheit relevant sind. Es werden die Vorteile von E-Government für Bürger, Wirtschaft und Behörden erläutert und die EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL vorgestellt.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der barrierefreien Informationstechnik in Deutschland. Es werden die verschiedenen Behindertengruppen und ihre Bedürfnisse im Hinblick auf den Zugang zu Online-Angeboten beleuchtet. Außerdem werden Schritte zur Barrierefreiheit vorgestellt und drei Online-Checktools zum Test auf Barrierefreiheit vorgestellt.
Kapitel 3 analysiert die Fallstudie Herzogsägmühle. Es wird der aktuelle Webauftritt des Europa Projektbüros Herzogsägmühle im Hinblick auf Barrierefreiheit untersucht und die Nachteile für verschiedene Behindertengruppen aufgezeigt. Anschließend wird der zukünftige Webauftritt von „Pfaffenwinkel barrierefrei“ vorgestellt und die Vorteile für Sehbehinderte, körperlich Behinderte und geistig Behinderte erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Barrierefreies E-Government, Inklusion, Digitalisierung, Menschen mit Behinderungen, E-Democracy, Online-Angebote, Webauftritt, Fallstudie Herzogsägmühle, EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL, BITV, Barrierefinder, A-Prompt Screenreader.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Barrierefreiheit im E-Government?
Es bedeutet, dass Online-Angebote von Behörden so gestaltet sind, dass Menschen mit körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderungen sie ohne fremde Hilfe nutzen können.
Welche Rolle spielt die BITV?
Die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) legt die technischen Standards fest, die Webauftritte öffentlicher Stellen in Deutschland erfüllen müssen.
Welche Vorteile bietet barrierefreies E-Government?
Es ermöglicht Inklusion und Teilhabe an der Demokratie für rund 8 Millionen behinderte Menschen in Deutschland und verbessert die Nutzbarkeit für alle Bürger.
Was wird in der Fallstudie Herzogsägmühle untersucht?
Die Arbeit analysiert den Webauftritt der Einrichtung Herzogsägmühle und zeigt auf, wie Nachteile für Sehbehinderte, körperlich und geistig Behinderte durch ein neues Konzept behoben werden.
Was sind Online-Checktools für Barrierefreiheit?
Tools wie der „Barrierefinder“ oder „A-Prompt“ helfen Entwicklern dabei, Webseiten auf ihre Zugänglichkeit hin zu prüfen und Fehler zu identifizieren.
- Arbeit zitieren
- Marlies Kraus (Autor:in), 2005, Barrierefreies E-Government in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152654