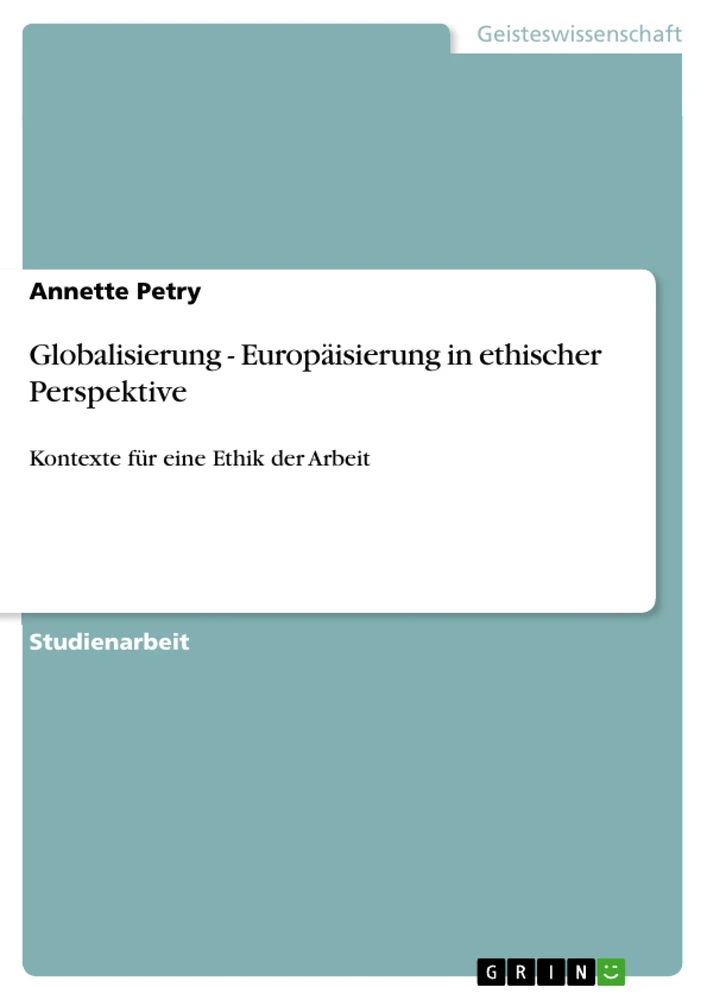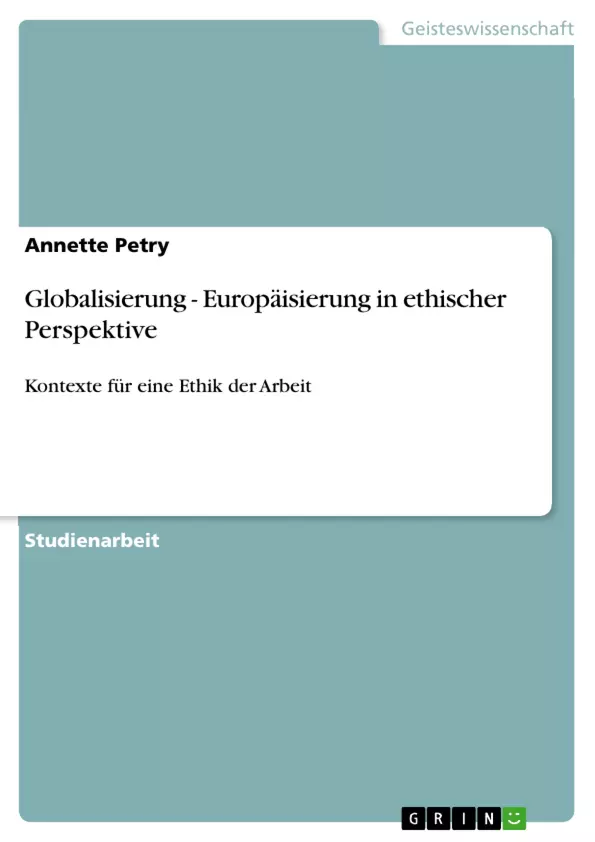Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der Globalisierung und den damit verbundenen Chancen und Gefahren für die Arbeitswelt. Die Vernetzung der Welt hat viele Möglichkeiten geschaffen, die Import und Export erleichtern und den Menschen zum Teil die Arbeitssuche und im Allgemeinen die Flexibilität im Berufsleben erleichtern und ermöglichen. Wichtige neue Schlagwörter für Berufstätige wurden Flexibilität und Mobilität, als die Vernetzung immer weiter voranschritt. Doch brachte die Globalisierung nicht nur die positiven Effekte, die man sich erhoffte. Probleme und Gefahren kamen auf, die man bisher nur am Rande behandelt hat und denen entgegenzuwirken eine immer wichtigere Aufgabe geworden ist. Dabei sind natürlich Unternehmen gefragt und Politiker, Lösungen zu finden und den zum Teil wirklich gravierenden Missständen Abhilfe zu schaffen. Aber auch die Kirchen dürfen nicht tatenlos zusehen und alles Handeln Politik und Wirtschaft überlassen. Immer mehr sind wir gefragt, um einzugreifen, um auf Missstände aufmerksam zu machen, Diskussionen anzustoßen und Problembewältigung voranzutreiben. In Handreichungen und Denkschriften werden Bedenken der Kirchen laut und die Brisanz verdeutlicht. Es muss gehandelt werden, um die Globalisierung als das zu nutzen, was sie eigentlich ist: Eine Chance zur Vernetzung der Welt, zur Stärkung der Schwachen und zu einer ausgeprägten Pluralität von Möglichkeiten.
Diese Arbeit stützt sich hauptsächlich auf den „Schlussbericht der Enquete-Kommission. Globalisierung der Weltwirtschaft“ des Deutschen Bundestages aus dem Jahre 2002. Dabei werden einzelne Bereiche, beispielsweise die Finanzmärkte, der Arbeitsmarkt und die Geschlechtergerechtigkeit, angesprochen und deren Probleme und Chancen aufgezeigt. Was wäre ethisches Handeln in diesen Bereichen und wo besteht dringender Handlungsbedarf, wo müssen wir als Kirche auch darauf achten, dass diese Probleme nicht beiseite geschoben werden? Das sind nur einige der Fragen, die behandelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Globalisierung - Begriffsklärung und Geschichte
- Europäisierung - Begriffsklärung und Geschichte
- Globalisierung - Chancen und Gefahren
- Finanzmärkte
- Waren- und Dienstleistungsmärkte
- Arbeitsmärkte
- Globale Wissensgesellschaft
- Geschlechtergerechtigkeit
- Kontexte für eine Ethik der Arbeit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Globalisierung und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Sie analysiert Chancen und Gefahren, die sich aus der Vernetzung der Welt ergeben, und untersucht, welche ethischen Fragen dabei im Vordergrund stehen. Die Arbeit stützt sich auf den „Schlussbericht der Enquete-Kommission. Globalisierung der Weltwirtschaft“ des Deutschen Bundestages aus dem Jahre 2002.
- Begriffsklärung und Geschichte der Globalisierung
- Begriffsklärung und Geschichte der Europäisierung
- Chancen und Gefahren der Globalisierung für verschiedene Bereiche, wie Finanzmärkte, Arbeitsmärkte und die Wissensgesellschaft
- Ethische Implikationen der Globalisierung und Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft
- Kontexte für eine Ethik der Arbeit im Zeitalter der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Globalisierung für die Arbeitswelt. Sie hebt die Chancen und Gefahren hervor, die mit der Vernetzung der Welt einhergehen, und betont die Notwendigkeit ethischen Handelns in diesem Kontext.
Globalisierung - Begriffsklärung und Geschichte
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Begriffs „Globalisierung“. Es zeichnet die wichtigsten Phasen der Globalisierung nach, angefangen von der Industrialisierung bis hin zur Digitalisierung und Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs. Zudem werden die Auswirkungen der Globalisierung auf verschiedene Lebensbereiche, wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, beleuchtet.
Europäisierung - Begriffsklärung und Geschichte
Dieses Kapitel fokussiert auf die Europäisierung und ihren Einfluss auf die politische und wirtschaftliche Integration Europas. Es beschreibt die Entwicklung der Europäischen Union und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt, insbesondere die Zunahme der Mobilität und der beruflichen Möglichkeiten innerhalb Europas.
Globalisierung - Chancen und Gefahren
Dieser Abschnitt behandelt die Chancen und Gefahren der Globalisierung in verschiedenen Bereichen, wie Finanzmärkten, Waren- und Dienstleistungsmärkten, Arbeitsmärkten, der globalen Wissensgesellschaft und der Geschlechtergerechtigkeit.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Europäisierung, Arbeitswelt, Chancen, Gefahren, ethische Fragen, Finanzmärkte, Arbeitsmärkte, Wissensgesellschaft, Geschlechtergerechtigkeit, Kirche, Gesellschaft, Enquete-Kommission, Schlussbericht, Deutscher Bundestag
Häufig gestellte Fragen
Welche Chancen bietet die Globalisierung für die Arbeitswelt?
Sie ermöglicht eine weltweite Vernetzung, erleichtert den Import/Export und fördert Mobilität sowie Flexibilität bei der Arbeitssuche.
Welche Gefahren der Globalisierung werden thematisiert?
Die Arbeit warnt vor sozialen Missständen, Instabilitäten auf den Finanzmärkten und mangelnder Geschlechtergerechtigkeit durch den globalen Wettbewerbsdruck.
Was ist die Rolle der Kirche im Globalisierungsprozess?
Kirchen sollen Missstände aufzeigen, Diskussionen anstoßen und sich für die „Schwachen“ einsetzen, um die Globalisierung ethisch mitzugestalten.
Was bedeutet „Europäisierung“ in diesem Zusammenhang?
Sie beschreibt die politische und wirtschaftliche Integration innerhalb Europas, die zu mehr beruflicher Mobilität, aber auch zu neuen regulatorischen Herausforderungen führt.
Worauf stützt sich die Analyse der Globalisierung in dieser Arbeit?
Hauptquelle ist der Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur „Globalisierung der Weltwirtschaft“ aus dem Jahr 2002.
- Arbeit zitieren
- Annette Petry (Autor:in), 2009, Globalisierung - Europäisierung in ethischer Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152683