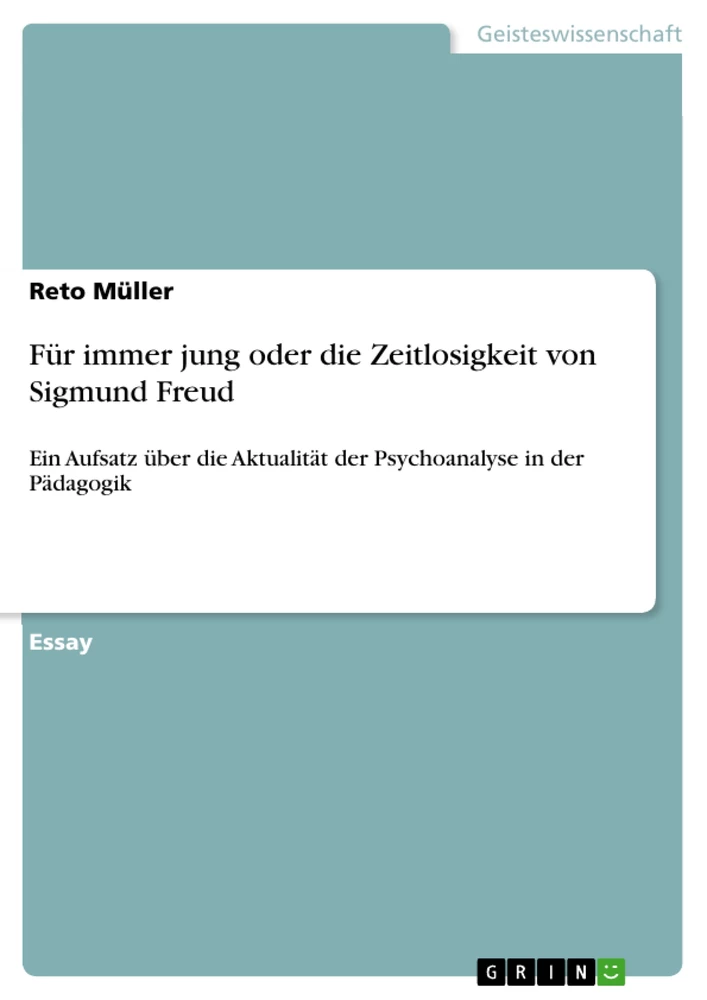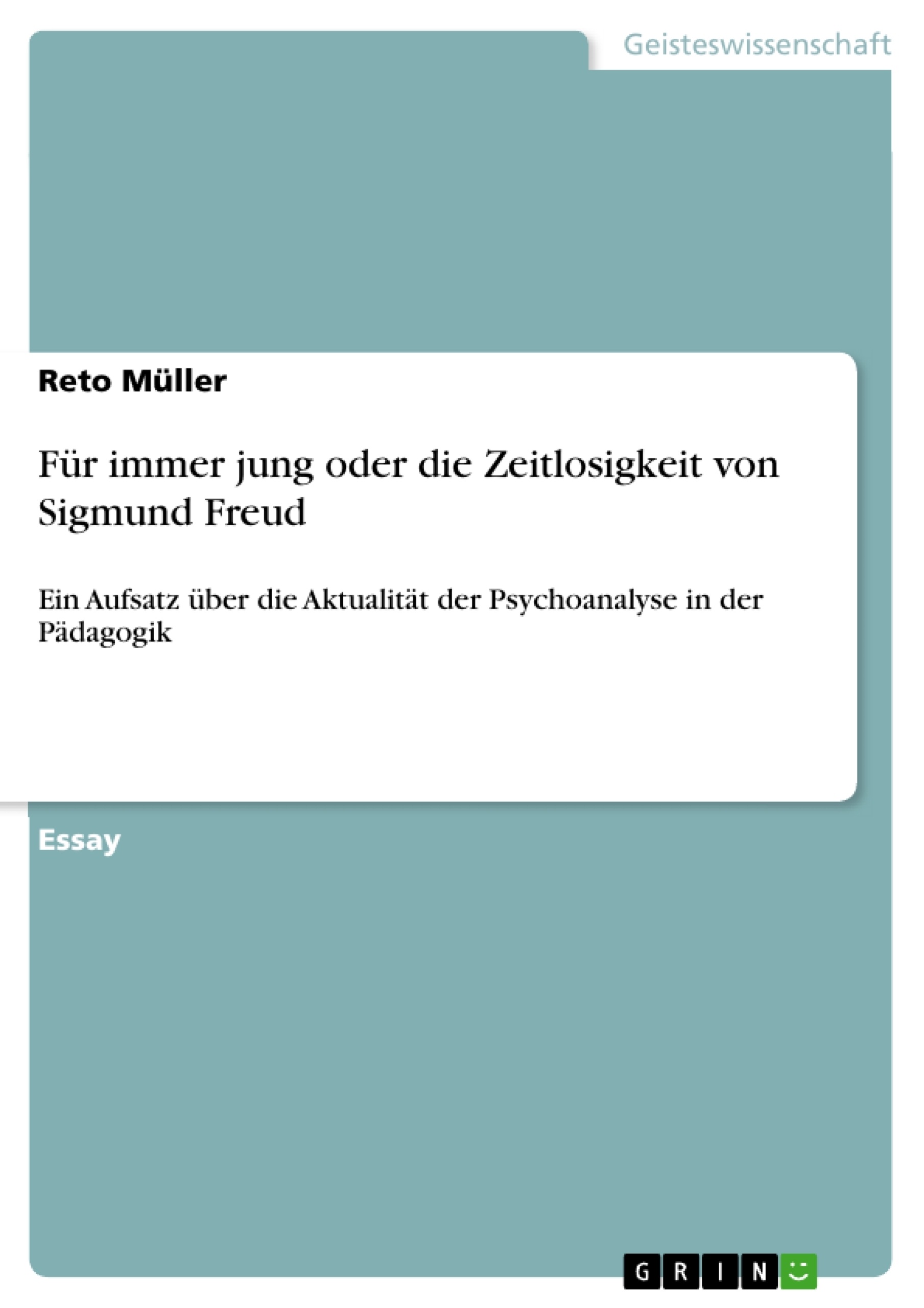In den Disziplinen der Geistes-und Sozialwissenschaften gibt es selbst auf die einfachsten Fragen nur selten klare und eindeutige Antworten. So können sich die Aufklärungsbeiträge zu vermeintlich banalen Sachverhalten oder bestimmten Definitionen dreist widersprechen, je nach eingenommener disziplinspezifischer Perspektive oder gewählter Paradigmen, auf welche sich die jeweiligen ‚Aufklärer‘ beziehen. Es bleibt dem Fragenden wenig anderes übrig, als sich eine Meinung zu bilden, sich selbst in die Thematik einzuführen.
Die offene Frage, welche den Anlass für die vorliegende Auseinandersetzung bietet und einer gründlicheren Untersuchung bedarf, lautet: „Was ist psychoanalytische Pädagogik, beleuchtet aus der erziehungswissenschaftlichen Perspektive?“
Im Essay wird aber nicht ausschliesslich eine Antwort auf diese Frage präsentiert; es geht vielmehr auch um die Reflexion des Inhaltes eines an der Universität Zürich durchgeführten Seminars und um Erkenntnisse, welche die Interpretation des Lehrangebotes im Vergleich mit den entsprechenden Ergebnissen der einschlägigen Literatur ermöglichen.
An erster Stelle wird das Seminarprogramm kurz vorgestellt. Anschließend folgt eine prägnante Darstellung der Diskursentwicklung der psychoanalytischen Pädagogik und der involvierten Persönlichkeiten. Darauf folgt ein Einblick in die Auseinandersetzung bezüglich der Klärung des Verhältnisses zwischen Psychoanalyse und Pädagogik. Abschließend wird die Ausgangsfrage diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Seminarinhalt - Teil 1, Herbstsemester 2008
- Aufbruch zu einem neuen Verständnis vom Kinde und der Erziehungsrealität
- Annäherung zweier Disziplinen in der Praxis des Erziehungsalltags
- Standpunkte zum Verhältnis von Pädagogik und Psychoanalyse aus der Sicht von ausgewählten Pionieren der psychoanalytisch-pädagogischen Bewegung
- Abschließende Diskussion der Ausgangsfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz reflektiert den Seminarinhalt „Psychoanalyse und Sozialpädagogik: Theoretische Grundlagen und Praxismodelle, Teil 1“ und untersucht die Frage nach dem Wesen der Psychoanalytischen Pädagogik aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive. Der Fokus liegt auf der Analyse der Diskursentwicklung der Psychoanalytischen Pädagogik, der Vorstellung von wichtigen Persönlichkeiten und der Beleuchtung des Verhältnisses zwischen Psychoanalyse und Pädagogik aus der Sicht der Pioniere psychoanalytischer Pädagogik.
- Entwicklungsgeschichte der Psychoanalytischen Pädagogik
- Bedeutung des Unbewussten in der Pädagogik
- Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Pädagogik
- Einfluss von Psychoanalyse auf Erziehungsmethoden
- Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung des Aufsatzes vor. Kapitel 2 gibt einen Überblick über den Seminarinhalt, wobei die wichtigsten Themenbereiche der Psychoanalyse, wie das Unbewusste, die Abwehrmechanismen, das Beziehungsmodell und die Instanzenlehre, beleuchtet werden. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Geschichte der Psychoanalytischen Pädagogik, insbesondere mit der Annäherung der beiden Disziplinen in der Praxis des Erziehungsalltags. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung der psychoanalytischen Erkenntnisse für die pädagogische Praxis.
Schlüsselwörter
Psychoanalytische Pädagogik, Unbewusstes, Abwehrmechanismen, Beziehungsgestaltung, Entwicklungsaufgaben, Erziehung, Psychoanalyse, Pädagogik, Sozialpädagogik, Reformpädagogik, Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, August Aichhorn, Fritz Redl, Siegfried Bernfeld.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Psychoanalytische Pädagogik?
Es ist eine Fachrichtung, die pädagogische Praxis mit Erkenntnissen der Psychoanalyse verknüpft, insbesondere unter Berücksichtigung des Unbewussten.
Welche Rolle spielt das Unbewusste in der Erziehung?
Das Unbewusste beeinflusst das Handeln von Erziehern und Kindern gleichermaßen; die Reflexion darüber kann pädagogische Prozesse verbessern.
Wer sind die Pioniere dieser Bewegung?
Wichtige Persönlichkeiten sind unter anderem Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, August Aichhorn, Fritz Redl und Siegfried Bernfeld.
Wie stehen Psychoanalyse und Pädagogik zueinander?
Die Arbeit beleuchtet das Spannungsverhältnis und die Annäherung beider Disziplinen in der Geschichte der Erziehungswissenschaft.
Was sind die zentralen Themen des im Essay reflektierten Seminars?
Themen waren Abwehrmechanismen, Beziehungsmodelle, die Instanzenlehre und deren Anwendung in der Sozialpädagogik.
- Quote paper
- Reto Müller (Author), 2009, Für immer jung oder die Zeitlosigkeit von Sigmund Freud, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152708