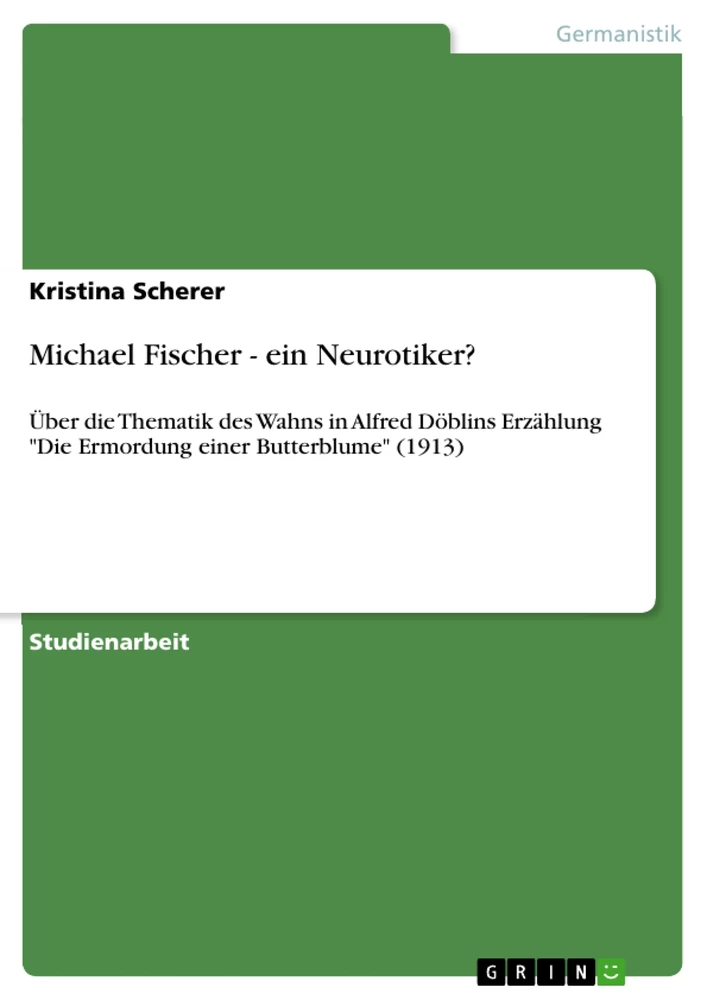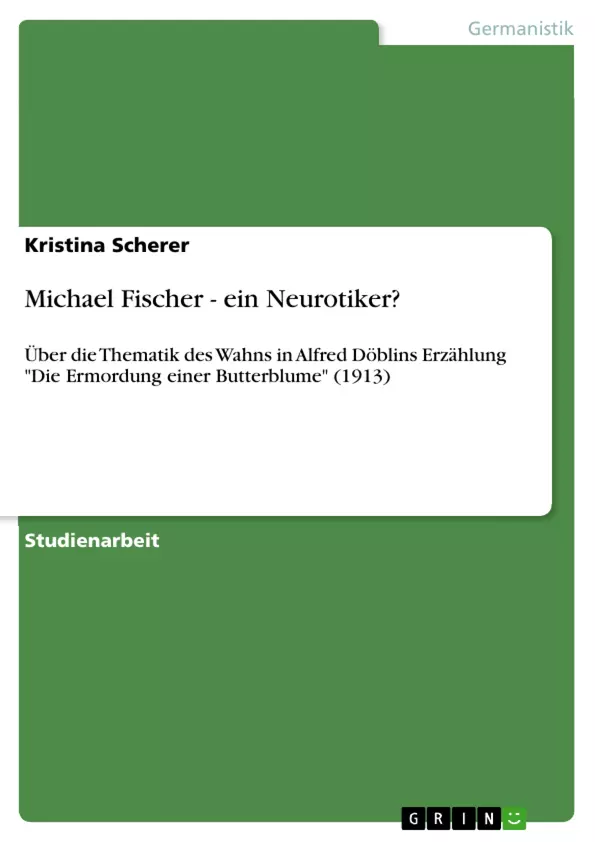Alfred Döblin (1878-1957) schrieb seine Erzählung Die Ermordung einer Butterblume im Jahre 1905. Veröffentlicht wurde sie erstmals 1911 in der Zeitschrift „Sturm“, die von Herwarth Walden herausgegeben wurde und zunächst wöchentlich erschien. Im Jahre 1913 erfolgte die erste selbstständige Publikation in dem gleichnamigen Sammelband. Döblins wohl bekannteste Erzählung ist dem Expressionismus (ca.1910-1925) mit dem Zentrum Berlin zuzuordnen. Da sie keinerlei psychologische Deutungen beinhaltet, sondern sich auf Beschreibungen konzentriert und die Natur eine wichtige Rolle einnimmt, gilt sie als exemplarisch für diese Epoche. Der Literaturwissenschaftler Joris Duytschaever lobte sie 1973 als eine „Pionierleistung des Expressionismus“ . In der expressionistischen Literatur werden ebenfalls Motive wie Ich-Zerfall, Angst und Wahnsinn häufig behandelt, so auch in Die Ermordung einer Butterblume.
Im Zentrum der Erzählung steht der Geschäftsmann Michael Fischer, dessen Leben sich angesichts eines unbedeutenden Ereignisses, der Beschädigung einer Pflanze, vollständig verändert. Im Verlauf der Erzählung wird die psychische und durch seine seelischen Leiden ebenfalls verursachte körperliche Beeinträchtigung immer stärker. Es häufen sich Halluzinationen und Stimmungsschwankungen, die mit Gewichtsabnahme und Selbstmordgedanken einhergehen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die seelische Erkrankung Fischers zu untersuchen. Forscher wie etwa Joris Duytschaever oder Leo Kreutzer würdigten die Erzählung als realistische Beschreibung einer Zwangsneurose bzw. einer Schizophrenie. Diese Arbeit soll klären, ob die Aussagen zutreffend sind. Das erste Kapitel informiert über das Verständnis psychischer Störungen zu Lebzeiten Döblins. Um die Krankheitsbilder der Neurose und Schizophrenie besser verstehen zu können, behandelt das Kapitel ebenfalls aktuelle diagnostische Kriterien der jeweiligen Störungsbilder, von denen Duytschaever und Kreutzer ausgingen, die ihre Arbeiten in den 1970er Jahren verfassten. In einem zweiten Themenkomplex werden chronologisch die Textpassagen erläutert, in denen der Protagonist wahnsinniges Verhalten aufweist. Das dritte Kapitel verfolgt abschließend die Frage, inwiefern die seelische Zerrüttung Michael Fischers in der Naturbeschreibung Ausdruck findet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition „Neurose“ und „Schizophrenie“
- Das Verständnis psychischer Störungen zu Lebzeiten Döblins
- Aktuelle Definitionen der Neurose und Schizophrenie
- Michael Fischer als seelisch erkrankter Mensch
- Anlass der Wahnzustände = „Ermordung“ einer Blume
- Eine schizophrene Episode: Der Protagonist schaut sich selbst bei der Tat zu
- Ambivalenz zwischen Schuldgefühlen und Sadismus
- Falsche Wahrnehmung der Natur als Zeichen von seelischer Zerrüttung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die seelische Erkrankung des Protagonisten Michael Fischer in Alfred Döblins Erzählung „Die Ermordung einer Butterblume“. Es wird geprüft, ob die von Forschern wie Duytschaever und Kreutzer vorgeschlagenen Diagnosen einer Zwangsneurose bzw. Schizophrenie zutreffen. Die Analyse berücksichtigt das psychiatrische Verständnis der Zeit Döblins und vergleicht es mit aktuellen diagnostischen Kriterien.
- Das Verständnis psychischer Störungen im frühen 20. Jahrhundert und im Vergleich zu heutigen Definitionen.
- Analyse von Michael Fischers Verhalten im Kontext der Erzählung und die Interpretation seiner Symptome.
- Die Rolle der Naturbeschreibung in der Darstellung von Fischers seelischer Zerrüttung.
- Die Bewertung der Diagnosen von Zwangsneurose und Schizophrenie anhand des Textes.
- Der Einfluss von Döblins psychiatrischem Hintergrundwissen auf die Darstellung der Erkrankung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Alfred Döblins Erzählung „Die Ermordung einer Butterblume“ vor, ordnet sie dem Expressionismus zu und hebt die Bedeutung der Naturbeschreibung hervor. Sie benennt die Zielsetzung der Arbeit, nämlich die Untersuchung der seelischen Erkrankung des Protagonisten Michael Fischer und die Überprüfung bestehender Diagnosen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die psychiatrischen Kenntnisse Döblins, die Beschreibung von Fischers wahnsinnigem Verhalten und die Rolle der Natur konzentriert.
Definition „Neurose“ und „Schizophrenie“: Dieses Kapitel beleuchtet das Verständnis psychischer Störungen zu Döblins Zeiten und vergleicht es mit aktuellen Definitionen. Es beschreibt Döblins psychiatrische Expertise und den damaligen Forschungsstand, insbesondere die Konzepte von Kraepelin und Bleuler. Der Vergleich zwischen den historischen und aktuellen psychiatrischen Klassifikationen von Neurose und Schizophrenie dient als Grundlage für die spätere Analyse von Fischers Erkrankung.
Michael Fischer als seelisch erkrankter Mensch: Dieses Kapitel analysiert Fischers Verhalten und Symptome im Detail. Es untersucht die Ereignisse, die zu seinem Zusammenbruch führten, seine Halluzinationen und Stimmungsschwankungen, sowie die Ambivalenz zwischen Schuldgefühlen und sadistischen Tendenzen. Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den im Text dargestellten psychologischen und physischen Auswirkungen der Erkrankung auf Fischer. Die einzelnen Punkte werden chronologisch im Zusammenhang mit den Ereignissen des Romans beleuchtet.
Falsche Wahrnehmung der Natur als Zeichen von seelischer Zerrüttung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung der Natur in der Erzählung und ihre Beziehung zu Fischers seelischer Erkrankung. Es untersucht, wie die Wahrnehmung der Natur durch Fischers psychischen Zustand verzerrt wird und als Ausdruck seiner inneren Zerrüttung dient. Die Analyse der Naturbeschreibung wird als weiteres Indiz für Fischers seelischen Zustand herangezogen.
Schlüsselwörter
Alfred Döblin, Die Ermordung einer Butterblume, Expressionismus, Neurose, Schizophrenie, Wahnsinn, psychische Erkrankung, Naturbeschreibung, psychiatrisches Verständnis, seelische Zerrüttung, Michael Fischer.
Häufig gestellte Fragen zu Alfred Döblins "Die Ermordung einer Butterblume"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die seelische Erkrankung des Protagonisten Michael Fischer in Alfred Döblins Erzählung "Die Ermordung einer Butterblume". Sie untersucht, ob die bestehenden Diagnosen einer Zwangsneurose oder Schizophrenie zutreffen, unter Berücksichtigung des psychiatrischen Verständnisses Döblins Zeit und aktuelle diagnostischer Kriterien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Verständnis psychischer Störungen im frühen 20. Jahrhundert im Vergleich zu heutigen Definitionen; die Analyse von Michael Fischers Verhalten und die Interpretation seiner Symptome; die Rolle der Naturbeschreibung in der Darstellung von Fischers seelischer Zerrüttung; die Bewertung der Diagnosen von Zwangsneurose und Schizophrenie anhand des Textes; und den Einfluss von Döblins psychiatrischem Hintergrundwissen auf die Darstellung der Erkrankung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Neurose und Schizophrenie (damals und heute), ein Kapitel zur Analyse von Michael Fischers Erkrankung, ein Kapitel zur Rolle der Naturbeschreibung und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Erzählung vor und benennt die Zielsetzung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Untersuchung.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden geboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt die Einleitung als Einführung in die Erzählung und die Forschungsfrage. Das Kapitel zur Definition von Neurose und Schizophrenie vergleicht historische und aktuelle psychiatrische Klassifikationen. Das Kapitel zu Michael Fischer analysiert detailliert sein Verhalten und seine Symptome. Das Kapitel zur Naturbeschreibung untersucht die Verzerrung der Naturwahrnehmung durch Fischers psychischen Zustand.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Alfred Döblin, Die Ermordung einer Butterblume, Expressionismus, Neurose, Schizophrenie, Wahnsinn, psychische Erkrankung, Naturbeschreibung, psychiatrisches Verständnis, seelische Zerrüttung, Michael Fischer.
Wie wird die Diagnose von Michael Fischers Erkrankung bewertet?
Die Arbeit bewertet die bestehenden Diagnosen (Zwangsneurose und Schizophrenie) durch eine detaillierte Analyse von Fischers Verhalten, seinen Symptomen und dem Kontext der Erzählung, wobei sowohl das damalige als auch das heutige psychiatrische Verständnis berücksichtigt werden.
Welche Rolle spielt die Naturbeschreibung in der Erzählung?
Die Naturbeschreibung wird als wichtiges Element der Erzählung analysiert, das Fischers seelischen Zustand widerspiegelt und die Verzerrung seiner Wahrnehmung verdeutlicht. Die verzerrte Wahrnehmung der Natur dient als Indiz für seine psychische Erkrankung.
Wie wird das Verständnis psychischer Störungen im frühen 20. Jahrhundert behandelt?
Die Arbeit vergleicht das Verständnis psychischer Störungen zu Döblins Lebzeiten (unter Berücksichtigung von Kraepelin und Bleuler) mit aktuellen Definitionen von Neurose und Schizophrenie. Dieser Vergleich bildet die Grundlage für die Analyse von Fischers Erkrankung.
- Citation du texte
- Kristina Scherer (Auteur), 2010, Michael Fischer - ein Neurotiker? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152778