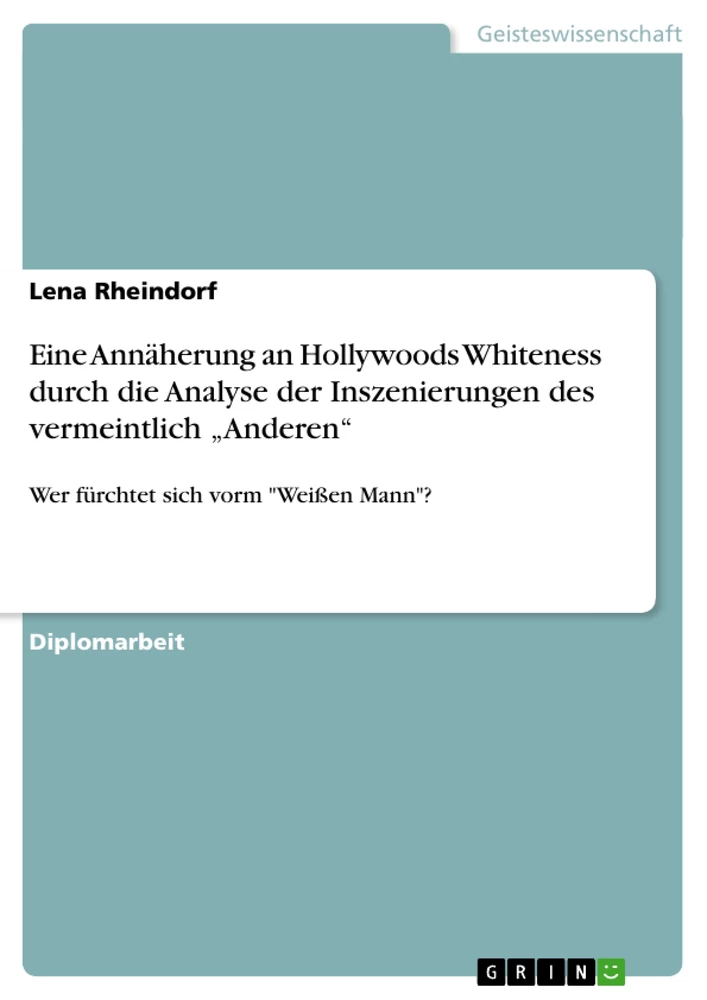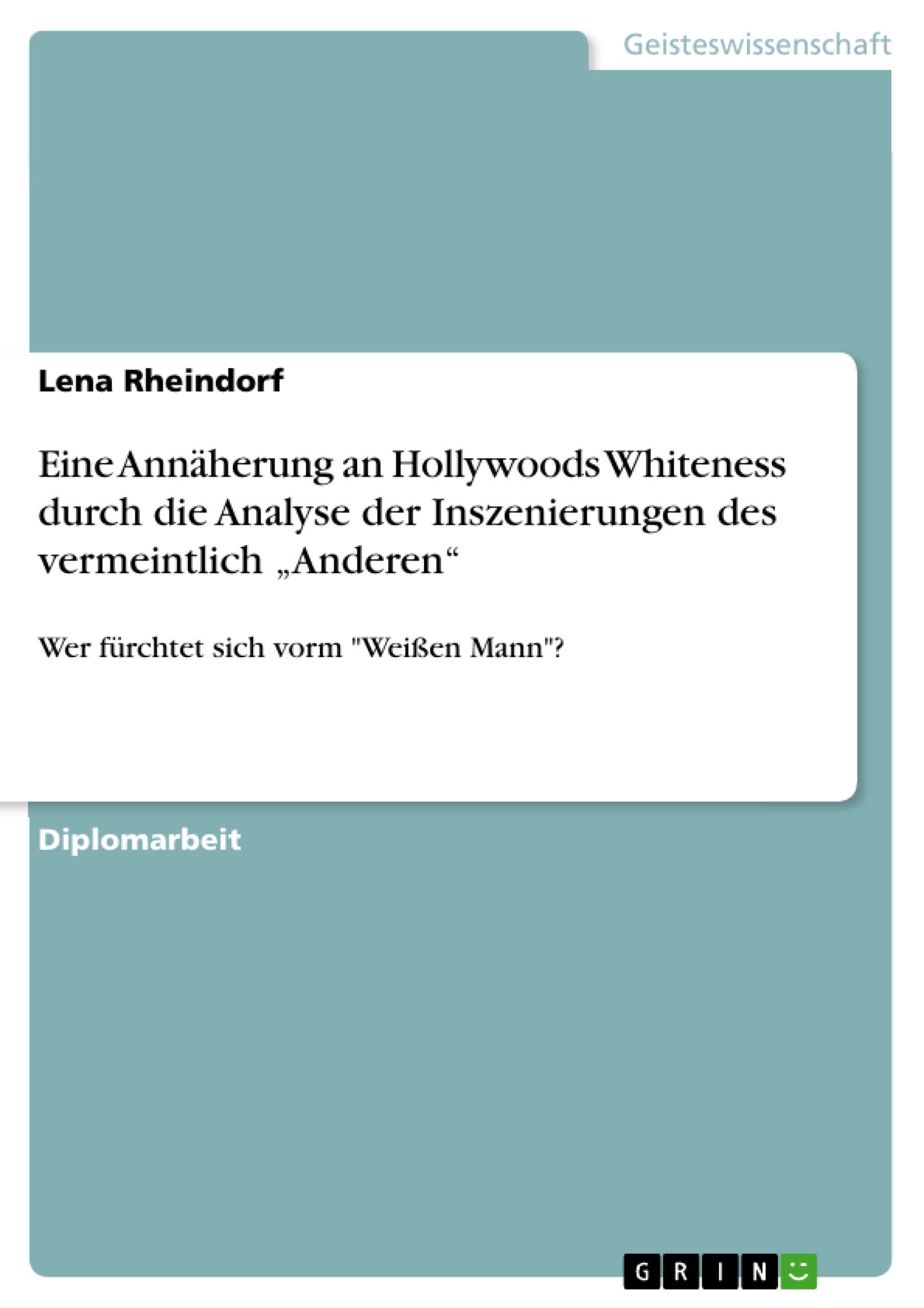Diese Diplomarbeit setzt sich mit der Art und Weise auseinander in der sich die „Weiße“, „abendländische“, geschlechtsspezifische Selbstkonstruktion im Medium der Hollywoodfilme durch Re- und Misspräsentaionen „ethnisch Anderer“ im Laufe der Filmgeschichte verändert hat. Unter dem Konzept der „Whiteness“ wird hierbei vor allem ein Prozess verstanden, durch den es „Weißen“ möglich ist eine hegemoniale, quasi unsichtbare Position der Macht zu beziehen, von der aus es möglich ist „Anderen“ vermeintlich „rassenspezifische“ Attribute zuzuschreiben und zu determinieren. Neben einer Übersicht des, derzeit vor allem US- amerikanischen, wissenschaftlichen Diskurses zum Thema „Whiteness in Hollywoodfilmen“, werden drei Filme im Bezug auf die ihnen innewohnende Whiteness mittels grobanalytischer, filmsoziologisch geleiteter Methode interpretiert und somit die bestehende Whiteness- Theorie erweitert. Indem sie Filme als „lesbare Texte“ auffasst, positioniert sich die Diplomarbeit in den Cultural Studies und damit auch ihrer Filmsemiotik, derzufolge ein Film durch Zeichen Bedeutungen erzeugt, die sich RezipientInnen kommunikativ zueigen machen. Hinter diesem Vorgehen steht die Hypothese, dass sich soziale Gegebenheiten aus Bedeutungen konstituieren, durch deren Interpretation der soziale „Sinngehalt“ von innen erkannt werden soll. Als weiteren Bezugspunkt der Arbeit ist die feministische Medientheorie zu nennen, die Geschlecht als wichtige, gesellschaftlich konstruierte Kategorie auffasst und ihre zentrale Aufgabe in der Bewahrung patriachaler Gefüge, durch Medien als institutionalisierte Einrichtungen erkennt. In dieser Diplomarbeit wird aufgezeigt wie sich, mittels Repräsenationsformen medialer Texte Hollywoods, geschlechtsspezifische Whiteness konstituiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorwort
- 1.1. Aufbau der Diplomarbeit
- 1.2. Schreibweise
- 2. Theoretische Verortung
- 2.1. Cultural Studies
- 2.1.1. Semiotik
- 2.1.2. Der Beitrag feministischer Medienwissenschaften
- 2.1.3. Repräsentation
- 2.1.3.1. Repräsentation von Differenz
- 2.2. Whitenesstheorie
- 2.2.1. Entwicklung der „Weißen“ Kultur
- 2.2.1.1. US-amerikanische Whiteness
- 2.2.2. Whiteness und ihre Bedeutungen
- 2.2.2.1. Whiteness und Körperlichkeit
- 2.2.1. Entwicklung der „Weißen“ Kultur
- 2.3. Hollywoods Whiteness
- 2.3.1. „Weiße“ Körperästhetik und Filmtechnologie
- 2.3.1.1. Lichttechnologie
- 2.3.1.2. Die nachhaltige Entwicklung „Weißer“ Filmtechnologie
- 2.3.1.3. „Weiße“ Film- und Körperästhetik
- 2.3.2. Hollywoods „Weißes“ Starsystem
- 2.3.2.1. Die Konstruktion „Weißer“ Leinwandpaare
- 2.3.3. „Weiße“ filmische Selbstdarstellung
- 2.3.3.1. Konstruktion „Weißer“ Männlichkeit
- 2.3.3.2. Neun gefährliche Frauen?
- 2.3.3.3. Konstruktion „Weißer“ Weiblichkeit
- 2.3.1. „Weiße“ Körperästhetik und Filmtechnologie
- 2.4. Hollywoods Blackness
- 2.4.1. Das Spiegelbild des gebrochenen „Weißen“ Selbst
- 2.4.1.1. Birth of a Nation
- 2.4.1.2. Gone with the Wind
- 2.4.2. Blackness in Zeiten von „Political Correctness“ und Multikulturalität
- 2.4.2.1. Zu ökonomischen Motivationen
- 2.4.3. Stardom und Blackness
- 2.4.3.1. Dorothy Dandridge- Konstruktion „Schwarzer“ Leinwandstars
- 2.4.3.2. Diskontinuitäten?
- 2.4.4. Whiteness in der Krise?
- 2.4.1. Das Spiegelbild des gebrochenen „Weißen“ Selbst
- 2.1. Cultural Studies
- 3. Filmanalyse
- 3.1. Soziologische Filmanalyse
- 3.1.1. Der Filmtext
- 3.1.2. Qualitative Methode der Grobanalyse
- 3.1.2.1. Deutungsmusteranalyse
- 3.1.2.2. Deutung filmischer Codes
- 3.1.2.3. Die Filmerzählung
- 3.2. Vorgehen bei der Filmanalyse
- 3.2.1. Handlungsanalyse
- 3.2.2. Figuren Analyse
- 3.2.3. Analyse der Machart
- 3.2.4. Interpretation
- 3.2.4.1. Probleme des Verfahrens
- 3.1. Soziologische Filmanalyse
- 4. Empirie
- 4.1. The gods must be crazy (1980)
- 4.1.1. Erkenntnisinteresse, Fragestellung und Beschreibung des Datenmaterials
- 4.1.2. Auswertung
- 4.2. The Cider House Rules (1999)
- 4.2.1. Erkenntnisinteresse, Fragestellung und Beschreibung des Datenmaterials
- 4.2.2. Auswertung
- 4.3. Monster’s Ball (2001)
- 4.3.1. Erkenntnisinteresse, Fragestellung und Beschreibung des Datenmaterials
- 4.3.2. Auswertung
- 4.1. The gods must be crazy (1980)
- 5. Resümee und Ausblick
- 6. Reflexion
- 7. Bibliographie
- 7.1. Internet
- 7.2. Literaturempfehlungen
- 7.3. Abbildungsverzeichnis
- 8. Kommentierte Filmographie
- 8.1. Filmempfehlungen
- 9. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die geschlechtsspezifische Selbstkonstruktion im Medium Hollywoodfilme im Laufe der Filmgeschichte anhand der Re- und Misrepräsentationen „Ethnisch Anderer“. Es handelt sich um einen postmodernen Versuch, die filmische Darstellung von Whiteness zu rekonstruieren, dekonstruieren und zu untersuchen.
- Filmische Repräsentation von Whiteness in Hollywood
- Entwicklung der Filmtechnologie und -ästhetik im Kontext von Whiteness
- Konstruktion von „Weißen“ und „Schwarzen“ Starsystemen
- Analyse der Geschlechterrollen und -konstruktionen im Hollywoodkino
- Untersuchung der „Rassen“-Beziehungen im Hollywoodfilm
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorwort: Diese Einleitung erläutert den Aufbau und die Schreibweise der Diplomarbeit. Der Fokus liegt auf der Fragestellung, wie die filmische Darstellung von Whiteness die geschlechtsspezifische Selbstkonstruktion beeinflusst hat und welche Rolle „Ethnisch Andere“ dabei spielen. Es werden die theoretischen Grundlagen in Cultural Studies und feministischer Medientheorie dargelegt und der methodische Ansatz der qualitativen Grobanalyse angekündigt.
2. Theoretische Verortung: Dieses Kapitel verortet die Arbeit theoretisch innerhalb der Cultural Studies und der feministischen Medientheorie. Es werden zentrale Konzepte der Semiotik, der Gender Studies und der Whiteness-Theorie diskutiert, um den Rahmen für die anschließende Filmanalyse zu schaffen. Besonders die Repräsentation von Differenz und die Bedeutung von Whiteness als soziale Konstruktion werden ausführlich behandelt.
3. Filmanalyse: Hier wird die methodische Vorgehensweise der soziologischen Filmanalyse beschrieben. Der Film wird als vielschichtiges Produkt verstanden, dessen Bedeutungen durch die Interaktion von Zeichen, Codes und kulturellen Kontexten entstehen. Die Analyse umfasst Handlungsanalyse, Figuren Analyse, Analyse der Machart (Einstellungen, Montage, Musik, Licht, Farbe) und die Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Whiteness-Theorie.
Schlüsselwörter
Whiteness, Hollywood, Filmtechnologie, Gender, Rasse, Repräsentation, Blackness, Filmanalyse, Cultural Studies, feministische Medientheorie, Stereotypisierung, Identitätskonstruktion, Political Correctness, Multikulturalität, Hollywoodstars.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Filmische Repräsentation von Whiteness in Hollywood
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die geschlechtsspezifische Selbstkonstruktion im Medium Hollywoodfilme im Laufe der Filmgeschichte. Sie analysiert die Re- und Misrepräsentationen „Ethnisch Anderer“ und rekonstruiert, dekonstruiert und untersucht die filmische Darstellung von Whiteness.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die filmische Repräsentation von Whiteness in Hollywood, die Entwicklung der Filmtechnologie und -ästhetik im Kontext von Whiteness, die Konstruktion von „Weißen“ und „Schwarzen“ Starsystemen, die Analyse der Geschlechterrollen und -konstruktionen im Hollywoodkino und die Untersuchung der „Rassen“-Beziehungen im Hollywoodfilm.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verortet sich theoretisch in den Cultural Studies und der feministischen Medientheorie. Zentrale Konzepte der Semiotik, der Gender Studies und der Whiteness-Theorie bilden die Grundlage der Analyse.
Welche Methode wird für die Filmanalyse angewendet?
Es wird eine soziologische Filmanalyse mit qualitativer Grobanalyse durchgeführt. Die Analyse umfasst Handlungsanalyse, Figuren Analyse, Analyse der Machart (Einstellungen, Montage, Musik, Licht, Farbe) und die Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Whiteness-Theorie.
Welche Filme werden analysiert?
Die empirische Untersuchung analysiert drei Filme: „The gods must be crazy“ (1980), „The Cider House Rules“ (1999) und „Monster’s Ball“ (2001).
Wie ist die Diplomarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, eine theoretische Verortung, ein Kapitel zur Filmanalyse, einen empirischen Teil mit der Analyse der drei ausgewählten Filme, ein Resümee und Ausblick, eine Reflexion, eine Bibliographie, eine kommentierte Filmographie und einen Anhang. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Whiteness, Hollywood, Filmtechnologie, Gender, Rasse, Repräsentation, Blackness, Filmanalyse, Cultural Studies, feministische Medientheorie, Stereotypisierung, Identitätskonstruktion, Political Correctness, Multikulturalität, Hollywoodstars.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die Bibliographie und die kommentierte Filmographie bieten detaillierte Angaben zu den verwendeten Quellen und weiteren empfohlenen Filmen.
- Citation du texte
- Lena Rheindorf (Auteur), 2006, Eine Annäherung an Hollywoods Whiteness durch die Analyse der Inszenierungen des vermeintlich „Anderen“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152829