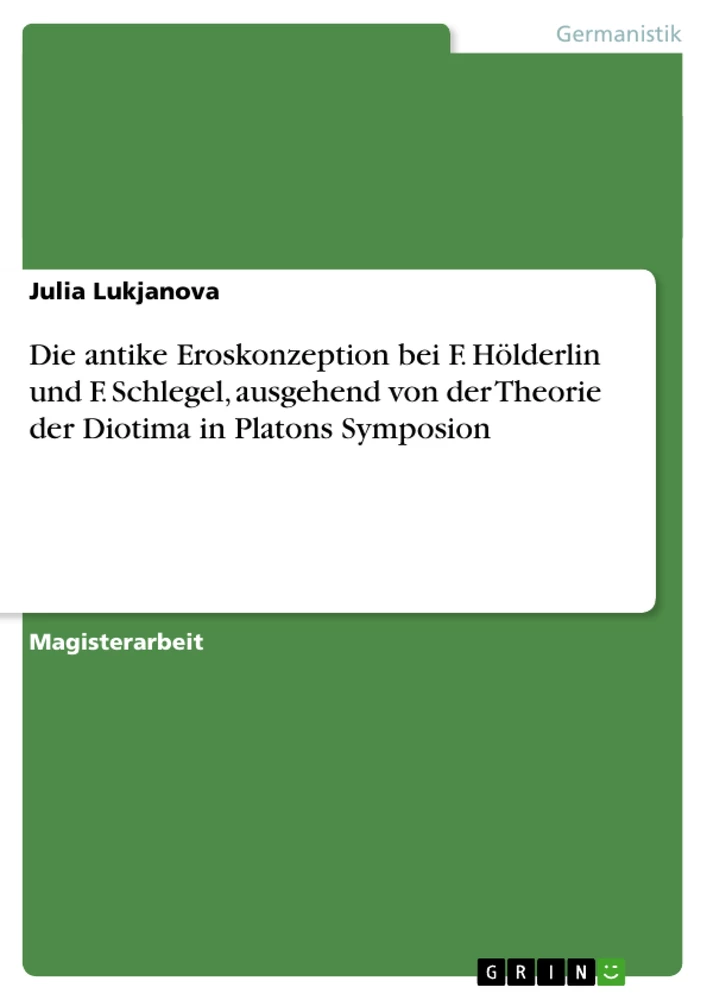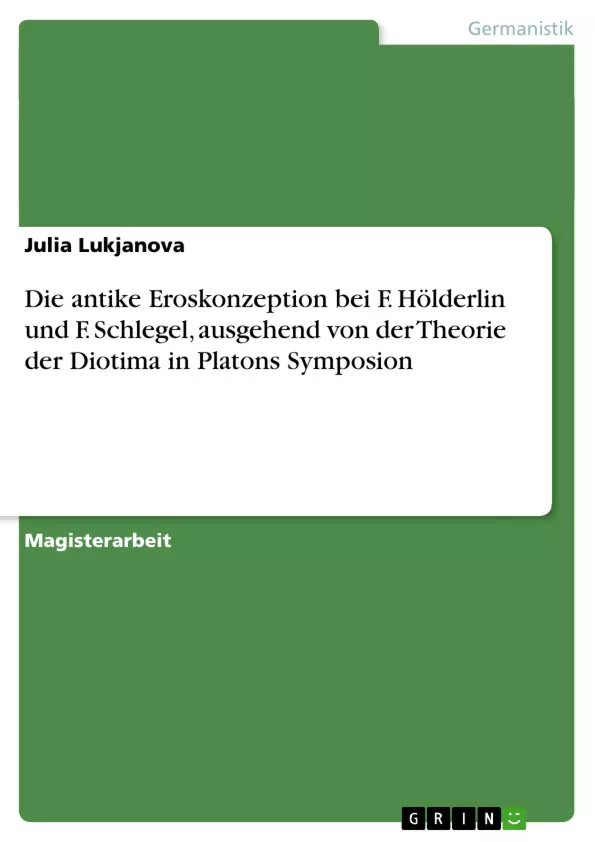Kaum etwas auf dieser Welt bewirkt mehr als die Liebe. Sie macht krank und heilt, sie verursacht Schmerz und bringt Freude, sie hält jung und lässt altern, sie verschönt und vergrämt, aus ihr wächst Leben und manchem ist sie der Tod. Dabei kennt sie keine Grenzen, keine Vorurteile, kein Alter, weder Raum noch Zeit. Liebe ist das Ziel aller menschlichen Sehnsüchte. Unbestritten gehört sie zu den Dingen, die der Mensch notwendig zum Leben braucht. Die Liebe spricht immer aus sich selbst.
Und sie bewegt uns doch, möchte man frei nach Galilei sagen, wenn es um die romantische Liebe geht. Natürlich: in unserer durch die Aufklärung aufgeklärten Zeit, in der alles doppelt und dreifach reflektiert, zitiert und ironisiert wird, findet ein Bekenntnis zur romantischen Liebe in intellektuellen Kreisen – wenn überhaupt – nur noch gebrochen statt. Aber gerade weil mit postmoderner Einstellung „alles geht", funktioniert auch die romantische Liebe wieder. Kassenschlager des Kinos zeigen dies immer wieder: Herz und Schmerz, Sehnsucht und leidenschaftliches Verlangen auch tragischer Untergang – all das rührt uns, obwohl gerade hier der Kitsch so nahe liegt. Dabei ist sie ursprünglich alles andere als kitschig, die romantische Liebe. Denn sie impliziert auch einen enormen anti-bürgerlichen und sozialkritischen Effekt, der um so deutlicher zutage tritt, wenn ihre Verwurzelung in der Religion, speziell im Christentum gesehen wird. So wird auch erklärlich, warum die romantische Liebe im Zuge der Säkularisierung religiöser Überzeugungen und Wertvorstellungen mehr und mehr zum Religionsersatz werden konnte.Die erste Aufgabe der vorliegenden Arbeit besteht darin, die antike Theorie der Liebe und des Eros, welche in Platons „Symposion“ von Sokrates dargelegt wurde und welche er von der Priesterin Diotima empfangen hat, zu erläutern und zu interpretieren. Die zweite Aufgabe ist es, zu untersuchen, welche Folgen und Auswirkungen diese Theorie auf die deutschen Romantiker, konkret auf Friedrich Schlegel und Friedrich Hölderlin, gehabt hat und ob diese Theorie in ihren Romanen „Lucinde“ und „Hyperion“ verkörpert wurde. Des Weiteren werden die Romane unter der besonderen Berücksichtigung der antiken Theorie miteinander verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Platons Ideenlehre
- Liebe und Eros in der Antike
- Platons Eros
- Zusammenfassung
- Die Figur der Diotima
- Die verschiedenen Arten der Liebe
- Der antike Liebesroman
- Eros im antiken Liebesroman
- Antike und Romantik
- Platon in der Romantik
- Charakteristik der Romantik
- Deutsche romantische Lebensphilosophie unter dem Einfluß der Antike
- Klassik und Romantik
- Liebe und Eros in der deutschen Romantik
- Die antike Begrifflichkeit vom Eros und von der Liebe bei Friedrich Schlegel in „Lucinde“
- Einflüsse
- Caroline Böhmer
- Die neue Mythologie
- Müẞiggang
- Der Begriff der Natur
- Die Rolle der Frau als Naturwesen
- Der,,Diotima-Aufsatz“
- Die Struktur des Romans
- Rollentausch
- Die Prometheusgeschichte
- Die Synthese von Geist und Eros
- Die Stufen der Liebe
- Reaktionen der Freunde
- Diotima-Lucinde - Die Auffassung der Liebe bei Friedrich Schlegel
- Romantische Liebe
- Die antike Begrifflichkeit vom Eros und von der Liebe bei Friedrich Hölderlin im „Hyperion“
- Einflüsse
- Die Struktur des Romans
- Figurenkomposition
- Diotima
- Der Begriff der Liebe
- Spinoza und seine Bedeutung für „Hyperion“
- Das Wesen der Schönheit
- Die Elemente der Romantik
- Die Aspekte des Griechenlandbildes im „Hyperion“
- Griechenland - Ideenreich unsterblicher Schönheit
- Der Begriff der Natur
- Eros bei Friedrich Hölderlin
- Eros bei Friedrich Schlegel
- Die Verständnisparallelen beider Romane
- Romantische Liebe ist ganzheitliche Liebe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit untersucht die antike Eroskonzeption, wie sie in Platons "Symposion" dargestellt wird, und ihre Bedeutung für die deutschen Romantiker Friedrich Schlegel und Friedrich Hölderlin. Ziel ist es, die Einflüsse der antiken Philosophie auf die Romantik zu beleuchten und die spezifischen Interpretationen des Eros bei Schlegel und Hölderlin zu analysieren.
- Die Rezeption der antiken Eroskonzeption in der deutschen Romantik
- Die Rolle der Liebe und des Eros in den Werken von Friedrich Schlegel und Friedrich Hölderlin
- Der Einfluss Platons und insbesondere der Figur der Diotima auf die romantische Vorstellung von Liebe
- Die Verbindung von antiker Philosophie und romantischer Lebensphilosophie
- Die Bedeutung des Begriffs der Natur für das Verständnis von Liebe und Eros in der Romantik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die zentralen Fragen sowie die Ziele dar. Im zweiten Kapitel wird die antike Eroskonzeption, die in Platons "Symposion" von Sokrates dargelegt wird, analysiert. Im dritten Kapitel widmet sich die Arbeit Friedrich Schlegels "Lucinde" und untersucht, wie Schlegel die antike Theorie der Liebe und des Eros aufgreift und in seinen Roman integriert. Das vierte Kapitel widmet sich Friedrich Hölderlins "Hyperion" und untersucht die Rolle des Eros in diesem Werk.
Schlüsselwörter
Antike Eroskonzeption, Platons "Symposion", Diotima, Friedrich Schlegel, "Lucinde", Friedrich Hölderlin, "Hyperion", Romantik, Lebensphilosophie, Natur, Liebe, Geist, Synthese, Romantische Liebe.
- Citation du texte
- Julia Lukjanova (Auteur), 2003, Die antike Eroskonzeption bei F. Hölderlin und F. Schlegel, ausgehend von der Theorie der Diotima in Platons Symposion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15293