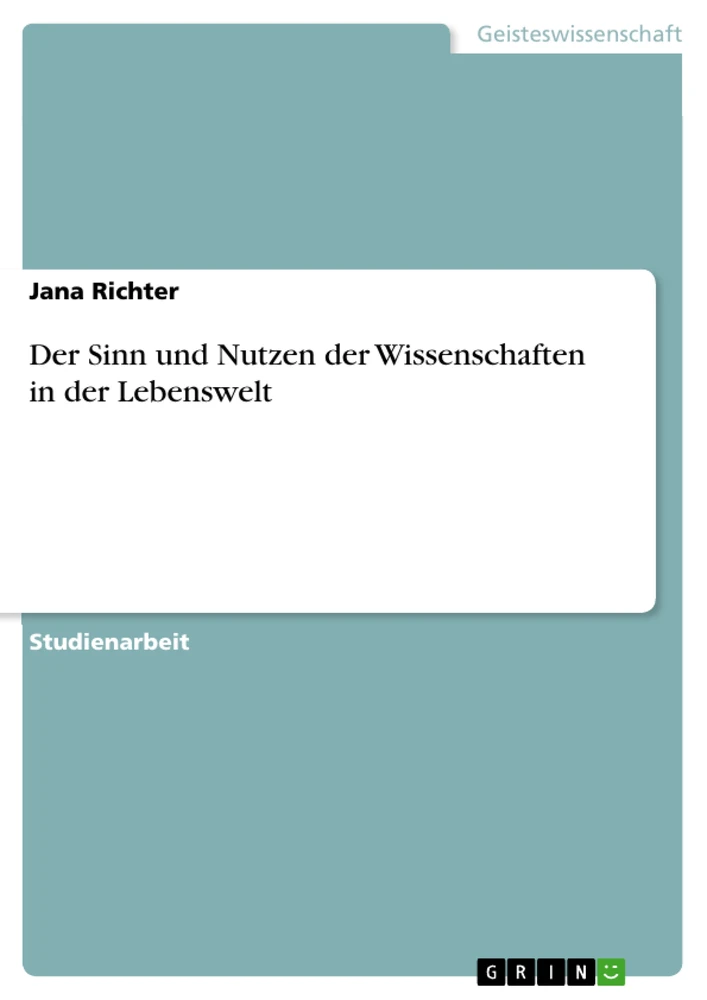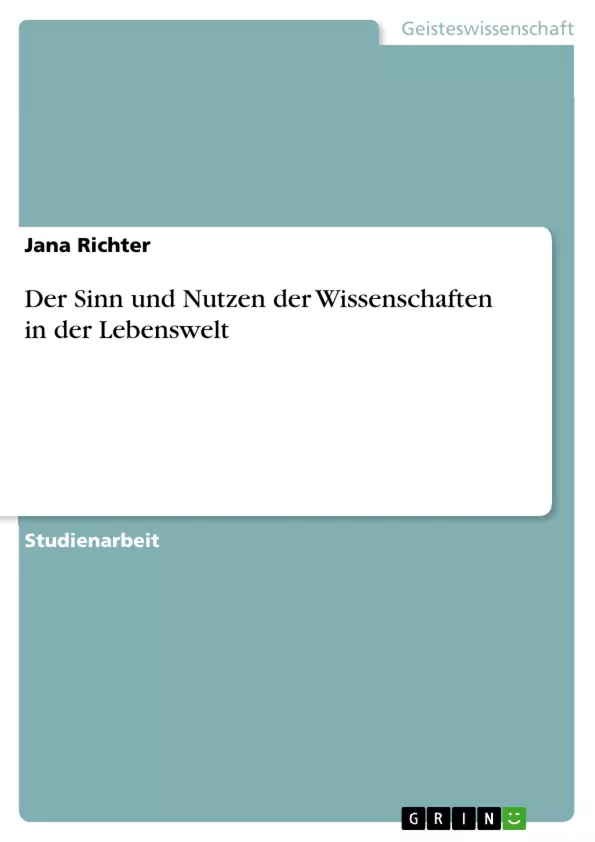„Habe nun, ach! Philosophie/ Juristerei und Medizin,/ und leider auch Theologie/ Durchaus studiert, mit heißen Bemühn./ Da steh ich nun, ich armer Tor,/ Und bin so klug als wie zuvor!“
Viele Wissenschaft studiert zu haben und sich trotzdem unwissend zu fühlen - das ist der Lebensschmerz mit dem Johann Wolfgang Goethes Faust in dem gleichnamigen Theaterstück zu kämpfen hat. „Was die Welt im Innersten zusammenhält“ – das zu erkennen, ist, was Faust will und dieser Wissensdurst ist es dann auch, der ihn dazu verleitet, einen fatalen Pakt mit dem Teufel Mephistopheles einzugehen.
Auch der Astronom und Naturwissenschaftler Isaac Newton mit seinen bahnbrechenden Entdeckungen wie das Gravitationsgesetz und die Bewegungen der Planeten fühlte sich Zeit seines wissenschaftlichen Lebens „wie ein Kind […], das am Strand spielen und sich an den dort gefundenen Muscheln erfreuen konnte, während der riesige Ozean noch unerforscht vor ihm lag.“
In dem Paradox, dass „mit zunehmendem Wissen der anvisierte Horizont des Nichtwissens nicht näher kommt, sondern weiter wegrückt“, steckt jedoch auch das Versprechen der Wissenschaft als ein endloses Abenteuer der Menschheit.
Max Planck spricht in seinem Vortrag Sinn und Grenzen der exakten Wissenschaften von 1941 von der Fähigkeit zu wundern, die beim Kind am ausgeprägtesten ist und dem Forscher gut erhalten bleibt: „Für den wissenschaftlichen Forscher ist es immer ein beglückendes Ereignis und ein frischer Antrieb zur Arbeit, wenn er auf ein neues Wunder stößt, ganz nach der Art des Kindes, und er bemüht sich um dessen Aufklärung durch vielfache Wiederholung der nämlichen Experimente mittels seiner feinen Messungsinstrumente nicht anders als das Kind mit seiner primitiven Klapperbüchse.“ Auch Marc Alexa sieht zuvorderst den Wissensdurst und den Erkenntnisdrang als Voraussetzungen für ein ungebremstes und unvoreingenommenes Forschen, das nicht eher aufhört, bis es eine Lösung gefunden hat.
Ob der Wissenschaftler bei all der Forschungslust nicht die Lebenswirklichkeit aus den Augen verliert, ist u.a. Gegenstand der Schrift Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie des Philosophen Edmund Husserl aus dem Jahr 1936.
Nach Husserl sind die Wissenschaften in eine Krise geraten durch eine Umkehr ihrer Bedeutung an der Jahrhundertwende.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung - Problemstellung und Zielsetzung
- 2. Die Spannung zwischen Lebenswelt und Wissenschaft
- 3. Vom Nutzen der Naturwissenschaften
- 4. Vom Nutzen der Geistes- und Sozialwissenschaften
- 5. Führen die Wissenschaften zu einer besseren Gesellschaft?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage nach dem Sinn und Nutzen der Wissenschaften in der Lebenswelt. Sie analysiert das Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem alltäglichen Erfahrungswissen und untersucht die Rolle der Wissenschaften für die Gestaltung einer besseren Gesellschaft. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Wissenschaften tatsächlich in der Lage sind, existenzielle Fragen zu beantworten, und welche Bedeutung sie für das menschliche Leben besitzen.
- Spannungsfeld zwischen Lebenswelt und Wissenschaft
- Der Nutzen der Naturwissenschaften
- Der Nutzen der Geistes- und Sozialwissenschaften
- Die Rolle der Wissenschaften für eine bessere Gesellschaft
- Die Frage nach dem Sinn und Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung der Seminararbeit ein und definiert den zentralen Forschungsgegenstand, nämlich die Frage nach dem Sinn und Nutzen der Wissenschaften in der Lebenswelt. Das zweite Kapitel beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der lebensweltlichen Erfahrung, wobei der Begriff der Lebenswelt nach Edmund Husserl erläutert wird. Kapitel 3 widmet sich dem Nutzen der Naturwissenschaften und untersucht deren praktische Bedeutung für die Gesellschaft. In Kapitel 4 werden die Geistes- und Sozialwissenschaften in den Fokus gerückt, um deren Nutzen und Relevanz für die Lebenswelt zu beleuchten. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob die Wissenschaften zu einer besseren Gesellschaft beitragen können und inwieweit sie zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen können.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie Lebenswelt, Wissenschaft, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Sinn, Nutzen, Gesellschaft, Existenzialismus, Erkenntnis, Erfahrung und alltägliches Wissen. Die Arbeit fokussiert auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Lebenswelt, wobei die Rolle der Wissenschaften für die Gestaltung einer besseren Gesellschaft im Vordergrund steht.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Edmund Husserl unter der "Krise der europäischen Wissenschaften"?
Husserl kritisiert, dass die Wissenschaften durch eine rein objektive Betrachtung den Bezug zur menschlichen Lebenswelt und zu existenziellen Sinnfragen verloren haben.
Was ist der Unterschied zwischen Natur- und Geisteswissenschaften in Bezug auf ihren Nutzen?
Naturwissenschaften bieten oft praktischen, technologischen Nutzen, während Geistes- und Sozialwissenschaften zur Selbstreflexion, zum Verständnis gesellschaftlicher Prozesse und zur Sinnstiftung beitragen.
Können Wissenschaften zu einer besseren Gesellschaft führen?
Die Arbeit untersucht, inwieweit wissenschaftliche Erkenntnisse zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen können, sofern sie den Bezug zur Lebenswirklichkeit wahren.
Warum fühlen sich Forscher wie Newton oft trotz Entdeckungen "unwissend"?
Es ist ein Paradox der Wissenschaft, dass mit zunehmendem Wissen auch der Horizont des Nichtwissens wächst, was als endloses Abenteuer der Erkenntnis verstanden wird.
Welche Rolle spielt die "Lebenswelt" in der wissenschaftlichen Forschung?
Die Lebenswelt ist die Basis aller Erfahrung; die Forschung muss sicherstellen, dass sie die alltägliche Realität nicht aus den Augen verliert.
- Arbeit zitieren
- Jana Richter (Autor:in), 2010, Der Sinn und Nutzen der Wissenschaften in der Lebenswelt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153055