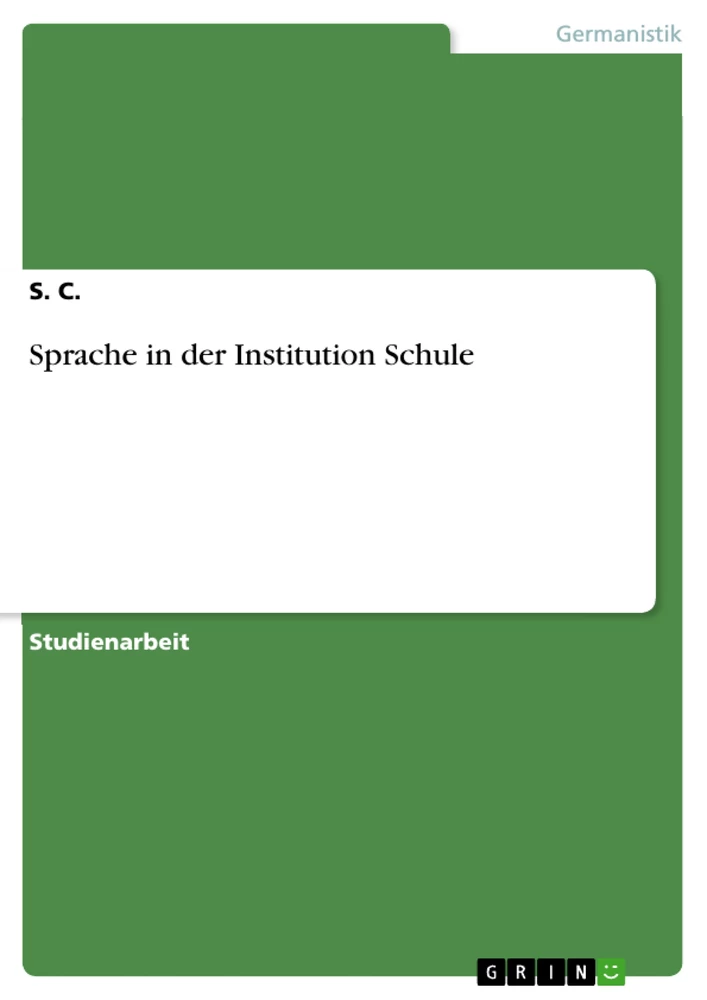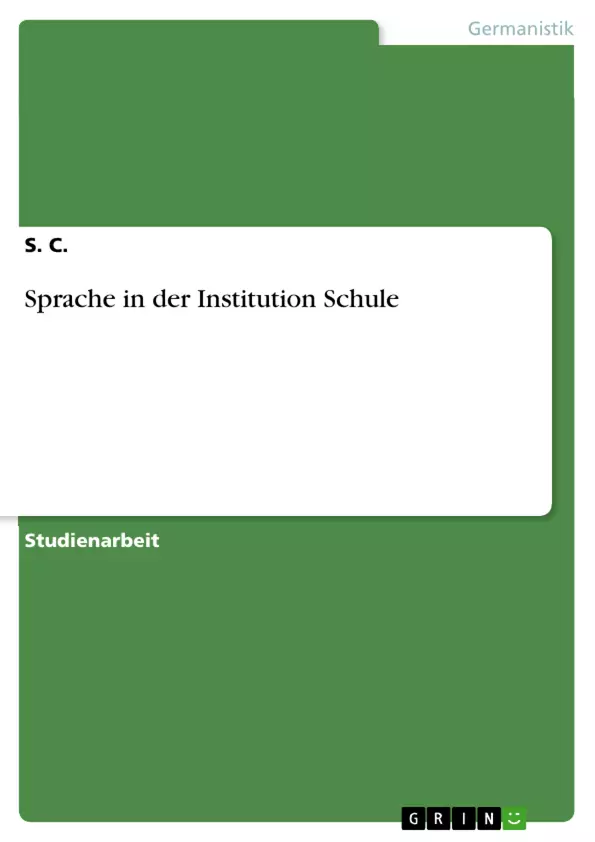Die Institution Schule ist heute ein wichtiger Gegenstand öffentlicher Diskussionen und wissenschaftlicher Disziplinen. Kaum ein Gebiet des gesellschaftlichen Handelns erfährt so viel wissenschaftliche Beachtung.
Kommunikation hat einen großen Stellenwert im täglichen Leben unserer Gesellschaft. Ein großer Teil menschlicher Erfahrungen vollzieht sich verbal und somit spielt auch die institutionelle Kommunikation eine besondere Rolle in unserem Leben, da wir sie alle täglich erleben z.B. in der Schule, am Arbeitsplatz oder auch beim Gang zum Amt. In der Schule findet Wissensvermittlung primär verbal statt.
Diese Arbeit beschäftigt speziell mit der sprachlichen Kommunikation im Unterrichtsprozess und nicht mit Interaktionen, die außerhalb stattfinden (z.B. Pausengespräche), oder außersprachlichen Kommunikationsformen wie Tonhöhe, Gestik, Mimik oder Rhythmus.
Sprache soll nicht nur als einfache Sprachverwendung, sondern als sprachliches Handeln betrachtet werden.
Den theoretischen Rahmen bilden die funktionale Pragmatik, die Beiträge der Sprechakttheorie nach Austin und Searle, die Diskursanalyse und die Ausführungen von Ehlich und Rehbein. Der Aufbau der Arbeit ist Folgender:
Zuerst soll der Begriff der Schule als Institution geklärt werden und in diesem Zusammenhang ihre Funktion erläutert werden. Kapitel drei beinhaltet die verschiedenen sprachlichen Handlungsmuster und soll darstellen, wie der Lehrer im Unterricht sprachlich handelt und welche Handlungsmuster er benutzt. In Kapitel vier geht es dann um die verschiedenen Instruktionsformen, die der Lehrer zur Wissensvermittlung einsetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliche Klärung
- 2.1 Die Schule als Institution und ihre Organisation
- 2.2 Funktion von Schule
- 3. Sprachliche Handlungsmuster
- 3.1 Vorüberlegungen
- 3.2 Das Frage - Antwort - Muster
- 3.3 Das Aufgabe – Lösung – Muster
- 4. Die verschiedenen Formen der Instruktion und ihre Voraussetzungen
- 4.1 Die lehrerzentrierte Form
- 4.1.1 Der Lehrervortrag
- 4.1.2 Das Lehrgespräch
- 4.1.3 Die turn-Organisation
- 4.2 Die schülerzentrierte Form
- 4.2.1 Die Diskussion
- 4.2.2 Die Gruppenarbeit
- 4.2.3 Die turn-Organisation
- 4.1 Die lehrerzentrierte Form
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Kommunikation im schulischen Unterricht. Ziel ist es, die verschiedenen sprachlichen Handlungsmuster und Instruktionsformen im Unterricht zu analysieren und zu beschreiben. Dabei wird der Fokus auf die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden gelegt, ohne Berücksichtigung außerschulischer Interaktionen oder nichtsprachlicher Kommunikationsmittel.
- Die Schule als Institution und ihre Organisation
- Sprachliche Handlungsmuster im Unterricht
- Lehrerzentrierte und schülerzentrierte Instruktionsformen
- Die Funktion von Sprache in der Wissensvermittlung
- Theoretische Grundlagen der funktionalen Pragmatik, Sprechakttheorie und Diskursanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung der Institution Schule und der sprachlichen Kommunikation im Unterricht. Sie umreißt das Thema der Arbeit, das sich auf die sprachliche Kommunikation im Unterrichtsprozess konzentriert und dabei die funktionale Pragmatik, die Sprechakttheorie und die Diskursanalyse als theoretischen Rahmen nutzt. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau, der sich mit der Begriffsklärung von Schule als Institution, sprachlichen Handlungsmustern und verschiedenen Instruktionsformen auseinandersetzt.
2. Begriffliche Klärung: Dieses Kapitel definiert Schule als Institution und analysiert ihre Organisation und Funktionen. Es beschreibt Schule als gesellschaftlichen Apparat mit dem Ziel, Wissen an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Die Organisation wird anhand von Regeln, Rollenverteilung (Lehrer und Schüler), räumlichen Gegebenheiten (Klassenzimmer) und zeitlicher Struktur (Stundenplan) erläutert. Weiterhin werden die Qualifikations-, Legitimations- und Selektionsfunktionen von Schule detailliert beschrieben und deren Bedeutung im gesellschaftlichen Kontext herausgestellt. Der aktive Beitrag der Schüler zum Gelingen dieser Funktionen wird als essentielle Voraussetzung hervorgehoben.
3. Sprachliche Handlungsmuster: Kapitel 3 befasst sich mit der sprachlichen Kommunikation im Unterricht. Es betont die zentrale Rolle von Sprache in den meisten Unterrichtsfächern und führt in die Thematik der kommunikativen Praxis ein. Es kündigt die Analyse von spezifischen Handlungsmustern an, wie zum Beispiel dem Frage-Antwort- und dem Aufgaben-Lösung-Muster, ohne diese jedoch bereits im Detail zu behandeln. Der Abschnitt stellt die Verzahnung von Sprache und Wissenstransfer in den Fokus.
4. Die verschiedenen Formen der Instruktion und ihre Voraussetzungen: Dieses Kapitel differenziert zwischen lehrerzentrierten und schülerzentrierten Instruktionsformen. Es beschreibt verschiedene Methoden der Wissensvermittlung, sowohl solche, bei denen der Lehrer im Mittelpunkt steht (z.B. Lehrervortrag, Lehrgespräch), als auch solche, die die Schüler stärker in den Prozess einbeziehen (z.B. Diskussion, Gruppenarbeit). Die Rolle der Organisation, insbesondere die "turn-Organisation", wird im Zusammenhang mit beiden Formen diskutiert. Die Kapitel verdeutlicht die unterschiedlichen didaktischen Ansätze und deren Auswirkungen auf die sprachliche Kommunikation im Klassenzimmer.
Schlüsselwörter
Schule, Institution, Kommunikation, sprachliches Handeln, Unterricht, Instruktionsformen, lehrerzentriert, schülerzentriert, funktionale Pragmatik, Sprechakttheorie, Diskursanalyse, Wissensvermittlung, Qualifikation, Legitimation, Selektion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Sprachliche Kommunikation im schulischen Unterricht"
Was ist der Inhalt des Textes "Sprachliche Kommunikation im schulischen Unterricht"?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die sprachliche Kommunikation im schulischen Unterricht. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener sprachlicher Handlungsmuster und Instruktionsformen im Unterricht, insbesondere der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden. Theoretische Grundlagen aus der funktionalen Pragmatik, Sprechakttheorie und Diskursanalyse werden einbezogen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Begriffliche Klärung (inkl. Schule als Institution und ihre Organisation und die Funktion von Schule), 3. Sprachliche Handlungsmuster (inkl. Frage-Antwort-Muster und Aufgabe-Lösung-Muster), 4. Die verschiedenen Formen der Instruktion und ihre Voraussetzungen (inkl. lehrerzentrierte und schülerzentrierte Formen wie Lehrervortrag, Lehrgespräch, Diskussion und Gruppenarbeit) und 5. Zusammenfassung.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, die sprachlichen Handlungsmuster und Instruktionsformen im Unterricht zu analysieren und zu beschreiben. Der Schwerpunkt liegt auf der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden. Außerschulische Interaktionen und nichtsprachliche Kommunikationsmittel werden dabei nicht berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind: Schule als Institution und ihre Organisation, sprachliche Handlungsmuster im Unterricht, lehrerzentrierte und schülerzentrierte Instruktionsformen, die Funktion von Sprache in der Wissensvermittlung und die theoretischen Grundlagen der funktionalen Pragmatik, Sprechakttheorie und Diskursanalyse.
Welche Arten von Instruktionsformen werden unterschieden?
Der Text unterscheidet zwischen lehrerzentrierten und schülerzentrierten Instruktionsformen. Beispiele für lehrerzentrierte Formen sind der Lehrervortrag und das Lehrgespräch. Schülerzentrierte Formen umfassen beispielsweise Diskussionen und Gruppenarbeiten. Die "turn-Organisation" wird im Zusammenhang mit beiden Formen diskutiert.
Welche sprachlichen Handlungsmuster werden analysiert?
Der Text erwähnt das Frage-Antwort-Muster und das Aufgabe-Lösung-Muster als Beispiele für sprachliche Handlungsmuster im Unterricht, verspricht aber eine detailliertere Analyse in späteren Kapiteln.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Der Text stützt sich auf die funktionalen Pragmatik, die Sprechakttheorie und die Diskursanalyse als theoretische Grundlagen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Schule, Institution, Kommunikation, sprachliches Handeln, Unterricht, Instruktionsformen, lehrerzentriert, schülerzentriert, funktionale Pragmatik, Sprechakttheorie, Diskursanalyse, Wissensvermittlung, Qualifikation, Legitimation und Selektion.
- Quote paper
- S. C. (Author), 2006, Sprache in der Institution Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153109