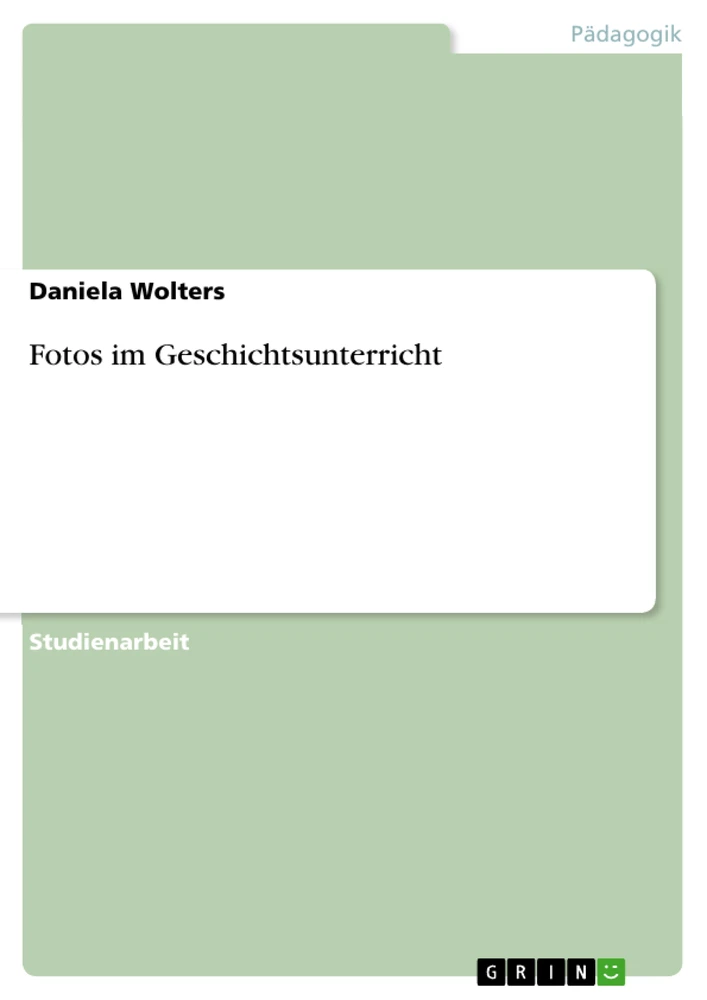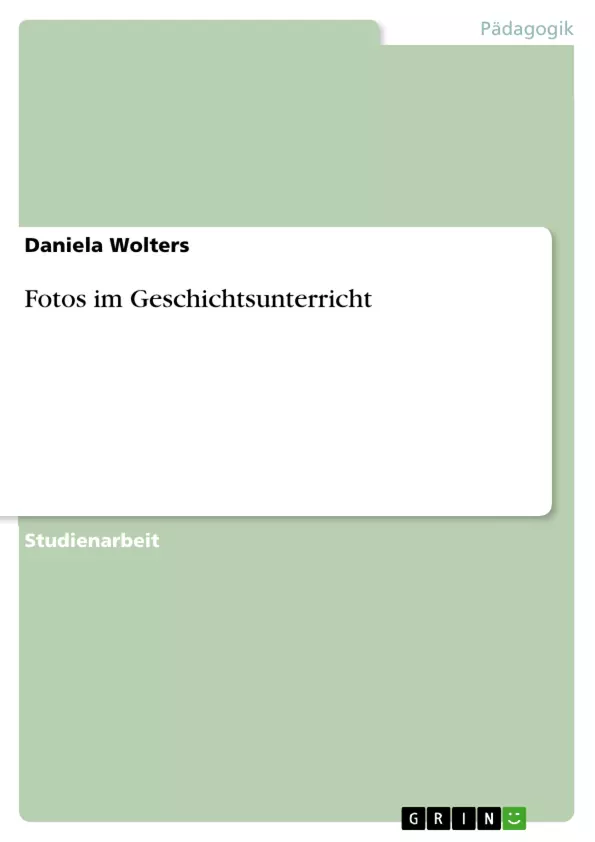1. Einleitung
Fotos sind aus unserer heutigen Lebenswirklichkeit nicht mehr wegzudenken. Jedes Ereignis, sei es eine Familienfeier, Einschulung oder Urlaub wird mit der Digitalkamera und ihrer stetig wachsenden Anzahl an Pixeln peinlich genau dokumentiert. Die Anti-Rote-Augen Taste, der Sepia oder Schwarz-Weiß Effekt können gleich vor Ort Un- ebenheiten ausgleichen oder der Fotografie einen ganz anderen Charakter verleihen. Damit sind aber längst nicht alle Möglichkeiten der privaten Bildbearbeitung ausgereizt. Am heimischen Computer wird weiter in die Trickkiste gegriffen bis das erwünschte Resultat erreicht wird.
Früher hingegen galt die Fotografie nicht als modellierbares Massenprodukt, sondern fand sich in besser betuchten Gesellschaften wieder, die sich für das Festhalten der Erinnerung noch Zeit nahmen. Ganz anders war demnach auch die Betrachtung dieser Unikate. Hier oblag allein dem Fotografen die Auswahl des Winkels, der Lichtverhältnisse, des Bildausschnitts usw. Schnell haben aber auch Machthaber erkannt, dass sich inszenierte oder gar manipulierte Fotografien für ihre Zwecke einsetzbar waren.
Die Fotografie bildet uns Geschehenes ab, auch geschichtliche Ereignisse werden festgehalten. Das was unser Auge visuell dargestellt bekommt, hat einen hohen Authentizitätsbonus, da Bilder viel einprägsamer sind, als beispielsweise Texte. Dementsprechend vertraut man der Fotografie sehr schnell, die jedoch ohne jegliche Recherche eine Vielzahl an möglichen Sichtweisen für das Abgebildete eröffnen kann. Dies kann bei Familienfotos in lustiges Raten ausarten, aber im Geschichtsunterricht sollte man darauf eingehen.
Es gibt verschiedene Verfahren Fotos im Geschichtsunterricht einzusetzen, von denen ich einige in dieser Arbeit vorstellen möchte. Es soll um die Chancen gehen, die die Fotografie dem Unterricht eröffnet, aber auch ebenso um die Risiken, die dieses Thema birgt. Dafür habe ich mich exemplarisch für zwei Diktaturen des 20. Jahrhunderts entschieden, die sich besonders durch ihren ganz eigenen Umgang mit der Fotografie auszeichneten: der Nationalsozialismus und der Stalinismus. Beide Diktaturen machten sich die Fotografie für ihre Machtsicherung zu nutze, jedoch auf sehr unterschiedliche Weise. Unter Stalin wurden bereits existierende Fotos für unterschiedliche Zwecke manipuliert, während die Fotografien, die im Nationalsozialismus entstanden sind, eigens zu Imagezwecken inszeniert wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fotografie, die lügende Quelle?
- Fotografische Manipulation am Beispiel von Stalins Retuschen
- Fotopropaganda im Nationalsozialismus
- Einsatz historischer Fotografien im Geschichtsunterricht
- Analyse von Fotografien
- Handlungsorientierter Unterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einsatz von Fotos im Geschichtsunterricht, insbesondere im Kontext der Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Sie analysiert die Chancen und Risiken, die Fotografien für den Unterricht bieten, und zeigt auf, wie sich diese im Kontext des Nationalsozialismus und des Stalinismus manifestieren.
- Die Bedeutung von Fotos als historische Quellen
- Die Manipulation von Fotos in der Propaganda
- Die Analyse und Interpretation historischer Fotografien im Unterricht
- Die Nutzung von Fotos für handlungsorientierten Geschichtsunterricht
- Die kritische Betrachtung von Fotos als visuelle Medien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Fotos in unserer heutigen Lebenswelt und im Geschichtsunterricht. Es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit Fotos als authentische Quellen für die Vergangenheit dienen können.
- Fotografie, die lügende Quelle?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der manipulativen Verwendung von Fotos in der Propaganda und zeigt am Beispiel von Stalins Retuschen auf, wie Fotos für politische Zwecke instrumentalisiert wurden. Der Abschnitt widmet sich auch der Fotopropaganda im Nationalsozialismus.
- Einsatz historischer Fotografien im Geschichtsunterricht: Hier werden Möglichkeiten für den Einsatz von Fotografien im Geschichtsunterricht beleuchtet, darunter die Analyse von Fotos und die Entwicklung handlungsorientierter Unterrichtsformen.
Schlüsselwörter
Fotografie, Geschichtsunterricht, Diktaturen des 20. Jahrhunderts, Propaganda, Fotomanipulation, Stalin, Nationalsozialismus, Bildanalyse, Handlungsorientierung, Authentizität, Quellenkritik, visuelle Medien.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Fotos wichtige Quellen im Geschichtsunterricht?
Fotos besitzen einen hohen Authentizitätsbonus und sind oft einprägsamer als Texte. Sie ermöglichen einen visuellen Zugang zu vergangenen Ereignissen.
Wie manipulierte Stalin historische Fotografien?
Unter Stalin wurden unliebsame Personen (politische Gegner) nachträglich aus Fotos wegretuschiert, um die Geschichte im Sinne der Machtführung umzuschreiben.
Was ist der Unterschied zwischen Stalins Manipulation und NS-Fotopropaganda?
Während Stalin oft existierende Fotos nachträglich veränderte, setzte der Nationalsozialismus primär auf von vornherein inszenierte Fotografien zur Imagepflege.
Welche Risiken birgt die Arbeit mit Fotos im Unterricht?
Das größte Risiko ist das blinde Vertrauen in die Echtheit. Ohne Quellenkritik können Manipulationen oder Inszenierungen als objektive Realität missverstanden werden.
Was versteht man unter handlungsorientiertem Unterricht mit Fotos?
Schüler analysieren Fotos nicht nur passiv, sondern arbeiten aktiv damit, vergleichen verschiedene Perspektiven oder erstellen eigene Bildinterpretationen.
- Quote paper
- Daniela Wolters (Author), 2009, Fotos im Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153129