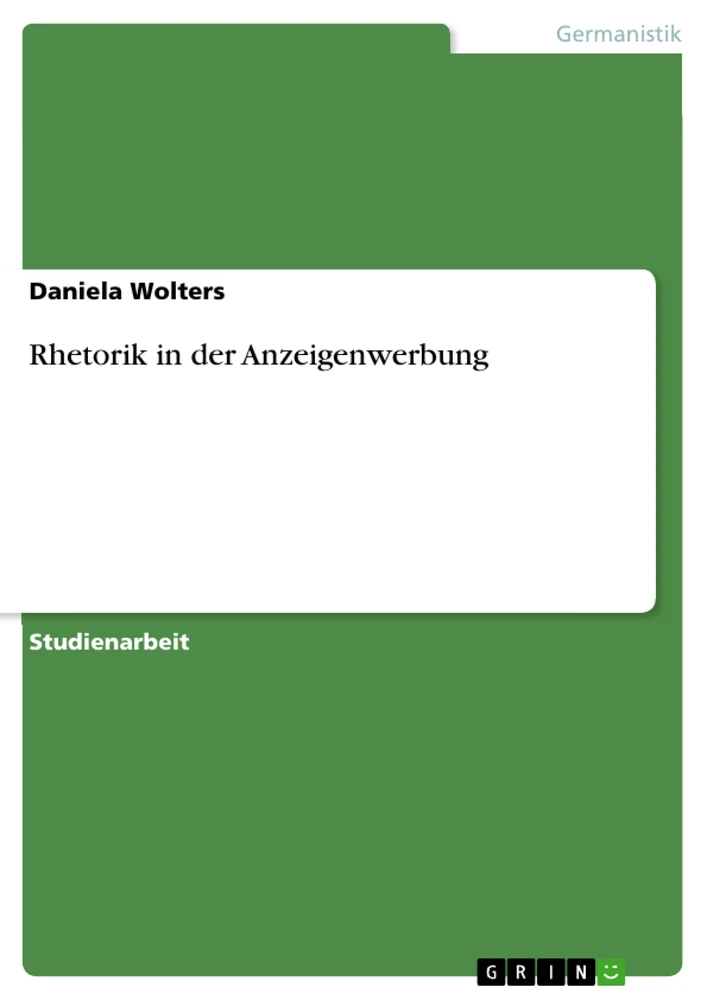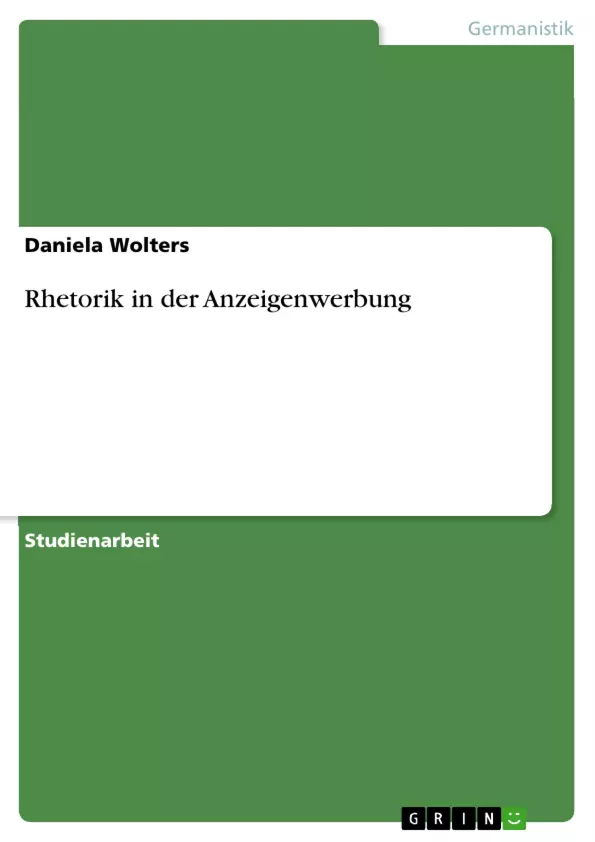Im 21. Jahrhundert ist Werbung aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie
begleitet uns in allen Lebenslagen: beim Warten auf Bus und Bahn, beim
Durchblättern der Lieblingszeitschrift, als Filmunterbrechung im Fernsehen
oder beim Surfen durchs Internet. Ob auf Plakaten, in Form gedruckter Anzeigen,
als kurze Spots oder als interaktive Animation, die Werbung ist omnipräsent.
Parallel zur stetig anwachsenden Vielfalt der Produkte wächst auch der
Kampf der Werbung um die Gunst des Konsumenten. Die Werbung wird immer
komplexer und bedient sich verschiedenster Kunstgriffe, um aus der Masse
herauszustechen. Griffige Slogans dienen der Einprägsamkeit und bestenfalls
folgt der Kauf des Produktes. Wortarten werden gezielt eingesetzt und
auch Wortneubildungen finden sich immer häufiger in Werbeanzeigen. Es entstehen
durchaus witzige und plakative Werbeanzeigen, die durch Sprachspiel
und rhetorische Figuren nicht ihr Ziel verfehlen, auf sich aufmerksam zu machen.
Der Aspekt der Rhetorik in der Werbeanzeige soll im Mittelpunkt dieser Arbeit
stehen. Zuerst gebe ich einen allgemeinen Überblick zum Thema Werbung, um
mich danach hauptsächlich auf den Bereich der Rhetorik zu beschränken. Dazu
werde ich theoretische Grundlagen hinzuziehen und verschiedene Werbeanzeigen
untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mittel der Werbung
- Werbeträger
- Werbeziele
- Sprache
- Die Werbeanzeige
- Rhetorik
- Rhetorische Figuren
- Sprachspiele
- Analyse verschiedener Werbeanzeigen
- Ramazzotti
- Shell
- Arte
- citibank
- Ritter Sport
- Mercedes-Benz
- BMW
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einsatz von Rhetorik in der Anzeigenwerbung. Das Ziel ist es, die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sprache und rhetorische Mittel in der Werbung eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit des Konsumenten zu gewinnen und den Absatz von Produkten zu fördern.
- Die Bedeutung der Werbung im modernen Alltag
- Die verschiedenen Mittel und Strategien der Werbung
- Der Einsatz von Rhetorik in Werbeanzeigen
- Die Analyse von Beispielen aus der Praxis
- Die Wirkung von rhetorischen Figuren und Sprachspielen auf den Konsumenten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Werbung im 21. Jahrhundert ein und betont ihre Omnipräsenz im modernen Alltag. Der zunehmende Wettbewerb um die Gunst des Konsumenten führt zu einer komplexeren und ausgefeilteren Gestaltung von Werbekampagnen. Insbesondere der Einsatz von Rhetorik in Werbeanzeigen wird als zentrales Thema der Arbeit hervorgehoben.
2. Mittel der Werbung
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Mittel der Werbung, darunter die Auswahl geeigneter Werbeträger, die Festlegung von Werbeziele und die Verwendung von Sprache. Es werden Beispiele für innovative Werbeträger und deren Einfluss auf die Wahrnehmung der Werbung vorgestellt.
3. Rhetorik
Hier werden die Grundlagen der Rhetorik erläutert, insbesondere der Einsatz von rhetorischen Figuren und Sprachspielen in der Werbung. Die Bedeutung dieser Mittel für die Wirksamkeit von Werbekampagnen wird beleuchtet.
4. Analyse verschiedener Werbeanzeigen
Dieses Kapitel analysiert verschiedene Werbeanzeigen aus unterschiedlichen Bereichen und zeigt auf, wie Rhetorik eingesetzt wird, um Aufmerksamkeit zu gewinnen, Produkteigenschaften hervorzuheben und Kaufentscheidungen zu beeinflussen.
Schlüsselwörter
Werbung, Werbeträger, Werbeziele, Rhetorik, rhetorische Figuren, Sprachspiele, Werbeanalyse, Konsument, Produkt, Kaufentscheidung, Effizienz.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Rhetorik in der Werbung?
Rhetorik dient dazu, aus der Masse der Werbebotschaften herauszustechen, die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu binden und Produkte einprägsam zu machen.
Was sind typische rhetorische Figuren in Werbeanzeigen?
Häufig genutzt werden Metaphern, Alliterationen, Ironie oder Wortneubildungen, um Slogans griffiger und witziger zu gestalten.
Warum nutzen Werber Sprachspiele?
Sprachspiele erzeugen einen Überraschungseffekt und regen den Konsumenten zum Nachdenken an, was die Erinnerung an die Marke stärkt.
Welche Marken werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht Werbeanzeigen von Ramazzotti, Ritter Sport, Mercedes-Benz, BMW, Shell und anderen.
Was ist das Ziel einer Werbeanalyse?
Es geht darum, die eingesetzten Kunstgriffe und Strategien aufzudecken, mit denen Werbung versucht, Kaufentscheidungen zu beeinflussen.
- Quote paper
- Daniela Wolters (Author), 2008, Rhetorik in der Anzeigenwerbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153135