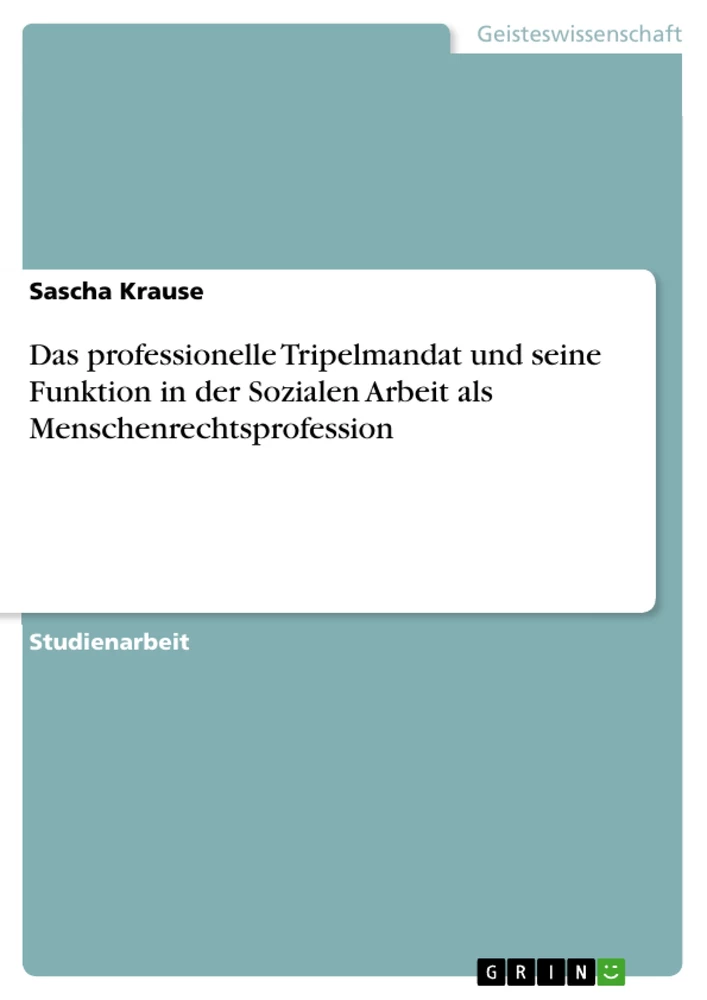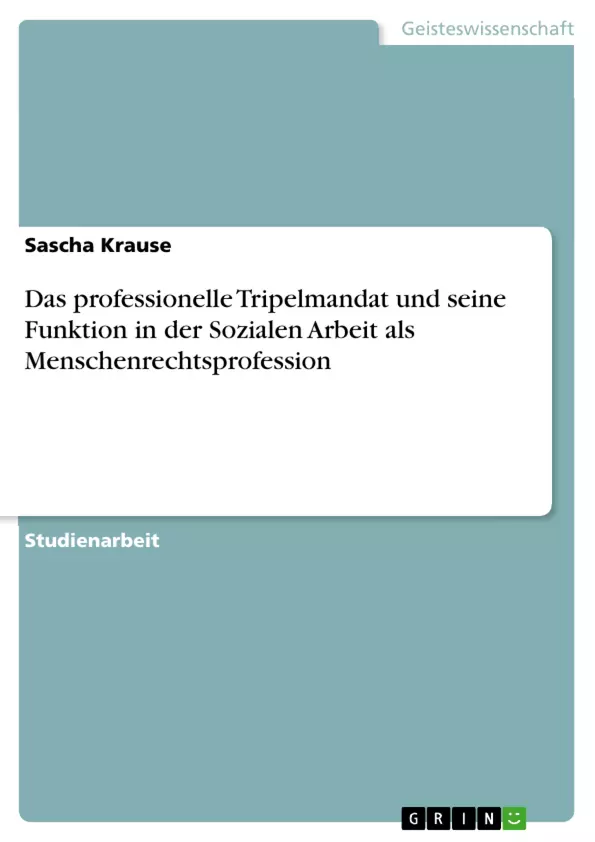Die Forderung, das klassische Doppelmandat Sozialer Arbeit zu einem Tripelmandat zu erweitern beinhaltet im Sinne Staub – Bernasconis, dass sich Soziale Arbeit neben den Ansprüchen der Klienten und den gesetzten Anforderungen durch die Gesellschaft eine dritte Bezugesebene setzt. Diese solle aus wissenschaftlichem Beschreibungs- und Erklärungswissen sozialer Probleme bestehen – und hieraus resultierenden wissenschaftsbegründeten Arbeitsweisen und Methoden, aus einer professionsspezifischen ethischen Bewertungsbasis (Berufskodex) sowie aus den im Berufskodex erwähnten Menschenrechten als Legitimationsbasis.
Um nun die Funktion dieses Tripelmandates in der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession zu erklären und die Sinnhaftigkeit der Forderung nach einem solchen Mandat herauszustellen, wäre zunächst die Frage zu beantworten, inwieweit Soziale Arbeit eine Menschenrechtsprofession ist – oder sein sollte. Insbesondere, da sich das Tripelmandat selbst auf die Menschenrechte als Legitimationsbasis bezieht, sind die Begriffe „Menschenrechte“ und dementsprechend, als Schutzgegenstand ebendieser, „Menschenwürde“ zu betrachten und innerhalb der Profession Sozialer Arbeit zu positionieren.
Eine solche Positionierung benötigt zum einen eine Klärung der Begriffe an sich, zum anderen eine Betrachtung der Begriffe aus sozialarbeitswissenschaftlicher Sicht – und somit der Beantwortung der Frage, in welchen Beziehungen die Menschenrechte in der Profession Sozialer Arbeit eine Rolle spielen (müssen).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Menschenrechte - Menschenwürde
- 1.1. Historische Entwicklung der Menschenrechte
- 1.2. Menschenwürde – Definitionsversuch
- 1.3. Grundlegendes zu Menschenrechten im Verständnis
- 2. Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession?
- 2.1. Kritik an der Definition als Menschenrechtsprofession
- 2.2. Was spricht für die Menschenrechtsprofession?
- 2.3. Zusammenführendes
- 3. Von der Notwendigkeit eines dritten Mandates in der Profession „Soziale Arbeit“
- 3.1. Die Funktion Sozialer Arbeit ein systemischer Blick und Versuch einer Gegenstandsbestimmung
- 3.2. Die Notwendigkeit der Selbstbestimmung Sozialer Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erweiterung des klassischen Doppelmandats der Sozialen Arbeit zu einem Tripelmandat. Im Zentrum steht die Analyse der Funktion dieses Tripelmandats im Kontext der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession. Der Fokus liegt auf der Klärung der Frage, inwieweit Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession verstanden werden kann und sollte, sowie auf der Notwendigkeit und den Inhalten eines dritten Mandates in der Profession.
- Menschenrechte und Menschenwürde als Grundlage der Sozialen Arbeit
- Historische Entwicklung der Menschenrechte
- Das Tripelmandat als Erweiterung des Doppelmandats der Sozialen Arbeit
- Die Funktion des Tripelmandats in der Profession „Soziale Arbeit“
- Die Bedeutung des „bewertenden“ Teils des Tripelmandats (Berufskodex und Menschenrechte)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Tripelmandats und die Frage nach der Funktion der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession ein. Sie betont die Bedeutung der Menschenrechte und der Menschenwürde als Legitimationsbasis für Soziale Arbeit.
Kapitel 1 befasst sich mit den Menschenrechten und der Menschenwürde. Es behandelt die historische Entwicklung der Menschenrechte, geht auf die Definition von Menschenwürde ein und beleuchtet grundlegende Aspekte von Menschenrechten im Verständnis der Sozialen Arbeit.
Kapitel 2 beleuchtet die Frage, ob Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession verstanden werden kann und sollte. Es werden sowohl kritische Argumente gegen diese Definition als auch Argumente für die Menschenrechtsprofession diskutiert.
Kapitel 3 widmet sich der Notwendigkeit eines dritten Mandates in der Profession „Soziale Arbeit“. Es beleuchtet die Funktion Sozialer Arbeit aus systemischer Sicht und untersucht die Notwendigkeit der Selbstbestimmung der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie Menschenrechte, Menschenwürde, Tripelmandat, Doppelmandat, Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, Berufskodex und Selbstbestimmung der Sozialen Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Sascha Krause (Autor:in), 2009, Das professionelle Tripelmandat und seine Funktion in der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153184