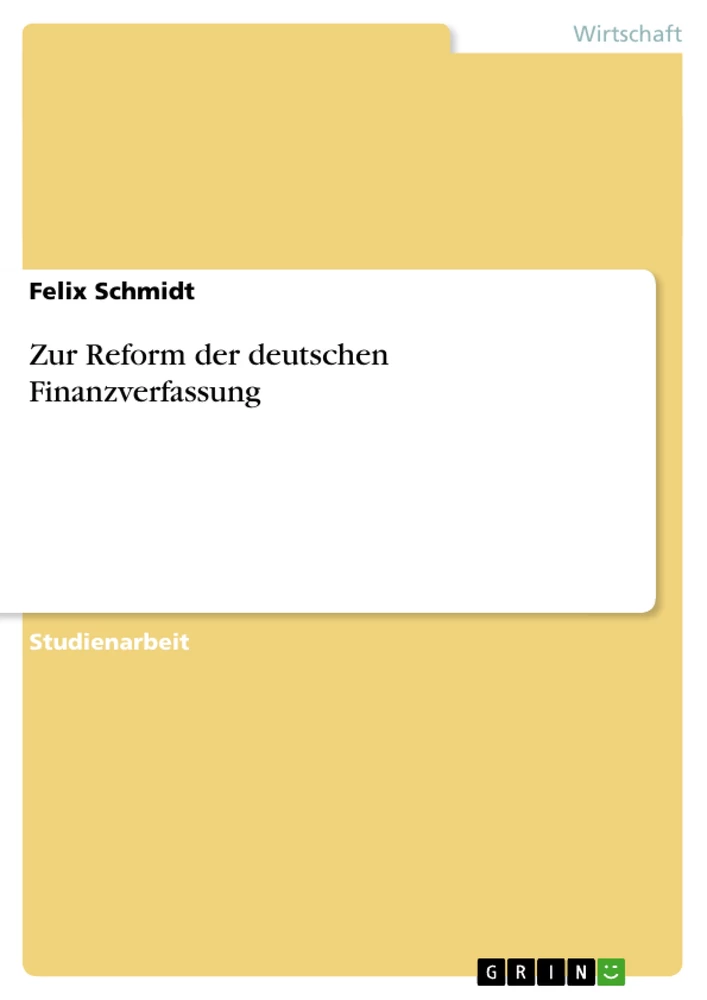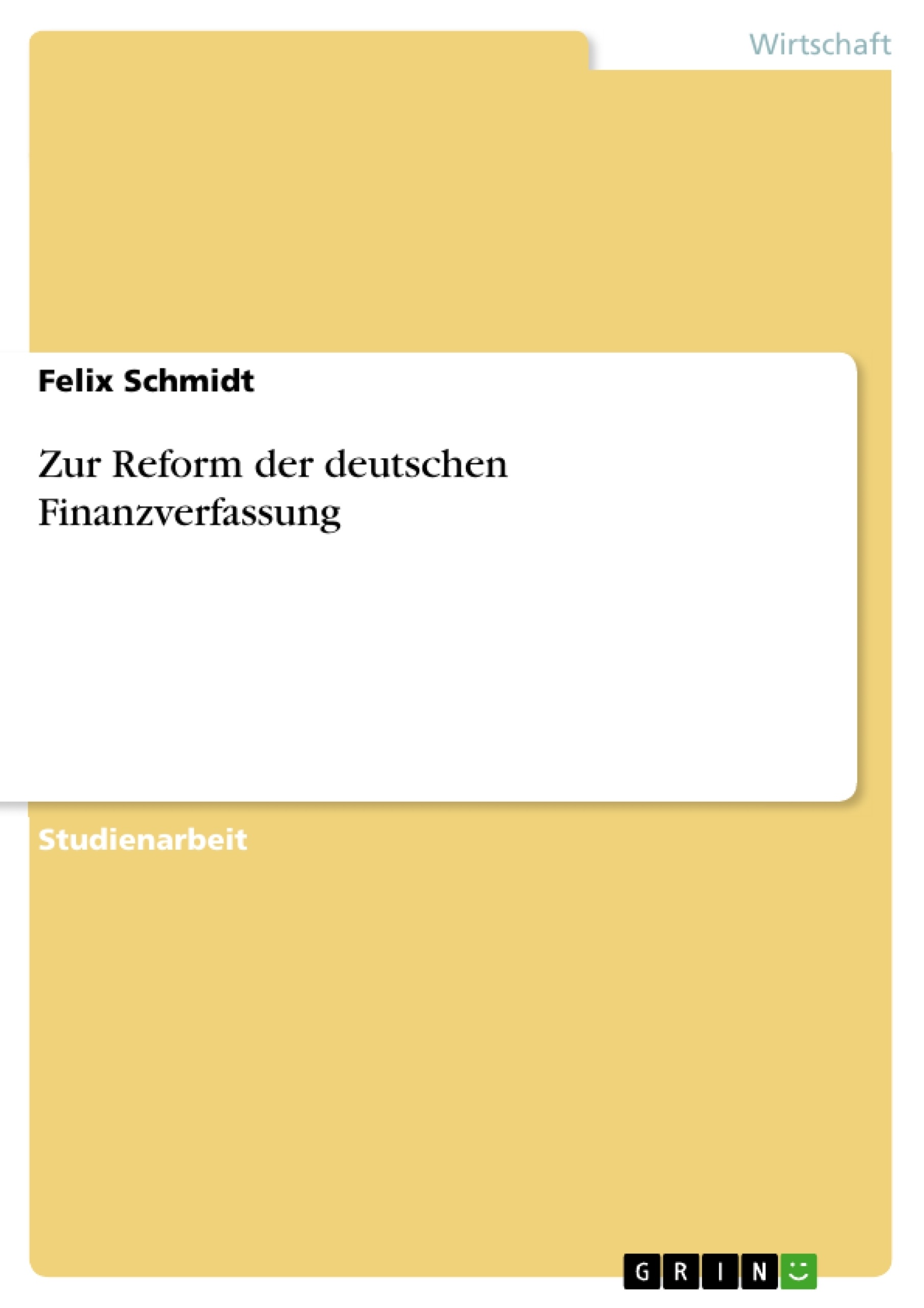Am 10. Dezember 2009 beherrschte eine Nachricht die deutschen Schlagzeilen: „Bund macht 100 Milliarden € neue Schulden“. Laut einer Tischvorlage des Finanzplanungsrates müssen für den Bundeshaushalt 2010 Kredite in Höhe von 86 Milliarden € für den Kernhaushalt und zudem 14,5 Milliarden € für Nebenhaushalte aufgenommen werden. Dies würde zu mehr als einer Verdoppelung des Schuldenrekordes von 40 Milliarden € im Jahr 1996 führen. Das Staatsdefizit würde somit eine Höhe von 6% erreichen (vgl. FAZ 2009).
Der gesamtstaatliche Schuldenbetrag ist in den letzten Jahrzehnten auf über 1,5 Billionen € angestiegen. Etwa 15% der Gesamtausgaben des Bundes, also fast 42 Milliarden €, werden benötigt, um die jährlichen Zinszahlungen abzudecken.
[.....]
Es besteht somit die Notwendigkeit, diesem Trend der zunehmenden Verschuldung sowohl absolut als auch relativ zum BIP entgegenzuwirken. Doch wie soll die deutsche Finanzverfassung reformiert werden, um langfristig einen ausgeglichenen Bundeshaushalt gewährleisten zu können?
Um diese Frage beantworten zu können, betrachte ich zunächst die aktuelle Lage der Gesetzgebung. Mit der in diesem Jahr verabschiedeten „Schuldenbremse“, die 2011 in Kraft treten soll, gibt es bereits ein erstes Bemühen um eine verstärkte Haushaltskonsolidierung. Entstanden ist diese Neuerung durch die im März 2007 ins Leben gerufene Föderalismuskommission II. Ihre Ideen und Überlegungen und die daraus resultierende Gesetzesänderungen möchte ich kurz vorstellen, um die aktuelle Lage bewerten zu können.
Danach gehe ich auf die Reformvorschläge von Lars Feld und Thushyanthan Baskaran ein. Ihr Hauptkritikpunkt an der deutschen Finanzverfassung liegt in der fehlenden Steuerautonomie. Anhand des Beispiels der Schweiz zeigen sie, welche positiven Effekte von einer größeren Eigenverantwortung der Kantone ausgehen. Die „Schuldenbremse“ wird größtenteils positiv bewertet. Lediglich einige kleinere Verbesserungsvorschläge werden hier angebracht.
Des Weiteren stelle ich als einen Gegenentwurf die Reformansätze von Peter Bofinger vor. Für ihn stellt die Schuldenbremse eine unnötige Einschränkung der fiskalischen Möglichkeiten dar. Sein Konzept präferiert einen Schuldenabbau durch höhere Steuereinnahmen.
Zum Schluss stelle ich die verschiedenen Ansätze gegenüber, versuche, die Gemeinsamkeiten und Gegensätze herausarbeiten, um die Möglichkeiten weiterer Reformen in diesem Bereich abschließend bewerten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die aktuelle Finanzverfassung
- 3. Die Reformansätze von Lars P. Feld und Thushyanthan Baskaran
- 3.1 Gründe der Staatsverschuldung
- 3.2 Die Effekte größerer Steuerautonomie am Beispiel der Schweiz
- 3.3 Bewertung der Schuldenbremse
- 3.4 Zusammenfassung der Reformvorschläge
- 4. Reformansätze von Peter Bofinger
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die aktuelle Finanzverfassung Deutschlands und untersucht Reformansätze zur Behebung der zunehmenden Staatsverschuldung. Ziel ist es, verschiedene Modelle der Finanzverfassung zu vergleichen und deren Implikationen für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands zu beleuchten.
- Zunehmende Staatsverschuldung in Deutschland
- Reformansätze zur Behebung der Staatsverschuldung
- Bewertung der Schuldenbremse
- Steuerautonomie der Bundesländer
- Fiskalische Handlungsspielräume
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Staatsverschuldung in Deutschland ein und erläutert die aktuelle Situation, die von einem massiven Schuldenanstieg geprägt ist. Kapitel zwei analysiert die bestehende Finanzverfassung und beleuchtet die Ursachen der Verschuldung, die im Rahmen der Föderalismusreform II identifiziert wurden.
Kapitel drei konzentriert sich auf die Reformvorschläge von Lars P. Feld und Thushyanthan Baskaran. Die Autoren kritisieren die fehlende Steuerautonomie der Bundesländer und argumentieren für größere Eigenverantwortung der Kantone. Die „Schuldenbremse“ wird größtenteils positiv bewertet, jedoch werden einige kleinere Verbesserungsvorschläge angebracht.
Kapitel vier stellt den Gegenentwurf von Peter Bofinger vor, der die „Schuldenbremse“ als unnötige Einschränkung der fiskalischen Möglichkeiten betrachtet. Sein Konzept fokussiert auf einen Schuldenabbau durch höhere Steuereinnahmen.
Das letzte Kapitel, Kapitel fünf, vergleicht die verschiedenen Ansätze und bewertet die Möglichkeiten weiterer Reformen im Bereich der Finanzverfassung.
Schlüsselwörter
Staatsverschuldung, Finanzverfassung, Reformansätze, Schuldenbremse, Steuerautonomie, Föderalismus, Fiskalpolitik, Wirtschaftswachstum, Handlungsspielräume, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die deutsche Schuldenbremse?
Die Schuldenbremse ist eine verfassungsrechtliche Regelung, die die Neuverschuldung von Bund und Ländern strikt begrenzt, um die Haushaltsstabilität zu sichern.
Warum fordern Ökonomen wie Lars Feld mehr Steuerautonomie für Bundesländer?
Nach dem Vorbild der Schweiz soll Eigenverantwortung bei Steuern den Wettbewerb fördern und Anreize für eine sparsamere Haushaltsführung schaffen.
Welche Kritik übt Peter Bofinger an der Schuldenbremse?
Bofinger sieht darin eine unnötige Einschränkung staatlicher Investitionsmöglichkeiten und plädiert stattdessen für Einnahmensteigerungen durch Steuern.
Was war die Aufgabe der Föderalismuskommission II?
Sie wurde ins Leben gerufen, um die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu zu ordnen und die Staatsverschuldung zu begrenzen.
Wie hoch ist die Staatsverschuldung in Deutschland?
Die Arbeit thematisiert den Anstieg der Schulden auf über 1,5 Billionen Euro und die damit verbundenen hohen Zinslasten für den Haushalt.
- Citar trabajo
- Felix Schmidt (Autor), 2009, Zur Reform der deutschen Finanzverfassung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153244