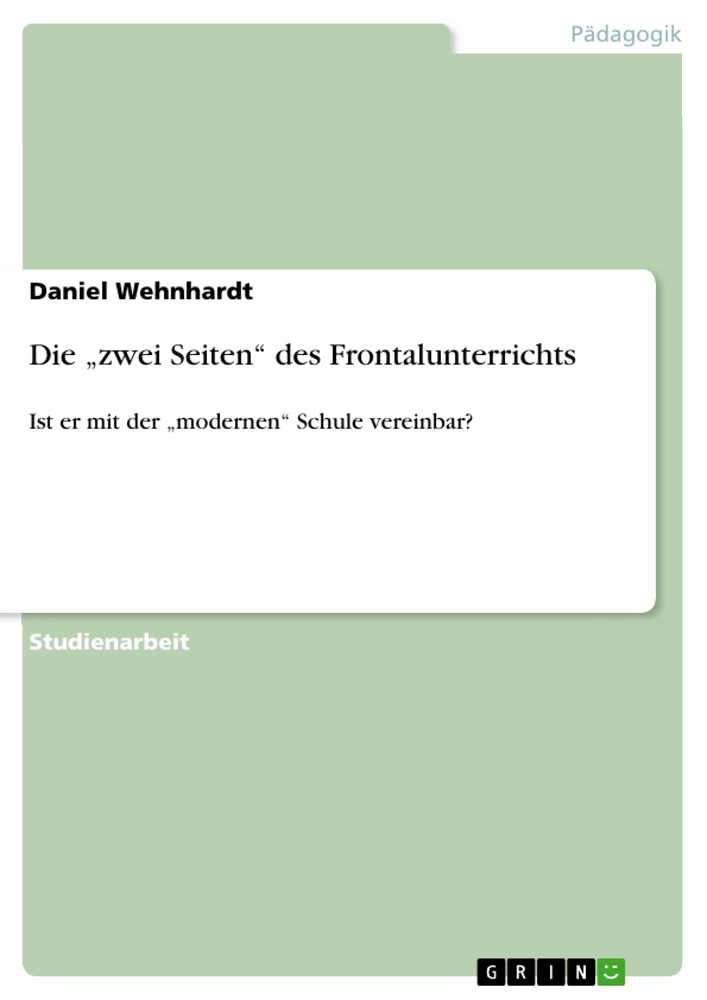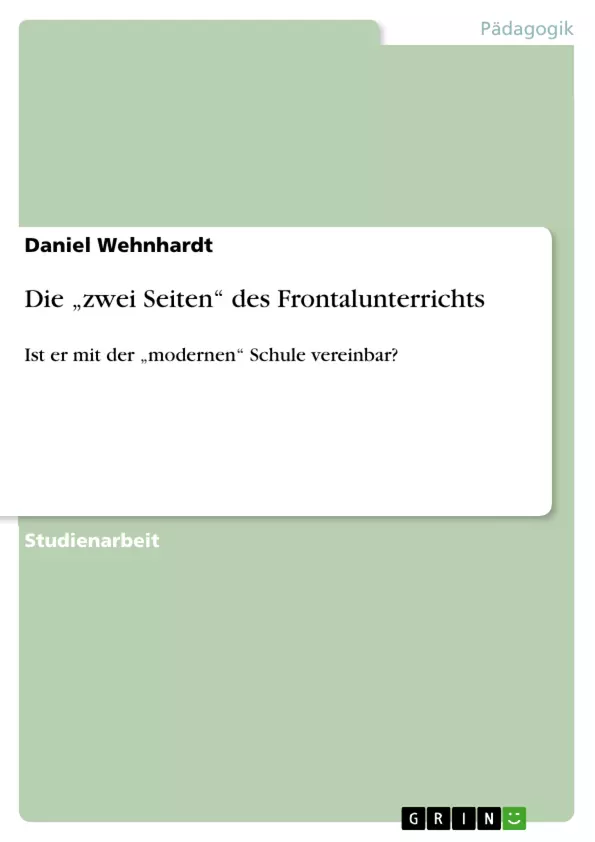Der Begriff des Frontalunterrichts scheint – sowohl unter Schülern, als auch unter vielen Studenten und nicht zuletzt unter einigen Lehrern – stets in einem negativen Licht zu stehen.
Was „schlechte“ Erfahrungen mit lehrerzentriertem, nur minimal individualistisch ausgerichtetem oder gar autoritärem Unterricht angeht, so kann ich mich selbst davon nicht frei sprechen, auch wenn es trotzdem gleichzeitig positive Erlebnisse gab. Es trieb mich nun somit auch ein großes Eigeninteresse dazu an, mich mit der Thematik und der Diskussion rund um den Frontalunterricht zu beschäftigen.
Diese Arbeit soll zunächst den relativ unklaren Begriff des Frontalunterrichts als eine Sozialform enger definieren und zugleich seine historischen Ursprünge und Wurzeln aufzeigen, da vor diesem Hintergrund seine Einführung, Umsetzung und vor allem seine angestrebten Ziele besser zu verstehen sind. Des Weiteren werden im Folgenden die Gründe aufgezeigt, die den Frontalunterricht insbesondere seit dem Ende des 20. Jahrhunderts so massiv in die Kritik und in die pädagogische Diskussion geraten ließen. Sowohl Vor- als auch Nachteile werden beleuchtet, sodass von der zentralen Fragestellung dieser Arbeit ausgehend,
ob der Frontalunterricht mit den Inhalten der „Schule der Zukunft“ vereinbar ist, ein möglicher Lösungsansatz in der Integration von „offenen“ und „geschlossenen“ Unterrichtsmethoden zu finden versucht wird. Als wichtige Autoren stellen sich in dieser Thematik die Professoren Dr. Herbert Gudjons und Dr. Johannes Bastian heraus, die – nicht nur in beidseitiger Zusammenarbeit, sondern auch für sich allein – einen Großteil der
frontalunterrichtlichen Literatur stellen und beeinflussen, wobei diese Arbeit dem stetigen Versuch unterliegt, Argumentationen, Definitionen und Aussagen aus vielen Perspektiven unter der Bezugnahme jeglicher Quellenbereiche zu beleuchten und zu überprüfen, um somit eine größtmögliche Wissenschaftlichkeit, Überprüfbarkeit und Objektivität zu gewährleisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und geschichtliche Entwicklung
- Definition
- Geschichtliche Entwicklung
- Der Frontalunterricht in der Kritik
- Die Kritikpunkte
- Die Vorteile
- Integration in offenere Konzepte?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Frontalunterricht, eine gängige Sozialform im Unterricht, in Bezug auf seine Definition, historische Entwicklung und seine Eignung für eine „moderne“ Schule. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Kritikpunkte als auch die Vorteile des Frontalunterrichts und untersucht, ob er sich in offenere Unterrichtskonzepte integrieren lässt.
- Definition und geschichtliche Entwicklung des Frontalunterrichts
- Kritikpunkte am Frontalunterricht
- Vorteile des Frontalunterrichts
- Integration des Frontalunterrichts in offenere Unterrichtskonzepte
- Relevanz des Frontalunterrichts in der „Schule der Zukunft“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Frontalunterrichts ein und erläutert die Relevanz der Diskussion um diese Sozialform im Kontext der „Schule der Zukunft“. Sie beschreibt die Motivation des Autors, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und skizziert die Ziele der Arbeit.
2. Definition und geschichtliche Entwicklung
2.1 Definition
Dieses Kapitel definiert den Frontalunterricht als eine thematisch orientierte Sozialform, in der die Lehrkraft die Kontrolle über Arbeits-, Interaktions- und Kommunikationsprozesse behält. Es werden die angestrebten Ziele des Frontalunterrichts, wie effektives und stoffzentriertes Lernen, sowie die Unterscheidung zwischen „traditionellem“ und „integriertem“ Frontalunterricht erläutert.
2.2 Geschichtliche Entwicklung
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des „modernen“ Frontalunterrichts, wobei die Beiträge von Georg Philipp Harsdörffer, Johann Amos Comenius und Johann Friedrich Herbart hervorgehoben werden. Es wird die Entwicklung des Frontalunterrichts von der Idee über die Umsetzung bis hin zur aktuellen Interpretation dargestellt und der Einfluss des Absolutismus und der allgemeinen Schulpflicht auf die Entwicklung des Frontalunterrichts erklärt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen dieser Arbeit sind Frontalunterricht, Sozialformen, Unterrichtsgestaltung, Lehrerkompetenzen, Lehrerhandeln, Kritikpunkte, Vorteile, Integration, „Schule der Zukunft“, „offene“ und „geschlossene“ Unterrichtsmethoden, traditioneller Frontalunterricht, integrierter Frontalunterricht, methodische Monokultur, Selbstständigkeit, assoziationspsychologische Lerntheorien.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Frontalunterricht definiert?
Frontalunterricht ist eine Sozialform, bei der die Lehrkraft die Steuerung der Arbeits-, Interaktions- und Kommunikationsprozesse für die ganze Klasse übernimmt.
Was sind die Hauptkritikpunkte am Frontalunterricht?
Kritisiert werden mangelnde Individualisierung, die Passivität der Schüler, die Förderung von „Pauker-Strukturen“ und eine methodische Monokultur.
Welche Vorteile bietet der Frontalunterricht?
Er ermöglicht eine effektive Stoffvermittlung in kurzer Zeit, bietet Struktur und Orientierung und ist ökonomisch bei großen Lerngruppen.
Wer waren die historischen Wegbereiter dieser Methode?
Wichtige Einflüsse kamen von Johann Amos Comenius (Didactica Magna) und Johann Friedrich Herbart, dessen Formalstufentheorie den Unterricht prägte.
Ist Frontalunterricht mit der „Schule der Zukunft“ vereinbar?
Die Arbeit schlägt vor, Frontalunterricht nicht abzuschaffen, sondern ihn in offenere Konzepte zu integrieren („integrierter Frontalunterricht“), um die Vorteile beider Ansätze zu nutzen.
- Quote paper
- Daniel Wehnhardt (Author), 2008, Die „zwei Seiten“ des Frontalunterrichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153249