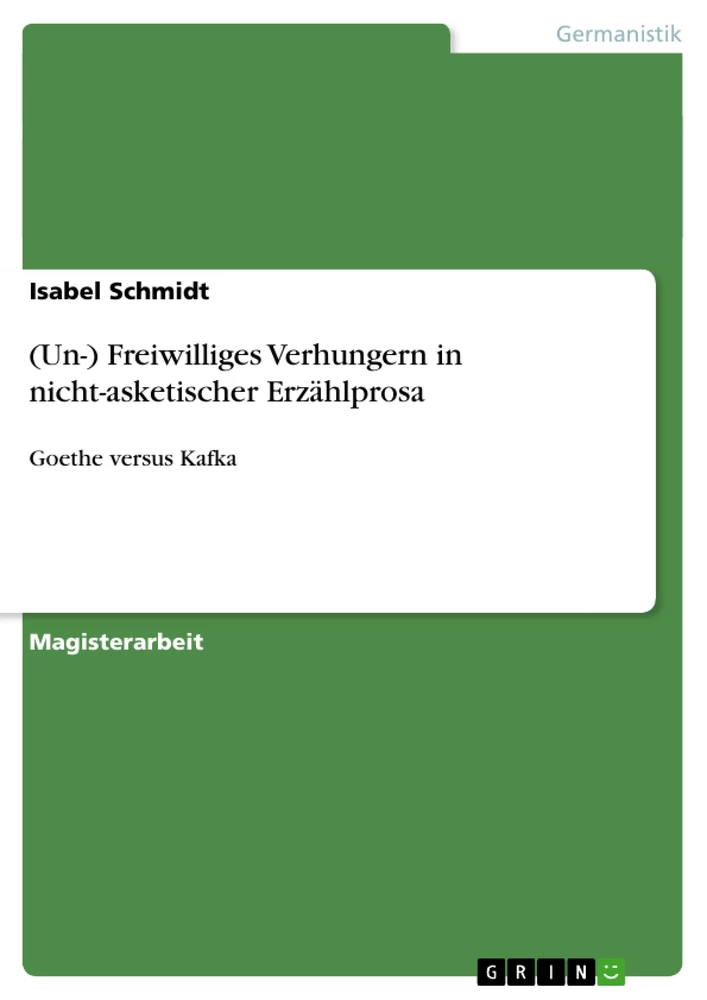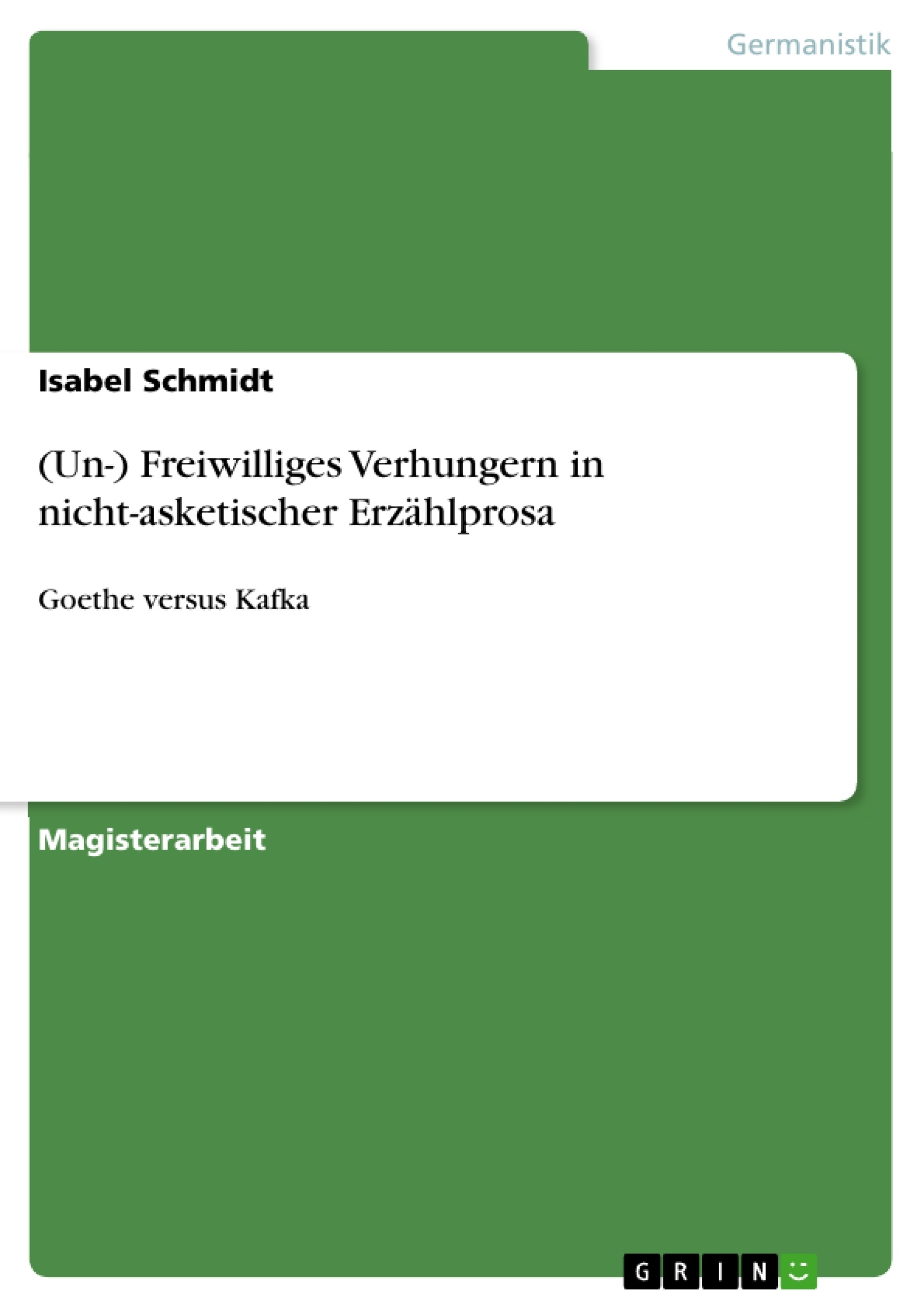„Goethes Frauenfiguren machen einen erschöpften Eindruck.“ Wer diese Diagnose liest, wird möglicherweise verwundert sein, dass sich eine erneute Beschäftigung mit eben einer dieser Protagonistinnen der Wahlverwandtschaften (1809), namentlich Ottilie, dennoch lohnt. Das Vorhandensein einer beinahe unüberschaubaren Fülle an Forschungsliteratur über Goethes weibliche Figuren, ihre oftmals nur sekundäre werkimmanente Bedeutung, sowie ihre vielfach leidende, sprunghafte Attitüde scheinen sie auf den ersten Blick zu keinem allzu dankbaren germanistischen Untersuchungsgegenstand zu erheben, da das Interesse eigentlich auf den männlichen Personen läge. Dies lässt sich auch anhand einiger Beispiele aus dem Schaffen von Goethe durchaus belegen...
...umso sprechender wird die Sprachlosigkeit Ottilies, wenn sie mit dem kontrastiv offensiven Verhalten des Hungerkünstlers (1922) von Franz Kafka in Relation gestellt wird. Denn auch Kafka lässt seinen Protagonisten ganz bewusst aus freien Stücken hungern, um ihn von der Masse der anderen Menschen abzuheben. Und genau wie Ottilie von der Männerwelt (im Besonderen von Eduard) bewundert wird, so verzichtet der Hungerkünstler vordergründig deshalb auf Nahrung, um ebenfalls Aufsehen zu erregen. Diesbezüglich soll die These aufgestellt und bewiesen werden, dass das Hungern von literarischen Figuren stets eine bestimmte Funktion erfüllt, die weitaus mehr kommuniziert – sowohl an den Leser, als auch an die literarische Umwelt der Figuren – als das Sprechen an sich. So ist die Verweigerung von Nahrung ein zentrales Thema der Literatur. Es ist ein Thema, welches selbst noch in modernster Zeit – beispielweise in Form des Eremitendaseins des Protagonisten aus Süskinds Roman Das Parfum (1985) – überprüft werden kann und selbst Autoren und Werke verbindet, die aufgrund unterschiedlicher Epochen grundsätzlich weniger miteinander verglichen werden. In der vorliegenden Arbeit sollen daher zentrale Texte von Goethe und Kafka in Relation gesetzt werden, wobei davon ausgegangen wird, dass sich klare gemeinsame Figurenintentionen für das freiwillige und eben nicht asketische Verzichten auf Nahrung aufzeigen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung der Thesen und Texte
- Methodische Vorgehensweise
- Der historische Kontext der Nahrungsverweigerung
- Literarische Einordnung des Hungerns
- Goethes Wahlverwandtschaften
- Exkurs - Die ,,schöne Seele"
- Goethes Wahlverwandtschaften – Textinterpretation
- Analyse der Funktion von Sprache in den Wahlverwandtschaften
- Kafkas Hungerkünstler
- Kafkas Hungerkünstler - Textinterpretation
- Analyse und Funktion der Sprache im Hungerkünstler
- Generationendiskurs
- Das Hungern in der Gegenwart
- Vergleich und Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Funktion des (un)freiwilligen Hungerns in literarischen Texten von Goethe und Kafka. Im Mittelpunkt steht die These, dass die Nahrungsverweigerung von literarischen Figuren eine vielschichtige Bedeutung besitzt und weit mehr kommuniziert als die bloße Abwesenheit von Nahrung. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Beweggründe und Funktionen des Hungerns, die sowohl auf der individuellen Ebene der Figuren, als auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene der jeweiligen Epochen betrachtet werden.
- Die Rolle des Hungerns als Mittel der nonverbalen Kommunikation
- Die Funktion des Hungerns als Ausdruck von Individualität und Rebellion
- Der Vergleich der Hungermotive in Goethes „Wahlverwandtschaften“ und Kafkas „Hungerkünstler“
- Die Analyse der literarischen Darstellung von Nahrungsverweigerung im Kontext des Generationsdiskurses
- Die Bedeutung des Hungerns als Symbol für den Umgang mit gesellschaftlichen Normen und Erwartungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor und führt die beiden untersuchten Texte, Goethes „Wahlverwandtschaften“ und Kafkas „Hungerkünstler“, ein. Sie skizziert die methodische Vorgehensweise und beleuchtet die historische und literarische Einordnung des Hungerns. In den folgenden Kapiteln wird die Nahrungsverweigerung von Ottilie in den „Wahlverwandtschaften“ und des Hungerkünstlers in Kafkas gleichnamiger Novelle analysiert. Dabei werden die jeweiligen Motive, Funktionen und Bedeutungen des Hungerns im Kontext der Figuren und ihrer literarischen Umgebungen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Analyse der Sprache, dem Ausdrucksvermögen des nonverbalen Verhaltens und der Bedeutung des Hungerns im Verhältnis zu den Figuren und ihren jeweiligen Gesellschaftsformen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Nahrungsverweigerung, Hunger, Nonverbale Kommunikation, Textanalyse, Literarische Figuren, Goethe, Kafka, „Wahlverwandtschaften“, „Hungerkünstler“, Generationendiskurs, Gesellschaftliche Normen.
Häufig gestellte Fragen
Welche literarischen Texte werden zum Thema Hunger verglichen?
Die Arbeit vergleicht Goethes "Die Wahlverwandtschaften" (Figur Ottilie) mit Franz Kafkas "Ein Hungerkünstler".
Was ist die zentrale These bezüglich der Nahrungsverweigerung?
Das Hungern literarischer Figuren erfüllt stets eine bestimmte Funktion und kommuniziert oft mehr an die Umwelt als das Sprechen an sich (nonverbale Kommunikation).
Warum hungert Ottilie in Goethes "Wahlverwandtschaften"?
Ottilies Hungern wird als Ausdruck ihrer inneren Not, ihrer Sprachlosigkeit und als (un)freiwilliger Rückzug aus einer Welt gedeutet, in der sie keinen Platz mehr findet.
Was motiviert Kafkas "Hungerkünstler"?
Der Hungerkünstler hungert aus freien Stücken, um sich von der Masse abzuheben, Aufmerksamkeit zu erregen und seine Kunst zur Perfektion zu treiben.
Was versteht man unter dem Begriff der "schönen Seele" bei Goethe?
Die Arbeit macht einen Exkurs zur "schönen Seele", einem Idealbild der Zeit, das in Ottilies Leidensgeschichte und ihrer ästhetischen Nahrungsverweigerung reflektiert wird.
Wird auch moderne Literatur in die Analyse einbezogen?
Ja, die Arbeit nennt als modernes Beispiel das Eremitendasein des Protagonisten in Patrick Süskinds Roman "Das Parfum".
- Citation du texte
- Isabel Schmidt (Auteur), 2009, (Un-) Freiwilliges Verhungern in nicht-asketischer Erzählprosa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153370