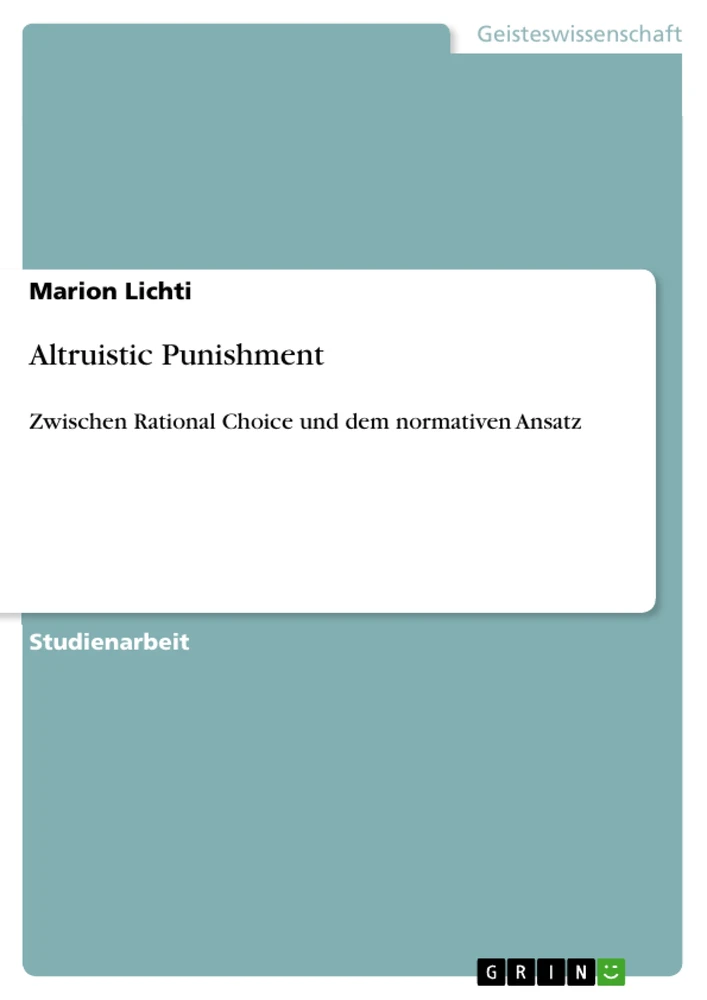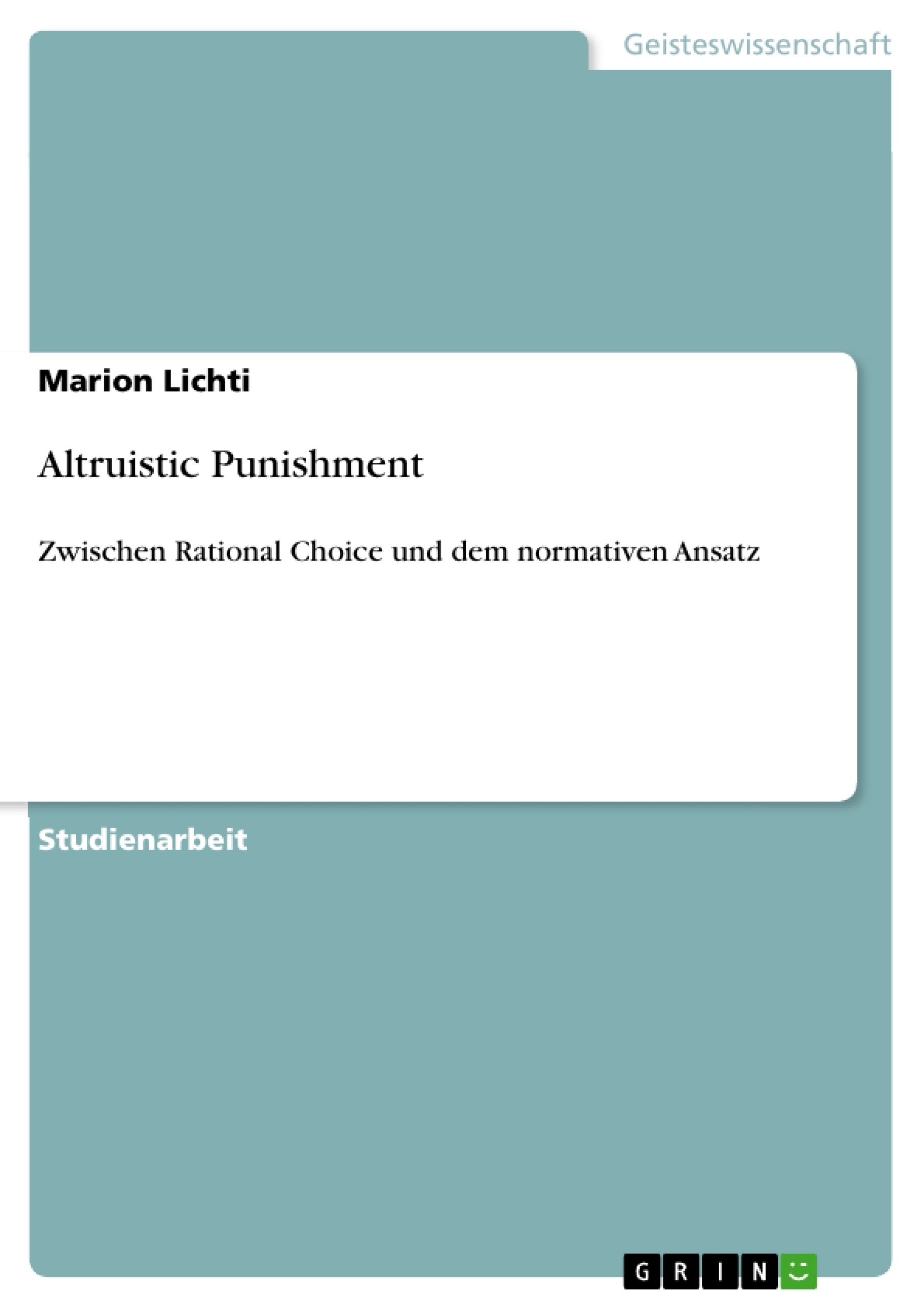In der Abschlusskonferenz der zweiten Weltmenschenrechtskonvention im Juni 1993 in Wien bekannten sich die versammelten 171 Staaten einmütig zu ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen. Dies ist in den meisten Fällen leider ein Lippenbekenntnis geblieben.
Wieso? Weil man einen potenten Weltgerichtshof benötigt, der die Staaten gegebenenfalls zu ihrem „Glück“ zwingen kann? Die Etablierung eines derart machtvollen Apparates halte ich für utopisch um nicht zu sagen gefährlich.
Meines Erachtens könnte er sich aber als unnötig erweisen, da die Staaten selbst sich – unter bestimmten Voraussetzungen – zur Durchsetzung der von ihnen ratifizierten Menschenrechte anspornen können. Es handelt sich dabei um ein Grundproblem, das in der soziologischen Theorie schon vielfach behandelt wurde: Das Problem öffentlicher Güter erster Ordnung. Es bedeutet, dass alle davon profitieren, wenn alle sich für ein überindividuelles Gut engagieren. Das Problem ist: Derjenige profitiert am meisten, der sich nicht für das gemeinschaftliche Gut engagiert, obgleich alle anderen es tun. Wie ist dieses Problem zu lösen?
Verschiedene Soziologen haben verschiedene Wege betreten um dieser Frage nachzugehen. Exemplarisch werden für diese Arbeit die Ansätze von Robert Axelrod, Thomas C. Schelling und Jon Elster und ein von Ernst Fehr und Simon Gächter beschriebenes und durchgeführtes Experiment herangezogen und diskutiert.
Die vorliegende Arbeit soll anhand soziologischer Überlegungen nachzuvollziehen versuchen, weshalb es an der Umsetzung der Menschenrechte, zu der sich immerhin 89% der heute von der UN vollständig anerkannten souveränen Staaten bekannt hapert, ob es für ihre Umsetzung wirklich einer übergeordneten Zentralmacht bedarf, oder ob es nicht auch einen anderen Weg geben könnte, wie sie ihre „Güte“ nicht nur bekennen, sondern auch realisieren könnten. Dafür wird das Verhältnis von strategischem und normengeleitetem Handeln individueller Akteure anhand verschiedener Ansätze diskutiert und schließlich das Ergebnis auf die Ausgangsfrage übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1. Das Problem öffentlicher Güter nach Hartmut Esser...
- I.2....und nach Thomas Hobbes
- II. Konflikt oder Kooperation - die Spieltheorie
- II.1. Robert Axelrod und der Schatten der Zukunft
- Exkurs: Das Gefangenendilemma....
- II.1.1. Das Tournier......
- II.1.2 TIT FOR TAT
- II.1.3. Kritik an Axelrods Modell...
- II.2 Kooperation durch Kultur - Schellings Fokalpunkte.
- III. Der normative Ansatz
- III.1 Jon Elster und die Autonomie einer Norm......
- III.2 Normen versus Rationalität..
- III.3. Normen und Eigeninteresse
- IV. Das Verhältnis von Normen und Eigeninteresse.
- IV.1. Altruistisches Bestrafen.
- IV.1.1. Das Experiment..
- IV.1.2 Das Ergebnis.....
- V. Fazit.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Problem der Durchsetzung von Menschenrechten im Kontext der internationalen Beziehungen und beleuchtet die Frage, ob eine übergeordnete Macht erforderlich ist, um die Einhaltung dieser Rechte zu gewährleisten. Dabei werden verschiedene soziologische Ansätze herangezogen, die sich mit der Kooperation unter schwierigen Bedingungen befassen.
- Das Problem öffentlicher Güter und die Schwierigkeiten der Kooperation in einer von Egoismus geprägten Welt.
- Die Rolle der Spieltheorie in der Analyse von strategischem Verhalten und der Frage, wie Kooperation in Abwesenheit eines übergeordneten Leviathan erreicht werden kann.
- Der Einfluss von Normen auf menschliches Handeln und die Frage, wie sie zur Überwindung von egoistischen Interessen beitragen können.
- Die Analyse des Phänomens "altruistisches Bestrafen" als möglicher Mechanismus zur Durchsetzung von Normen.
- Die Beziehung zwischen rationalem Eigeninteresse und normgeleitetem Handeln.
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Arbeit stellt das Problem der Durchsetzung von Menschenrechten in den Vordergrund und führt in die soziologische Diskussion um das Problem öffentlicher Güter ein. Es werden die Ansätze von Hartmut Esser und Thomas Hobbes zur Erklärung des menschlichen Verhaltens im Naturzustand vorgestellt.
- II. Konflikt oder Kooperation - die Spieltheorie: Dieses Kapitel präsentiert die Spieltheorie als Werkzeug zur Analyse von strategischem Verhalten und fokussiert auf die Arbeiten von Robert Axelrod, insbesondere das Gefangenendilemma. Die Diskussion beleuchtet die Bedingungen, unter denen Kooperation möglich ist, und die Rolle der "Schatten der Zukunft".
- III. Der normative Ansatz: Hier werden die Einflüsse von Normen auf menschliches Handeln untersucht. Der Fokus liegt auf den Ideen von Jon Elster, der die Autonomie von Normen und ihre Bedeutung für die Überwindung von egoistischen Interessen betont.
- IV. Das Verhältnis von Normen und Eigeninteresse: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie Normen und Eigeninteresse miteinander interagieren. Es stellt das Phänomen des "altruistischen Bestrafens" vor und diskutiert seine Relevanz für die Durchsetzung von Normen.
Schlüsselwörter
Öffentliche Güter, Spieltheorie, Gefangenendilemma, Kooperation, Normen, Eigeninteresse, Altruistisches Bestrafen, Menschenrechte, Leviathan, Rational Choice, normativer Ansatz, soziale Ordnung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Problem öffentlicher Güter in Bezug auf Menschenrechte?
Alle Staaten profitieren von globalen Menschenrechten, aber der einzelne Staat profitiert am meisten, wenn er sich selbst nicht engagiert, während andere es tun (Trittbrettfahrer-Problem).
Was versteht man unter „altruistischem Bestrafen“?
Es beschreibt das Phänomen, dass Akteure bereit sind, Kosten auf sich zu nehmen, um Normverletzer zu bestrafen, auch wenn sie daraus keinen direkten persönlichen Vorteil ziehen.
Welche Rolle spielt die Spieltheorie in dieser Arbeit?
Sie dient zur Analyse von strategischem Verhalten (z. B. Gefangenendilemma) und der Frage, wie Kooperation ohne eine zentrale Weltmacht entstehen kann.
Was bedeutet „TIT FOR TAT“?
Es ist eine Strategie aus der Spieltheorie (Robert Axelrod), bei der ein Akteur kooperiert und dann immer die vorherige Aktion des Gegenübers spiegelt.
Bedarf es einer Weltregierung für die Durchsetzung von Menschenrechten?
Die Arbeit untersucht, ob soziale Normen und dezentrale Bestrafungsmechanismen ausreichen könnten, um Staaten zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen zu bewegen.
- Citar trabajo
- Marion Lichti (Autor), 2008, Altruistic Punishment, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153391