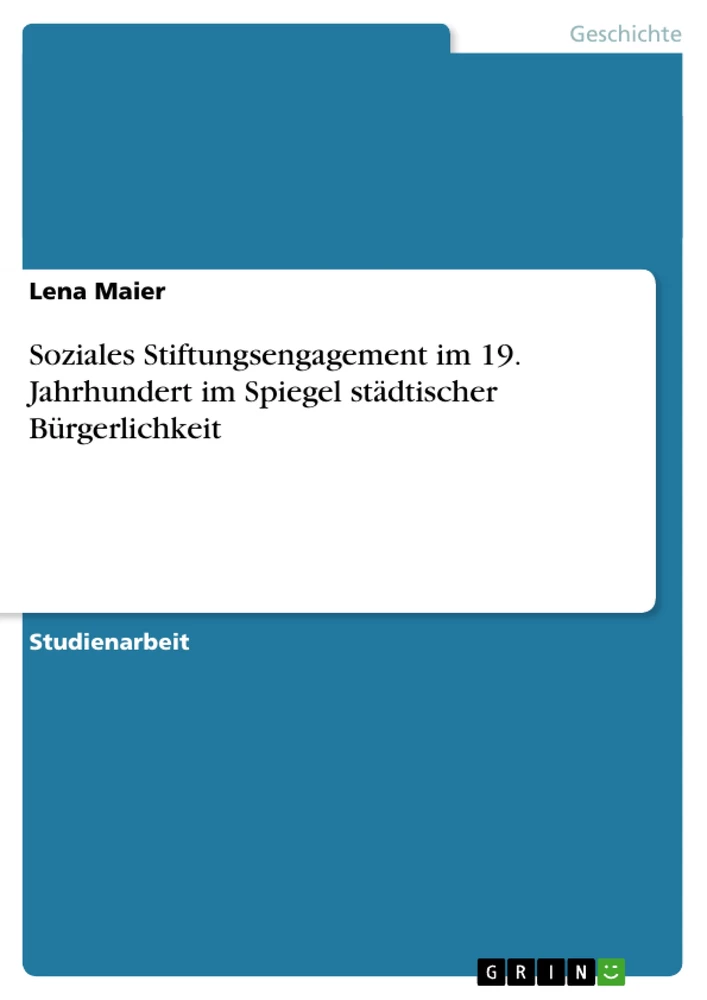In der Geschichtswissenschaft kommt seit einigen Jahren der Trend auf, sich mit Stiftungen zu befassen. Borgolte konstatiert, dass „neuerdings in der Geschichtswissenschaft erkannt worden [ist], dass Stiftungen einen hervorragenden Indikator abgeben für das soziale Gefüge ihrer Entstehungszeit. Sie beruhen auf rechtlichen Regelungen und wirtschaftlichen Substraten, verknüpfen religiöse und ethische Anliegen mit dem Streben nach Anerkennung und Ruhm, sollen ihr Umfeld verändern“. Dementsprechend gelten Stiftungen und private Wohltätigkeit nicht nur als „ein Mittel, der Armut entge-genzutreten, sondern ihre Analyse ist auch ein Schlüssel zu den kollektiven Mentalitäten“.
Aufbauend auf dem Seminar „Städtische Stiftungen und Bürgertum vom 18. bis zum 20. Jahrhundert“ widmet sich die vorliegende Arbeit vorwiegend den karitativen Stiftungen des „langen 19. Jahrhunderts“, auch bekannt als „bürgerli-ches Zeitalter“. Dieses Jahrzehnt bietet sich im Besonderen an, da erstmals auch konfessionsunabhängige Stiftungen aufkamen und sich daher ein breites Feld an Motivationsaspekten auftat. Diesen geht die Arbeit im abschließenden Kapitel nach. Grundlegend orientieren sich die Fragestellungen daran, aus welchen Faktoren die Stiftungen entstanden, wer an ihnen maßgeblich partizipierte und welches Ausmaß sie hatten. Die Untersuchung baut auf einem Querschnitt der Stiftungsgeschichte über die vorangehenden Epochen auf. Einleitend soll eine Übersicht über die Begrifflichkeit und die aktuelle Forschungssituation einen einsteigenden Einblick in die Problematik liefern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitend
- Forschungssituation
- Zivilgesellschaft
- Komplex der Stiftung
- Begriffdefinition
- Charakteristika
- Stiftungen als soziales Handeln
- Das Bürgerliche und die Stadt
- Entwicklungsverlauf der Stiftungskultur
- Stiftungen über die Epochen
- Situation Heute
- Zäsuren/Konjunkturen
- Das 19. Jahrhundert
- Städtisch-bürgerliche Stifterschaft
- Integration der Stifter in soziale Netzwerke und Berufsgruppen
- Honoratiorenschaft
- Das Bürgertum
- Familiensache
- Typisierung und Eigenheit des Bürgertums
- Motivation
- Tradition
- Statusrepräsentation und Selbstinszenierung von Stiftern
- Elitenzirkulation im Stadtverband
- Verhaltensprägendes Vorbild
- Abschließend...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht karitative Stiftungen des „langen 19. Jahrhunderts“ und analysiert deren Entstehung, Stifter und Bedeutung im Kontext der städtischen Gesellschaft. Sie fokussiert sich auf die Zeit vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, ein Zeitraum, in dem ein breites Spektrum an Motivationsaspekten für Stiftungen aufkam. Die Arbeit untersucht, wie Stiftungen aus verschiedenen Faktoren entstanden sind, wer daran maßgeblich beteiligt war und welchen Einfluss sie hatten. Darüber hinaus beleuchtet sie die Rolle von Stiftungen im bürgerlichen Wertehorizont und den damit verbundenen zivilgesellschaftlichen Selbstverständnis.
- Stiftungen als Ausdruck zivilgesellschaftlichen Engagements im 19. Jahrhundert
- Motivationen der Stifter und ihre Rolle in der städtischen Gesellschaft
- Die Entwicklung der Stiftungskultur und ihre Konjunkturen
- Die Bedeutung von Stiftungen für das bürgerliche Selbstverständnis und die Stadtentwicklung
- Die Integration von Stiftern in soziale Netzwerke und Berufsgruppen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitend: Das Kapitel führt in die Thematik des bürgerlichen Stiftungswesens im 19. Jahrhundert ein und skizziert die Relevanz des Themas in der heutigen Gesellschaft sowie in der historischen Forschung.
- Forschungssituation: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Forschungslage zum Thema Stiftungen, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Es stellt wichtige Forschungsarbeiten vor und diskutiert die vorhandene Literatur.
- Komplex der Stiftung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und den Charakteristika von Stiftungen. Es beleuchtet die Rolle von Stiftungen als soziales Handeln und analysiert den Zusammenhang zwischen Stiftungen und dem bürgerlichen Selbstverständnis in der Stadt.
- Entwicklungsverlauf der Stiftungskultur: Dieser Abschnitt betrachtet die Geschichte der Stiftungskultur über die Epochen hinweg und beleuchtet insbesondere das 19. Jahrhundert. Es geht auf die wichtigsten Konjunkturen und Zäsuren im Stiftungswesen ein.
- Städtisch-bürgerliche Stifterschaft: Dieses Kapitel widmet sich der Frage, wie Stifter in soziale Netzwerke und Berufsgruppen integriert waren und welche Rolle die Honoratiorenschaft und das Bürgertum für die Stiftungskultur spielten.
- Motivation: Dieser Abschnitt untersucht die verschiedenen Motive der Stifter, darunter Tradition, Statusrepräsentation und Selbstinszenierung sowie Elitenzirkel und Verhaltensprägendes Vorbild.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Stiftungen, Bürgertum, Stadtentwicklung, Soziales Engagement, zivilgesellschaftliches Selbstverständnis, Honoratiorenschaft, Motivationen, Tradition, Statusrepräsentation, Elitenzirkel und Verhaltensprägendes Vorbild.
Häufig gestellte Fragen
Warum waren Stiftungen im 19. Jahrhundert so bedeutend?
Stiftungen dienten im "bürgerlichen Zeitalter" als Indikator für das soziale Gefüge und ermöglichten es dem Bürgertum, soziale Verantwortung zu übernehmen und das städtische Umfeld aktiv zu gestalten.
Was motivierte Bürger im 19. Jahrhundert zum Stiften?
Motive waren neben karitativen Aspekten auch Statusrepräsentation, Selbstinszenierung, die Sicherung von Anerkennung und Ruhm sowie das Streben nach Elitenzirkulation im Stadtverband.
Wer gehörte typischerweise zum Kreis der Stifter?
Maßgeblich beteiligt war die bürgerliche Honoratiorenschaft, wobei Stiften oft auch als "Familiensache" verstanden wurde, um den Status der eigenen Familie über Generationen zu festigen.
Welche Arten von Stiftungen kamen im 19. Jahrhundert neu auf?
Erstmals entstanden in größerem Umfang konfessionsunabhängige Stiftungen, was den Weg für ein breiteres Feld an weltlichen und ethischen Motivationsaspekten ebnete.
Welchen Einfluss hatten Stiftungen auf die Armut?
Karitative Stiftungen waren ein zentrales Mittel, um der Armut in den wachsenden Städten entgegenzutreten, lange bevor staatliche Sozialsysteme diese Aufgaben umfassend übernahmen.
- Citar trabajo
- Lena Maier (Autor), 2009, Soziales Stiftungsengagement im 19. Jahrhundert im Spiegel städtischer Bürgerlichkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153402