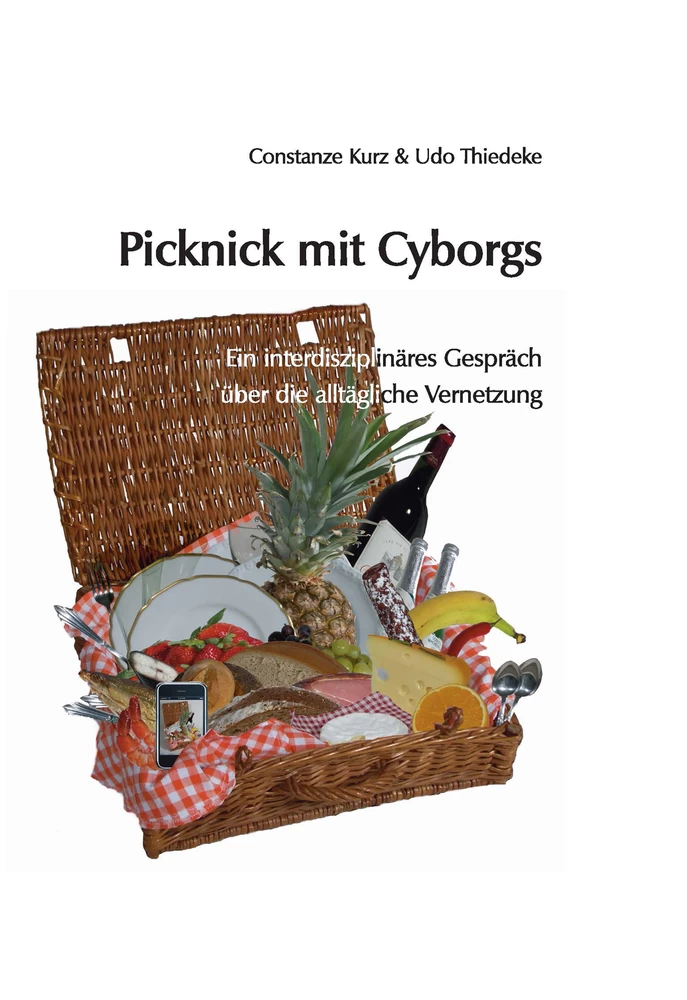Denjenigen, die den Alltag der Wissenschaft und ihrer Institutionen kennen, mag Interdisziplinarität als Reizwort und unscharfer Begriff gelten. In der Tat macht das Durchhalten einer interdisziplinären Perspektive erhebliche Mühe. Immer wieder werden die eigenen Positionen und die scheinbar fraglosen Gewissheiten der eigenen Disziplin verunsichert. Fortwährende Übersetzungsarbeit ist also erforderlich. Das gilt besonders, wenn wie hier, die Informatik und die Soziologie, aus der die Autorin und der Autor kommen, im Sinne von C.P. Snow zu zwei unterschiedlichen Wissenschaftskulturen gehören: Hier die mathematisch-naturwissenschaftliche, dort die empirisch-geisteswissenschaftliche.
Was uns dennoch das Wagnis der interdisziplinären Perspektive hat eingehen lassen, ist zum einen der Sachverhalt, dass die auf Computermedien basierende Vernetzung unserer Interaktionen und Kommunikation unseren gesamten Alltag durchdringt und so die Perspektiven der technischen Ermöglichung und der sozialen Vermöglichung zusammenzwingt, zum anderen das rege Interesse daran, welche Wissensformen die Phänomene der alltäglichen Vernetzung annehmen, wenn man sie aus dem Blickwinkel einer anderen Disziplin betrachtet und zu beschreiben versucht.
Deshalb ist beim "Picknick mit Cyborgs" ein Buch mit zwei Seiten entstanden. Auf der einen Seite kann man dem interdisziplinären Gespräch über Bedingungen und Konsequenzen alltäglicher Vernetzung folgen. Auf der anderen Seite korrespondiert dazu ein Text mit Hintergrundwissen und wissenschaftlichen Perspektiven, den man ebenso eigenständig lesen kann.
Dieses Experiment geht nicht ohne Irritationen und Missverstehen ab. Aber Miss-Verstehen ist im Sinne von Heinz von Foerster immer auch Verstehen und vielleicht in der derzeitigen Situation einer rasant voranschreitenden Virtualisierung gesellschaftlicher Wirklichkeit und des gesellschaftlichen Wissens ein Beobachtungsprinzip der Einheit des Uneinheitlichen. Genau davon handelt dieses Buch.
Die Autoren:
Constanze Kurz ist Informatikerin. Sie forscht und lehrt als wissenschaftliche Mitarbeiterein am Schwerpunkt "Informatik in Bildung und Gesellschaft" der Humboldt-Universität zu Berlin. Ehrenamtlich ist sie Sprecherin des Chaos Computer Clubs.
Udo Thiedeke ist Soziologe und Künstler. Er forscht und lehrt als Privatdozent mit Schwerpunkt "Soziologie der Medien" am Institut für Soziologie der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Inhaltsverzeichnis
- Was wir uns dabei gedacht haben
- Eine Gebrauchsanleitung
- Wie sich Medienvirtuosen kennenlernen
- Alte KanäleýNeue Kanäle
- Programmdirektoren und Integrierte
- Das Netz, das uns nicht vergisst
- Schufa und das BKA haben uns're Datenda
- Meine Daten sind mein Selbst
- Die maoistischen Ameisen
- Nicht nur Katzen haben sieben Leben
- Die Parasiten der Knappheit
- Einwanderer und Einwohner im Datenraum
- Mobil angeleint
- Im Flur am Telefon
- Leb' dein zweites Leben!
- Verfolgte Daten
- Von der überflüssigen Knappheit
- Artefakte, Technofakte, Soziofakte
- Die vollvernetzten 24üStundenüKommunizierer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch ist ein interdisziplinäres Gespräch über die alltägliche Vernetzung durch Computer, das sich durch theoretische, empirische und explorative Ergänzungen auszeichnet. Die Autoren untersuchen die Phänomene der alltäglichen Vernetzung aus den Blickwinkeln der Informatik und der Soziologie, um die technischen Möglichkeiten und die sozialen Auswirkungen dieser Entwicklung zu erforschen.
- Die Medialisierung von Kontakten und Beziehungen
- Die Transformation von Wissensformen durch die Vernetzung
- Die Rolle von Social Software und sozialen Netzwerken
- Die Bedeutung von Daten und Datenschutz
- Die Herausforderungen der Virtualisierung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Was wir uns dabei gedacht haben: Dieses Kapitel stellt die Intentionen und den wissenschaftlichen Ansatz des Buches vor. Es beschreibt den interdisziplinären Charakter des Gesprächs zwischen den beiden Autoren und die Bedeutung der Theorie und Praxis in ihrer Analyse.
- Wie sich Medienvirtuosen kennenlernen: Dieses Kapitel beleuchtet die Medialisierung von Kontakten und Beziehungen. Es untersucht die Rolle von Massenmedien, Individualmedien und Interaktionsmedien in der heutigen Gesellschaft. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Bedeutung der technischen Entwicklung für die Art und Weise, wie wir Menschen kennenlernen.
- Alte KanäleýNeue Kanäle: In diesem Kapitel geht es um den Wandel von Kommunikationskanälen in der digitalen Gesellschaft. Es wird deutlich, wie die Digitalisierung und die Verbreitung des Internets den Umgang mit Medien und die Kommunikation nachhaltig verändern. Der Vergleich zwischen alten und neuen Medien und die unterschiedliche Medienkompetenz der Generationen stehen im Mittelpunkt.
- Programmdirektoren und Integrierte: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung von Programmierung und Arrangement in der digitalen Welt. Die Autoren diskutieren, wie die Individualisierung der Mediennutzung durch den Computer und das Internet zu einer neuen Form des Programmierens führt und die Rolle des Users als Programmdirektor im Vordergrund steht.
- Das Netz, das uns nicht vergisst: Dieses Kapitel behandelt die Themen Social Software und soziale Netzwerke. Es werden die Funktionsweisen und Auswirkungen dieser neuen Formen der Kommunikation diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage des Datenschutzes und der Kontrolle der eigenen Daten im Internet gewidmet.
- Schufa und das BKA haben uns're Datenda: In diesem Kapitel wird die Problematik des Datensammelns und des Social Scorings beleuchtet. Die Autoren untersuchen die Funktionsweisen und die Folgen dieser Praktiken für die Gesellschaft und den Einzelnen. Sie analysieren die Rolle der Schufa und anderer Institutionen in diesem Kontext.
- Meine Daten sind mein Selbst: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie man sich im Internet vor Datenmissbrauch schützen kann. Die Autoren diskutieren verschiedene Möglichkeiten des Selbstdatenschutzes, wie z.B. Datenvermeidung und Pseudonymisierung, und analysieren die Wirksamkeit dieser Strategien.
- Die maoistischen Ameisen: In diesem Kapitel wird die Bedeutung von kollaborativen Projekten im Internet, wie z.B. Wikipedia, diskutiert. Die Autoren stellen die Frage, ob die Masse im Internet tatsächlich zu einer Nivellierung der Qualität führt oder ob neue Formen der Wissensgenerierung und -verbreitung möglich sind.
- Nicht nur Katzen haben sieben Leben: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den vielfältigen Möglichkeiten der Selbstgestaltung und der Pseudonymisierung im Internet. Es wird die Frage erörtert, ob das Recht auf Selbstgestaltung im Internet zu einem neuen Grundrecht werden kann.
- Die Parasiten der Knappheit: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Werbewirtschaft im Internet und die neuen Strategien des Marketings. Es werden die Möglichkeiten des viralen Marketings und die Herausforderungen, die sich durch die veränderten Kommunikationsbedingungen ergeben, analysiert.
- Einwanderer und Einwohner im Datenraum: Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Kompetenzen und Haltungen von „Digital Immigrants“ und „Digital Inhabitants“ im Internet. Es werden die Unterschiede im Umgang mit Medien und die Folgen für die gesellschaftliche Integration diskutiert.
- Mobil angeleint: In diesem Kapitel geht es um die zunehmende Mobilität und Vernetzung durch Smartphones und andere mobile Geräte. Es wird die Frage erörtert, wie diese Entwicklung die Gesellschaft und die Kommunikation prägt und welche Folgen sie für die Privatsphäre hat.
- Im Flur am Telefon: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung von Telefonie im öffentlichen Raum. Es wird die Frage erörtert, wie sich das mobile Kommunikationsverhalten auf die soziale Interaktion und die Wahrnehmung des öffentlichen Raums auswirkt.
- Leb' dein zweites Leben!: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob das Internet ein zweites Leben ermöglicht. Die Autoren untersuchen die unterschiedlichen Möglichkeiten der Virtualisierung, die sich durch Computerspiele, soziale Netzwerke und virtuelle Welten eröffnen.
- Verfolgte Daten: In diesem Kapitel geht es um die Frage, wie man Daten im Internet schützen kann und welche Möglichkeiten der staatlichen Überwachung und Kontrolle bestehen. Die Autoren beleuchten die Problematik des Datenschutzes in einem globalisierten und vernetzten Kontext.
- Von der überflüssigen Knappheit: Dieses Kapitel diskutiert die Folgen der Digitalisierung und der Entgrenzung von Knappheit im Internet. Es werden die Auswirkungen auf Urheberrechte, Besitzgrenzen und die Ökonomie analysiert.
- Artefakte, Technofakte, Soziofakte: In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Formen der Interaktion zwischen Mensch und Maschine im Internet untersucht. Es wird die Frage erörtert, wie die Technik unsere Wahrnehmung der Welt und unseren Umgang mit Objekten verändert.
- Die vollvernetzten 24üStundenüKommunizierer: Dieses Kapitel behandelt die Frage, wie die ständige Erreichbarkeit durch mobile Kommunikationsmittel unser Leben prägt und welche Herausforderungen sich daraus für die Gesellschaft ergeben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Buches sind die alltägliche Vernetzung durch Computer, die Medialisierung von Kontakten und Beziehungen, der Wandel von Kommunikationskanälen, Social Software und soziale Netzwerke, Datenschutz und Datenmissbrauch, Virtualisierung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft, sowie die Herausforderungen der informationell differenzierten Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum trägt das Buch den Titel "Picknick mit Cyborgs"?
Der Titel symbolisiert das interdisziplinäre Gespräch über die Durchdringung des Alltags durch Technik und die Verschmelzung von Mensch und digitaler Vernetzung.
Welche wissenschaftlichen Disziplinen treffen hier aufeinander?
Das Buch verbindet die Perspektiven der Informatik (technische Ermöglichung) und der Soziologie (soziale Auswirkungen).
Was thematisiert das Kapitel über Datenschutz?
Es behandelt die Kontrolle über eigene Daten, Gefahren durch Social Scoring (z.B. Schufa) und Strategien zur Pseudonymisierung.
Was ist mit "maoistischen Ameisen" im Internet gemeint?
Dieser Begriff diskutiert kollaborative Wissensprojekte wie Wikipedia und die Frage, ob Massenbeteiligung zu Qualität oder Nivellierung führt.
Wie verändert die Virtualisierung unsere Gesellschaft?
Die Autoren untersuchen, wie soziale Netzwerke und mobile Kommunikation (Smartphones) Beziehungen, Privatsphäre und den öffentlichen Raum transformieren.
- Citar trabajo
- Constanze Kurz (Autor), Udo Thiedeke (Autor), 2010, Picknick mit Cyborgs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153456