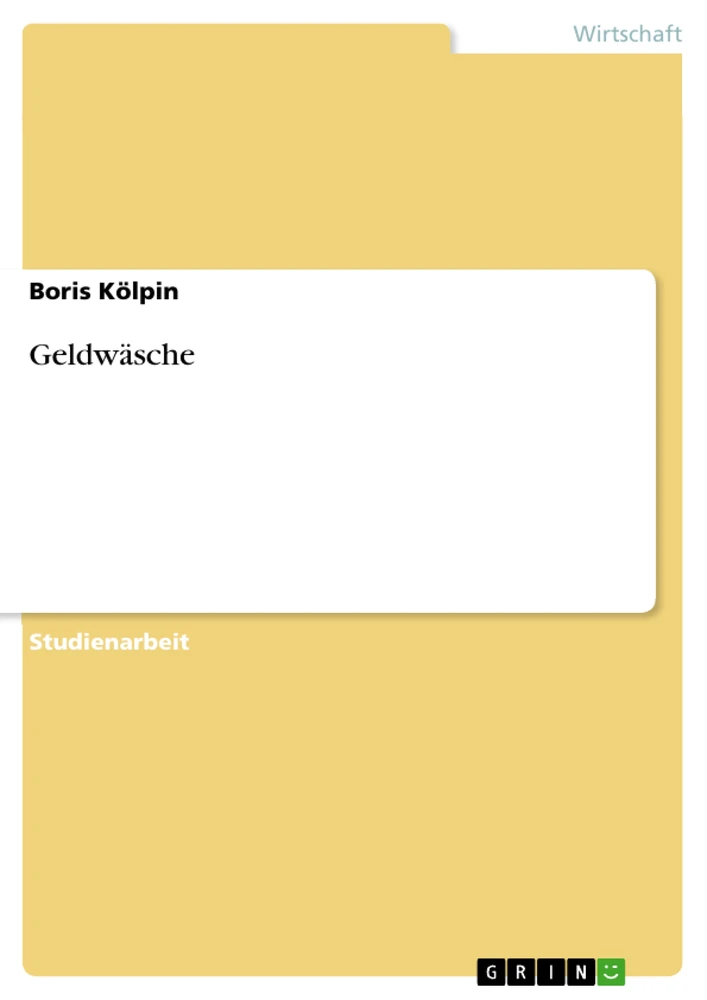Die vorliegende Hausarbeit im Seminar „Wirtschaftsstrafrecht“ setzt sich mit dem Thema der Geldwäsche auseinander. Die Geldwäsche stellt einen nicht zu vernachlässigenden Faktor für den globalen Wirtschaftsverkehr dar, denn nach einer Schätzung des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider und des IWF werden jedes Jahr weltweit ca. 800 Milliarden Euro gewaschen. Diese Zahl ist jedoch nur mit Vorsicht zu genießen, denn eine Geldwäsche wird in der Regel erst dann messbar, wenn die illegalen Taten aufgedeckt worden sind. Daher ist davon auszugehen, dass der tatsächliche Umfang um einiges höher ist, als in den Schätzungen bisher angenommen wird. Zudem ist die Geldwäsche speziell vor dem Hintergrund des Terroranschlages auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 verstärkt in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses geraten, da sich die internationalen Terrornetzwerke insbesondere aus gewaschenen Geldern finanzieren. In Folge dieser Anschläge haben die USA, Deutschland und auch viele andere Länder den Kampf gegen die Geldwäsche noch einmal erheblich verschärft.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die ökonomischen Interessen der Beteiligten einer Geldwäsche darzulegen, um im Anschluss die damit einhergehenden Rechtsfragen herauszuarbeiten und anhand von expliziten Beispielen zu veranschaulichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden zunächst die historischen rechtlichen Entwicklungen im Geldwäscherecht (B) skizziert. Im Anschluss hieran sollen die Grundlagen der Geldwäsche (C) sowie die ökonomischen Interessen (D) näher beleuchtet werden. Anhand dieser sollen im Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit strafrechtliche Regelung der Geldwäsche (E) vorgestellt werden. Abschließend wird im Fazit (F) ein Ausblick gegeben, in welche Richtung sich die rechtliche Handhabung der Geldwäsche entwickeln könnte und sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Inhalt der Arbeit
- B. Historie des Geldwäscherechts
- C. Grundlagen der Geldwäsche
- I. Geldwäschebegriff
- II. Das 3-Phasen-Modell
- 1. Platzierung
- 2. Verschleierung
- 3. Einschleusung
- D. Ökonomische Interessen
- E. Die Regelung des § 261 StGB
- I. Geschütztes Rechtsgut
- II. Objektiver Tatbestand
- 1. Tatobjekt
- a) Gegenstand
- b) Vortaten
- c) Herrühren
- d) Beispiel
- 2. Tathandlungen
- a) Verschleierungstatbestand (§ 261 I 1. Alt. StGB)
- b) Vereitelungs- und Gefährdungstatbestand (§ 261 I 2. Alt. StGB)
- c) Isolierungstatbestand (§ 261 II Nr.1 und Nr. 2 StGB)
- 1. Tatobjekt
- III. Subjektiver Tatbestand
- IV. Strafrahmen
- F. Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit im Seminar "Wirtschaftsstrafrecht" befasst sich mit dem Thema der Geldwäsche. Ziel ist es, die ökonomischen Interessen der Beteiligten einer Geldwäsche darzulegen, die damit einhergehenden Rechtsfragen herauszuarbeiten und anhand von expliziten Beispielen zu veranschaulichen.
- Historische Entwicklungen des Geldwäscherechts
- Grundlagen der Geldwäsche, einschließlich Begriffsbestimmung und 3-Phasen-Modell
- Ökonomische Interessen der an der Geldwäsche Beteiligten
- Strafrechtliche Regelung der Geldwäsche, insbesondere § 261 StGB
- Zukünftige Entwicklungen in der rechtlichen Handhabung der Geldwäsche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Darstellung der historischen Entwicklung des Geldwäscherechts, wobei die Einführung des Straftatbestandes der Geldwäsche in das deutsche Strafgesetzbuch im Jahr 1992 und die Entstehung des Geldwäschegesetzes (GwG) im Jahr 1993 hervorgehoben werden.
Im Anschluss werden die Grundlagen der Geldwäsche beleuchtet, einschließlich einer Definition des Begriffs und einer Erläuterung des 3-Phasen-Modells, das die Schritte Platzierung, Verschleierung und Einschleusung von illegalen Geldern beschreibt.
Anschließend werden die ökonomischen Interessen der an der Geldwäsche Beteiligten analysiert.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Darstellung der strafrechtlichen Regelung der Geldwäsche. Hierbei wird der § 261 StGB im Detail betrachtet, einschließlich der Beschreibung des geschützten Rechtsguts, des objektiven und subjektiven Tatbestands sowie des Strafrahmens.
Abschließend gibt die Arbeit einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der rechtlichen Handhabung der Geldwäsche.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen und Themen der Geldwäsche, darunter die historische Entwicklung, die rechtlichen Grundlagen, die ökonomischen Interessen der Beteiligten, die Strafrechtliche Regelung, insbesondere § 261 StGB, sowie die präventiven und repressiven Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Geldwäsche definiert?
Geldwäsche ist das Einschleusen von illegal erwirtschaftetem Geld (z. B. aus Drogenhandel oder Korruption) in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
Was ist das 3-Phasen-Modell der Geldwäsche?
Es besteht aus der Platzierung (Einschleusen in Finanzsysteme), der Verschleierung (Verschleierung der Herkunft durch Transaktionen) und der Einschleusung (Re-Investition als „sauberes“ Kapital).
Was regelt § 261 StGB?
Dieser Paragraph des Strafgesetzbuches stellt die Geldwäsche unter Strafe und definiert Tatobjekte, Vortaten und die verschiedenen Tathandlungen.
Was sind typische „Vortaten“ bei der Geldwäsche?
Das sind Straftaten, aus denen das Geld stammt, wie etwa gewerbsmäßiger Betrug, Raub, Erpressung oder Drogenkriminalität.
Warum ist Geldwäschebekämpfung für den Staat so wichtig?
Geldwäsche untergräbt die Integrität des Finanzsystems und dient oft der Finanzierung von organisiertem Verbrechen und Terrorismus.
- Citar trabajo
- Boris Kölpin (Autor), 2010, Geldwäsche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153469