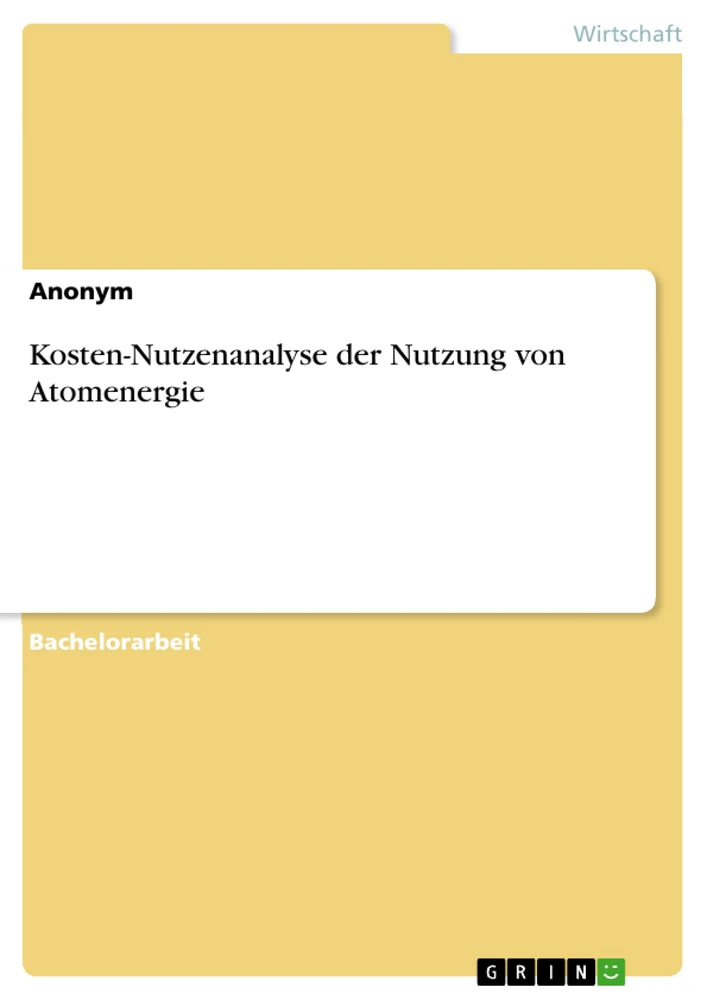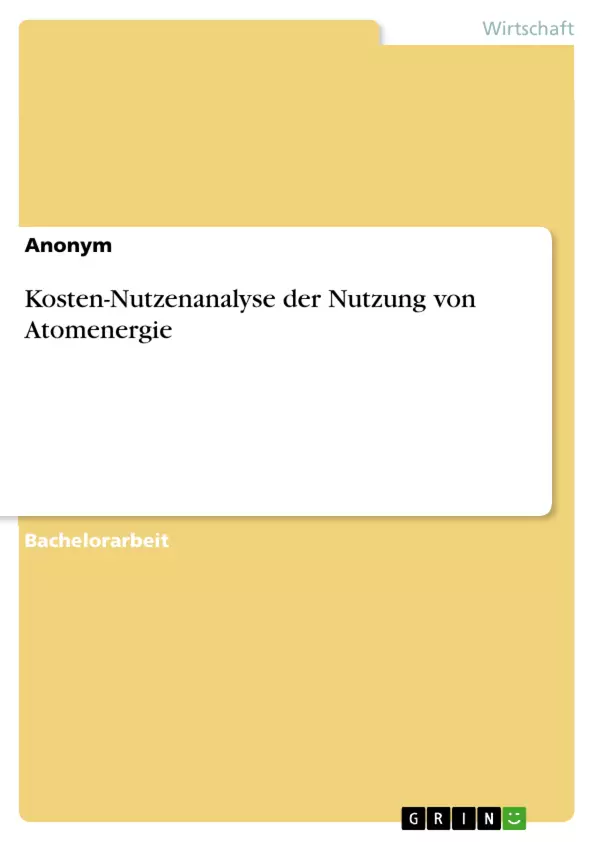Die Nutzung der Kernenergie in Deutschland blickt auf eine in Form und Bedeutung einmalige Geschichte zurück. Zum ersten Mal setzte der Bundesgesetzgeber, eingebettet in die Europäische Atomgemeinschaft mit dem Atomgesetz des Jahres 1959 auf die Entwicklung einer damals gänzlich neuen zivilen Technik zur Erzeugung von Elektrizität.
Da der Bund selbst diese Aufgabe nicht mit den eigenen Verwaltungsmitteln bewerkstelligen konnte und wollte, erforderte die Verwirklichung dieses damals außerordentlich ehrgeizigen politischen Willens eine langfristige institutionelle Zusammenarbeit mit der deutschen Energiewirtschaft. Eine entsprechende Planung und ihre gewaltige Investitionssummen erfordernde Umsetzung waren in Ländern wie Frankreich oder Großbritannien vergleichsweise leicht zu realisieren, weil dort durch die Integration mit militärischen Anwendungen die Entwicklung von Kernreaktoren zunächst fast ausschließlich in staatlicher Hand ruhte. In Deutschland dagegen entschloss sich der Gesetzgeber dazu, schon um jeden Anschein staatlich-militärischer Ambitionen zu vermeiden, nicht selbst Reaktoren zu entwickeln, sondern die private Wirtschaft in diese Richtung zu lenken. Der Staat setzte die Rahmenbedingungen und hoffte auf die eingeforderte Initiative. Dies war umso leichter möglich, als die Energiewirtschaft vielfältig mit der öffentlichen Gewalt insbesondere auf kommunaler Ebene verbunden war und die sichere Energieversorgung als eine nationalstaatliche Aufgabe ersten Ranges galt.
In der Bundesrepublik Deutschland sind heute noch 17 Kernkraftwerke in Betrieb. Deutsche Kernkraft decken inzwischen 23 Prozent der inländischen Stromversorgung. Die für eine sichere und gleichmäßige Elektrizitätsversorgung besonders bedeutsame sog. Grundlastversorgung (=Elektrizitätslieferung rund um die Uhr über das gesamte Jahr) wird in Deutschland zur Hälfte durch Kernenergie sichergestellt. Allerdings dürfte dieser Anteil an der Stromversorgung in Zukunft sinken, da die Bundesregierung am 22.04.2002 den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen hat. Dieser Beschluss besagt eine Abschaltung der Reaktoren nach einer durchschnittlichen Laufzeit von 32 Jahren.Fraglich bleibt die Diskussion, in der wir uns im Jahr 2010 zum Thema Restlaufzeitverlängerung befinden. Eine Verlängerung des Betriebs von Kernkraftwerken bis zu einer Lebensdauer von 60 Jahren steht zur Debatte. Dazu soll diese Arbeit betragen, in der die Kosten und der Nutzen mit der Kernenergienutzung analysiert werden
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Kosten-Nutzenanalyse der Nutzung von Atomenergie
- 2.1 Kostenanalyse
- 2.1.1 Kapitalkosten
- 2.1.2 Investitionskosten
- 2.1.3 Marktzins
- 2.1.4 Lebensdauer und Arbeitsnutzung
- 2.1.4.1 Grundlast-Spitzenlast
- 2.1.4.2 Grundlastbetrieb
- 2.1.5 Brennstoffkosten
- 2.1.6 Sonstige Kostenkomponente
- 2.1.7 Variable übrige Kosten
- 2.1.8 Externe Kosten
- 2.1.8.1 Emission radioaktiver Stoffe im Normalbetrieb
- 2.1.8.2 Unfälle
- 2.1.8.3 Berufsrisiken
- 2.1.9 Stilllegung
- 2.2 Kernenergieausstieg
- 2.2.1 Arbeitsplatzeffekt
- 2.2.2 Stomlücke
- 2.2.3 Ausweg Import?
- 2.2.4 Endlagerung
- 2.3 Restlaufzeitverlängerung
- 2.3.1 Abschaltung der Reaktoren ab 2022
- 2.3.2 Laufzeitverlägerung versus Ausbau erneuerbarer Energie
- 2.3.3 Brennelementesteuer
- 2.3.4 Höhe der Steuereinnahmen
- 3 Zukunft der Kernenergie
- Kostenanalyse der Atomenergie
- Auswirkungen des Kernenergieausstiegs
- Bewertung der Restlaufzeitverlängerung
- Alternativen zur Atomenergie
- Zukunft der Kernenergie in Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Kosten-Nutzenanalyse der Nutzung von Atomenergie in Deutschland. Sie analysiert die verschiedenen Kosten, die mit der Nutzung von Atomenergie einhergehen, sowie die Auswirkungen des Kernenergieausstiegs und der Restlaufzeitverlängerung auf die deutsche Stromversorgung.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Nutzung von Atomenergie in Deutschland ein und schildert die historische Entwicklung der Kernenergiepolitik. Das zweite Kapitel widmet sich der Kosten-Nutzenanalyse der Atomenergie und beleuchtet die verschiedenen Kostenkomponenten wie Kapitalkosten, Investitionskosten, Marktzins, Lebensdauer und Arbeitsnutzung, Brennstoffkosten, externe Kosten und Stilllegungskosten. Des Weiteren werden die Auswirkungen des Kernenergieausstiegs auf den Arbeitsmarkt, die Stromversorgung und die Endlagerung von Atommüll behandelt. Im dritten Kapitel werden die Möglichkeiten der Restlaufzeitverlängerung von Kernkraftwerken und die Alternativen zur Atomenergie beleuchtet. Die Vorteile und Nachteile der einzelnen Optionen werden gegeneinander abgewogen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Atomenergie, Kosten-Nutzenanalyse, Kernenergieausstieg, Restlaufzeitverlängerung, Stromversorgung, Endlagerung, erneuerbare Energien, Kapitalkosten, Investitionskosten, externe Kosten, Umweltrisiken, Arbeitsplatzeffekt.
Häufig gestellte Fragen zur Atomenergie
Welche Kostenfaktoren entstehen bei der Kernenergie?
Zu den Kosten zählen Investitions- und Kapitalkosten, Brennstoffkosten, Kosten für die Stilllegung der Anlagen sowie externe Kosten durch Umweltrisiken.
Was sind "externe Kosten" der Atomkraft?
Das sind Kosten, die nicht vom Betreiber getragen werden, wie Risiken durch Unfälle, Entsorgung des Atommülls und gesundheitliche Folgen radioaktiver Emissionen.
Wie viel Strom liefert Kernenergie in Deutschland?
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeit deckte die Kernenergie etwa 23 Prozent der inländischen Stromversorgung und die Hälfte der Grundlastversorgung.
Was bedeutet "Restlaufzeitverlängerung"?
Es bezeichnet die politische Debatte darüber, Kernkraftwerke länger als die ursprünglich geplanten 32 Jahre (bis zu 60 Jahre) in Betrieb zu lassen.
Welche Folgen hat der Atomausstieg für den Arbeitsmarkt?
Der Ausstieg führt zum Verlust von Arbeitsplätzen in der Kerntechnik, schafft jedoch gleichzeitig neue Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2010, Kosten-Nutzenanalyse der Nutzung von Atomenergie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153557