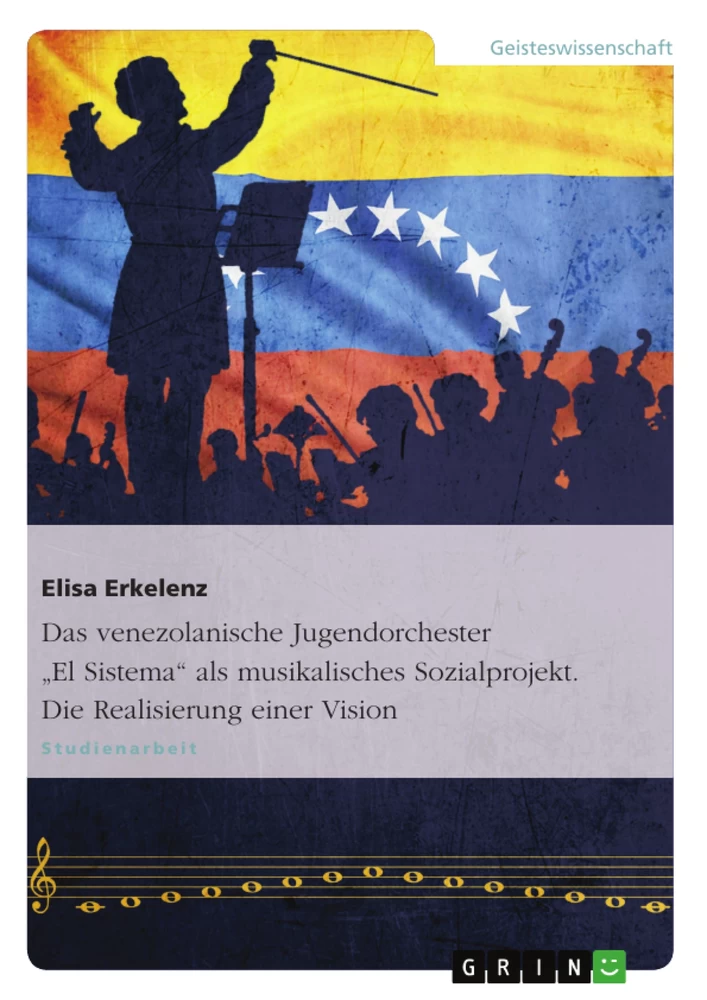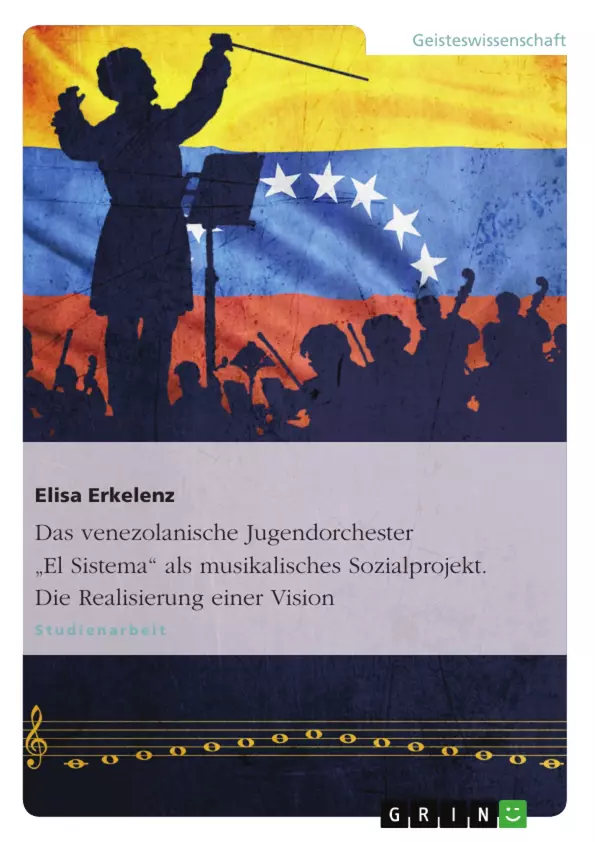Zeitungen betiteln es als „das Wunder von Caracas“: Das venezolanische Jugendorchestersystem El Sistema, ein musikalisches Sozialprojekt, welches unter der Führung von José Antonio Abreu seit 35 Jahren Kindern und Jugendlichen der Armenviertel Venezuelas ein Instrument und Musikunterricht zur Verfügung stellt. Durch den freien Zugang zur klassischen Musik finden jährlich Tausende von Kindern des Projektes einen Weg aus dem Teufelskreis von Armut, Kriminalität und Drogen und bekommen eine Zukunftsperspektive. Vor Enthusiasmus und Musizierfreude sprühend, verzaubern die Jugendorchester ihr Publikum – das Simon Bolívar Youth Orchestra, welches die Pyramidenspitze der Bewegung bildet, zählt zu einem der fünf besten Orchester der Welt.
Dieses einzigartige Musikausbildungssystem gehört zu den erfolgreichsten und effektivsten Sozial- und Entwicklungsprojekten der Welt, und wirkt in seiner einzigartigen Struktur wegweisend für zahlreiche weitere internationale Musikprojekte. Die Bewegung gilt als Wunder, José Antonio Abreu wird als Heiliger verehrt. Doch wie hat er seine Vision realisiert? Und welche Verhaltensweisen, Methoden und vor allem welche Strategie haben es ihm ermöglicht, diese Bewegung auszulösen?
Diesen Fragen soll in dieser Arbeit unter einem managementorientierten Blickwinkel nachgegangen werden. In diesem Sinne widmet sich das zweite Kapitel der Bewegung „El Sistema“. Um der Analyse von José Antonio Abreus Vorgehen bei der Umsetzung seiner Vision eine theoretische Grundlage zu liefern, soll im zweiten Kapitel eine Managementstrategie erläutert werden, deren sozioorientierte Ausrichtung sehr gut zu diesem Thema passt: die Engpasskonzentrierte Managementstrategie nach Wolfgang Mewes.
Da „El Sistema“ als soziale Bewegung viele Besonderheiten im Vergleich zu einem Business Unternehmen, auf welches diese Strategie primär ausgerichtet ist, aufweist, soll diese Vorgehensweise noch durch die Erläuterung der Arbeitsweise eines Social Entrepreneurs ergänzt und mit ihr verglichen werden. Mit diesem Ziel widmet sich Kapitel 4 dem Thema Social Entrepreneurship. Dieser theoretische Rahmen soll in Kapitel 5 nun dafür verwandt werden, die zu Beginn der Arbeit herausgearbeitete Vorgehensweise Abreus bei der Umsetzung seiner Vision mit der EKS-Strategie sowie den Merkmalen eines Social Entrepreneurs zu vergleichen. Auf diese Erkenntnisse aufbauend soll schlussendlich der Versuch gewagt werden, einen allgemeinen Strategieplan für Social Entrepreneurs zu entwerfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Thema und Vorgehensweise
- 2. El Sistema: Das Nationale System der Jugend- und Kinderorchester in Venezuela
- 2.1. Was ist El Sistema?
- 2.2. Die politische und kulturelle Situation in Venezuela während der Gründung von El Sistema
- 2.3. Die Vision des Gründers José Antonio Abreu
- 2.4. Die Realisierung der Vision
- 2.4.1. Das musikpädagogische Modell
- 2.4.2. Die gezielte Motivation und Koordination der maßgeblichen Leute
- 2.4.3. Die Beschaffung der notwendigen materiellen und finanziellen Ressourcen
- 2.5. Auswirkungen auf das politische, soziale und kulturelle Umfeld nach 35 Jahren der Entwicklung - national und international
- 2.5.1. Die Veränderung Venezuelas
- 2.5.2. Ein Modell für die Welt
- 2.5.3. El Sistema in Deutschland
- 3. Die Engpasskonzentrierte Managementstrategie nach Wolfgang Mewes
- 3.1. Die vier Grundprinzipien
- 3.2. Die Vorgehensweise nach der EKS-Strategie in sieben Phasen
- 3.3. Ursachen für den Erfolg der EKS-Strategie
- 4. Die Arbeitsweise eines Social Entrepreneurs
- 4.1. Was ist ein Social Entrepreneur?
- 4.2. Wichtige Merkmale eines Social Entrepreneurs
- 5. Die Entwicklung von El Sistema im Vergleich mit der EKS-Strategie und der Arbeitsweise eines Social Entrepreneurs
- 5.1. Die Realisierung von El Sistema im Vergleich mit der EKS-Strategie
- 5.2. José Antonio Abreu - ein Social Entrepreneur?
- 5.3. Der Entwurf eines Strategieplans für Social Entrepreneurs anhand des 7-Phasen-Modells der EKS-Strategie
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erfolgsgeschichte von El Sistema, dem venezolanischen Jugendorchestersystem, unter einem managementorientierten Blickwinkel. Ziel ist es, die Realisierung der Vision von Gründer José Antonio Abreu zu analysieren und die Strategien und Methoden zu identifizieren, die zu diesem Erfolg geführt haben. Der Fokus liegt auf dem Vergleich von Abreus Vorgehen mit der Engpasskonzentrierten Managementstrategie und den Merkmalen eines Social Entrepreneurs.
- Analyse der Erfolgsfaktoren von El Sistema
- Vergleich mit der Engpasskonzentrierten Managementstrategie
- Untersuchung der Rolle von José Antonio Abreu als Social Entrepreneur
- Entwicklung eines Strategieplans für Social Entrepreneurs
- Die soziale und kulturelle Wirkung von El Sistema
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thema und Vorgehensweise: Die Einleitung stellt El Sistema als ein außergewöhnlich erfolgreiches Sozialprojekt vor und thematisiert die Forschungslücke bezüglich der konkreten Realisierungsstrategien von Abreu's Vision. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an: Analyse von El Sistema, Erläuterung der Engpasskonzentrierten Managementstrategie (EKS) und des Social Entrepreneurship, sowie einen Vergleich dieser Konzepte mit der Praxis von El Sistema. Der Fokus liegt auf der Beantwortung der Frage, wie Abreu seine Vision in die Tat umgesetzt hat.
2. El Sistema: Das Nationale System der Jugend- und Kinderorchester in Venezuela: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über El Sistema, beginnend mit seiner Definition und seiner Entstehung aus der Simón Bolívar Jugendorchester. Es beschreibt die politische, soziale und kulturelle Situation in Venezuela zur Gründungszeit und beleuchtet die Vision von José Antonio Abreu. Die Realisierung dieser Vision wird anhand des musikpädagogischen Modells, der Motivation und Koordination beteiligter Personen sowie der Beschaffung von Ressourcen detailliert analysiert. Schließlich werden die nationalen und internationalen Auswirkungen nach 35 Jahren Entwicklung beleuchtet, inklusive der Veränderung Venezuelas und des Einflusses von El Sistema weltweit.
3. Die Engpasskonzentrierte Managementstrategie nach Wolfgang Mewes: Dieses Kapitel erläutert die Engpasskonzentrierte Managementstrategie (EKS) von Wolfgang Mewes. Es beschreibt die vier Grundprinzipien der EKS, die Vorgehensweise in sieben Phasen und die Erfolgsfaktoren dieser sozioorientierten Managementstrategie. Im Gegensatz zu gewinnorientierten Strategien wird der Fokus auf die systematische Bewältigung von Engpässen gelegt um nachhaltigen Erfolg zu sichern.
4. Die Arbeitsweise eines Social Entrepreneurs: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Social Entrepreneur" und listet wichtige Merkmale und Eigenschaften eines Sozialunternehmers auf, basierend auf Literaturrecherche und eigener Forschung. Es liefert einen Rahmen für das Verständnis der spezifischen Herausforderungen und Handlungsweisen im sozialen Unternehmertum.
5. Die Entwicklung von El Sistema im Vergleich mit der EKS-Strategie und der Arbeitsweise eines Social Entrepreneurs: In diesem Kapitel werden die Strategien und Methoden von José Antonio Abreu bei der Umsetzung seiner Vision mit der EKS-Strategie und den Merkmalen eines Social Entrepreneurs verglichen. Der Vergleich dient als Grundlage für die Entwicklung eines allgemeinen Strategieplans für Social Entrepreneurs, der als Handlungsleitfaden für die Entwicklung der Branche dienen soll.
Schlüsselwörter
El Sistema, José Antonio Abreu, Jugendorchester, Venezuela, Sozialprojekt, Musikpädagogik, Engpasskonzentrierte Managementstrategie (EKS), Social Entrepreneurship, Soziale Entwicklung, Kulturelle Integration, Armutsbekämpfung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Erfolgsfaktoren von El Sistema
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Erfolgsgeschichte von El Sistema, dem venezolanischen Jugendorchestersystem, aus managementorientierter Perspektive. Sie untersucht die Realisierungsstrategien der Vision von Gründer José Antonio Abreu und vergleicht diese mit der Engpasskonzentrierten Managementstrategie (EKS) und den Merkmalen eines Social Entrepreneurs.
Was ist El Sistema und welche Aspekte werden untersucht?
El Sistema ist das nationale System der Jugend- und Kinderorchester in Venezuela. Die Arbeit untersucht seine Entstehung, das musikpädagogische Modell, die Motivation und Koordination der Beteiligten, die Beschaffung von Ressourcen und die nationalen sowie internationalen Auswirkungen nach 35 Jahren Entwicklung. Der Fokus liegt auf den Erfolgsfaktoren und dem Einfluss auf das politische, soziale und kulturelle Umfeld Venezuelas.
Welche Managementstrategie wird mit El Sistema verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Strategien von El Sistema mit der Engpasskonzentrierten Managementstrategie (EKS) nach Wolfgang Mewes. Die EKS, mit ihren vier Grundprinzipien und der siebenphasigen Vorgehensweise, wird detailliert erläutert und als Gegenstück zu gewinnorientierten Strategien dargestellt.
Welche Rolle spielt der Begriff "Social Entrepreneur"?
Die Arbeit untersucht, inwiefern José Antonio Abreu als Social Entrepreneur betrachtet werden kann. Sie definiert den Begriff "Social Entrepreneur", beschreibt wichtige Merkmale und Eigenschaften und setzt dies in Relation zu Abreus Handeln und der Entwicklung von El Sistema.
Welche konkreten Fragen werden beantwortet?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Erfolgsfaktoren von El Sistema zu analysieren, einen Vergleich mit der EKS-Strategie zu ziehen, die Rolle von José Antonio Abreu als Social Entrepreneur zu untersuchen und auf dieser Basis einen Strategieplan für Social Entrepreneurs zu entwickeln. Im Kern geht es um die Frage, wie Abreu seine Vision in die Tat umgesetzt hat.
Welche Kapitelstruktur hat die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Thema und Vorgehensweise; 2. El Sistema; 3. Die Engpasskonzentrierte Managementstrategie; 4. Die Arbeitsweise eines Social Entrepreneurs; 5. Vergleich von El Sistema mit EKS und Social Entrepreneurship; und 6. Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel umfasst eine detaillierte Analyse der jeweiligen Themen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: El Sistema, José Antonio Abreu, Jugendorchester, Venezuela, Sozialprojekt, Musikpädagogik, Engpasskonzentrierte Managementstrategie (EKS), Social Entrepreneurship, Soziale Entwicklung, Kulturelle Integration, Armutsbekämpfung.
Wo finde ich weitere Informationen zu El Sistema?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über El Sistema. Für weitere Informationen empfiehlt sich die Recherche in Fachliteratur zu Musikpädagogik, Sozialprojekten in Venezuela und dem Bereich Social Entrepreneurship.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und Praktiker im Bereich Management, Sozialwissenschaften, Musikpädagogik und Sozialunternehmertum. Sie bietet wertvolle Einblicke in die erfolgreiche Umsetzung eines groß angelegten Sozialprojekts und liefert ein praxisnahes Beispiel für die Anwendung managementorientierter Strategien im sozialen Kontext.
Gibt es einen Strategieplan für Social Entrepreneurs?
Ja, basierend auf dem Vergleich von El Sistema mit der EKS-Strategie und den Merkmalen eines Social Entrepreneurs, entwickelt die Arbeit einen Entwurf eines Strategieplans für Social Entrepreneurs, der als Handlungsleitfaden dienen soll.
- Citation du texte
- Elisa Erkelenz (Auteur), 2010, Das venezolanische Jugendorchester "El Sistema" als musikalisches Sozialprojekt. Die Realisierung einer Vision, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153576