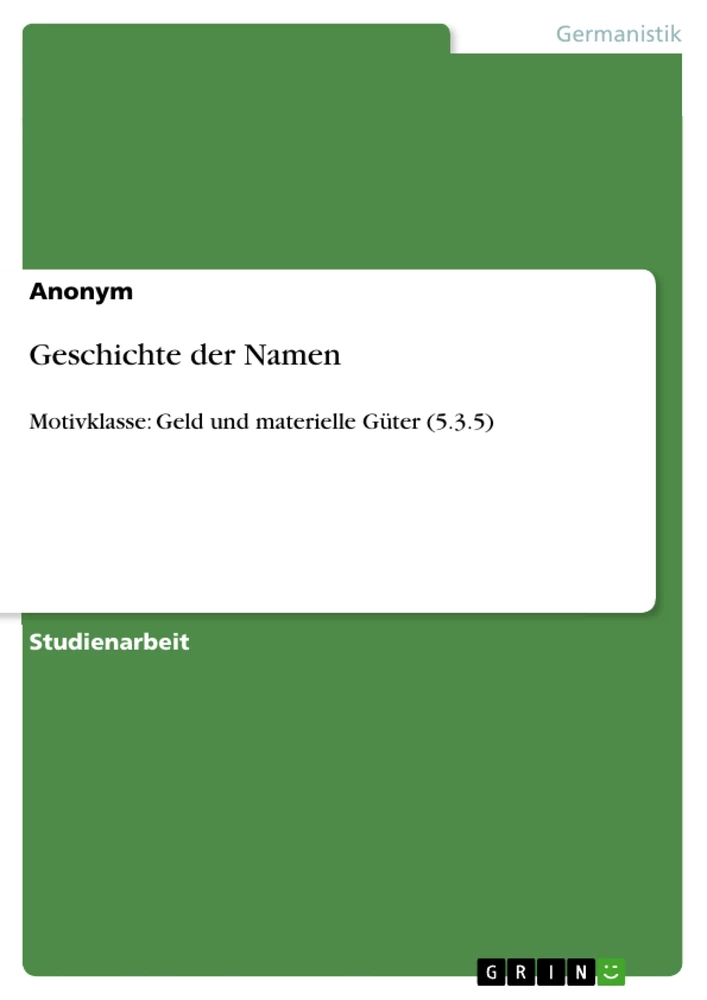Im Kontext der Onomastik wird die Motivklasse „Geld und materielle Güter“ in die Klasse 5 „Familiennamen aus Übernamen“ Unterpunkt 3 „Psychisch-charakterliche Dispositionen und Gewohnheiten“ eingeordnet. Unterteilt habe ich das Thema noch einmal in folgende fünf thematische Unterpunkte: 1.) Kennzeichnung für Berufe, die mit Geld zu tun haben, 2.) Kennzeichnung für Personen mit Geld und materiellen Gütern, 3.) Kennzeichnung für Geld und materielle Güter sowie Zins- und Naturalabgaben, 4.) Kennzeichnung für Personen, die kein Geld oder materielle Güter besitzen und 5.) Sonstige, unter denen ich Bezeichnungen für abgabepflichtige Personen, geizige Menschen, Betrüger und Geldbußen zusammengefasst habe.
Weiterhin bin ich so vorgegangen, dass ich meine Ergebnisse jeweils in die drei grammatischen Kategorien: Derivation: Stamm und Suffigierung, Zusammenbildung und Zusammenrückung aufgenommen und eingeordnet habe. Meine Namenssammlung habe ich zudem in einer Tabelle aufgeführt, wobei jeweils eine Spalte die Typen der Familiennamen und die Originalschreibungen erfasst. Dazu habe ich die grammatischen Besonderheiten dargelegt und in der Spalte „Bemerkungen“ die Erklärungen verschiedener Begriffe hinzugefügt, falls sie heute nicht mehr erschließbar sind. Aufgeführt habe ich lediglich Namen, die ich mittels des Telefonbuchs nachweisen konnte. Namen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind im Namenlexikon aufgeführt gewesen, konnte ich jedoch nicht mit dem Telefonbuch belegen, was entweder daran liegen könnte, dass es diese
Namen schlichtweg nicht mehr gibt, sie gewissermaßen ausgestorben sind, oder die Person mit dem Namen einfach nicht im Telefonbuch steht. Des Weiteren habe ich es im Feld „Bemerkungen“ vermerkt, wenn im Anhang zum jeweiligen Namen Karten zur geografischen Verteilung des Namens vorhanden sind. Für die Karten habe ich vorrangig Namen ausgesucht und gegenübergestellt, die grammatische Unterschiede aufweisen, die eventuell auch geografisch nachzuweisen sind, wie beispielsweise die Lautverschiebung oder dialektale Schreibweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbemerkungen zur Motivklasse: Geld und materielle Güter (5.3.5)
- Das mittelalterliche Ordnungsgefüge
- Die Entstehung des Münzwesens
- Hauptteil: Motivklasse: Geld und materielle Güter (5.3.5)
- Kennzeichnung für Berufe, die mit Geld zu tun haben
- Derivation: Stamm und Suffigierung
- Zusammenbildung
- Kennzeichnung für Personen mit Geld und materiellen Gütern
- Derivation: Stamm und Suffigierung
- Zusammenbildung
- Zusammenrückung
- Verb und Substantiv
- Kennzeichnung für Geld und materielle Güter sowie Zins- und Naturalabgaben
- Derivation: Stamm und Suffigierung
- Zusammenbildung
- Kennzeichnung für Personen, die kein Geld oder materielle Güter besitzen
- Derivation: Stamm und Suffigierung
- Zusammenbildung
- Zusammenrückung
- Verb und Negationspartikel
- Adjektiv und Adjektiv
- Sonstige
- Derivation: Stamm und Suffigierung
- Zusammenbildung
- Zusammenrückung
- Verb und Negationspartikel
- Verb und Substantiv
- Schluss
- Auswertung der Motivklasse: Geld und materielle Güter (5.3.5)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Motivklasse "Geld und materielle Güter" innerhalb der Familiennamenforschung. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung von Familiennamen, die sich auf Geld, materielle Güter und damit verbundene Berufe oder Eigenschaften beziehen.
- Die Entstehung von Familiennamen aus Übernamen, insbesondere im Kontext von Geld und materiellen Gütern.
- Die Bedeutung des mittelalterlichen Ordnungsgefüges für die Entstehung von Familiennamen.
- Die Rolle des Münzwesens und der damit verbundenen Berufe und Personen in der Entwicklung von Familiennamen.
- Die Analyse von Familiennamen aus unterschiedlichen grammatischen Perspektiven (Derivation, Zusammenbildung, Zusammenrückung).
- Die geografische Verteilung und sprachliche Variation von Familiennamen innerhalb der Motivklasse "Geld und materielle Güter".
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Motivklasse "Geld und materielle Güter" vor und erläutert die Gliederung der Arbeit. Sie beschreibt die methodischen Vorgehensweisen und die Bedeutung des mittelalterlichen Ordnungsgefüges und des Münzwesens für die Entstehung von Familiennamen.
- Hauptteil: Dieses Kapitel untersucht die Motivklasse "Geld und materielle Güter" anhand von Beispielen aus der Familiennamenforschung. Es analysiert die verschiedenen Kategorien von Familiennamen, die sich auf Geld, materielle Güter und damit verbundene Berufe oder Eigenschaften beziehen.
Schlüsselwörter
Familiennamen, Motivklasse, Geld, materielle Güter, Übername, Mittelalter, Ordnungsgefüge, Münzwesen, Beruf, Eigenschaft, Derivation, Zusammenbildung, Zusammenrückung, geografische Verteilung, sprachliche Variation.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2008, Geschichte der Namen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153602