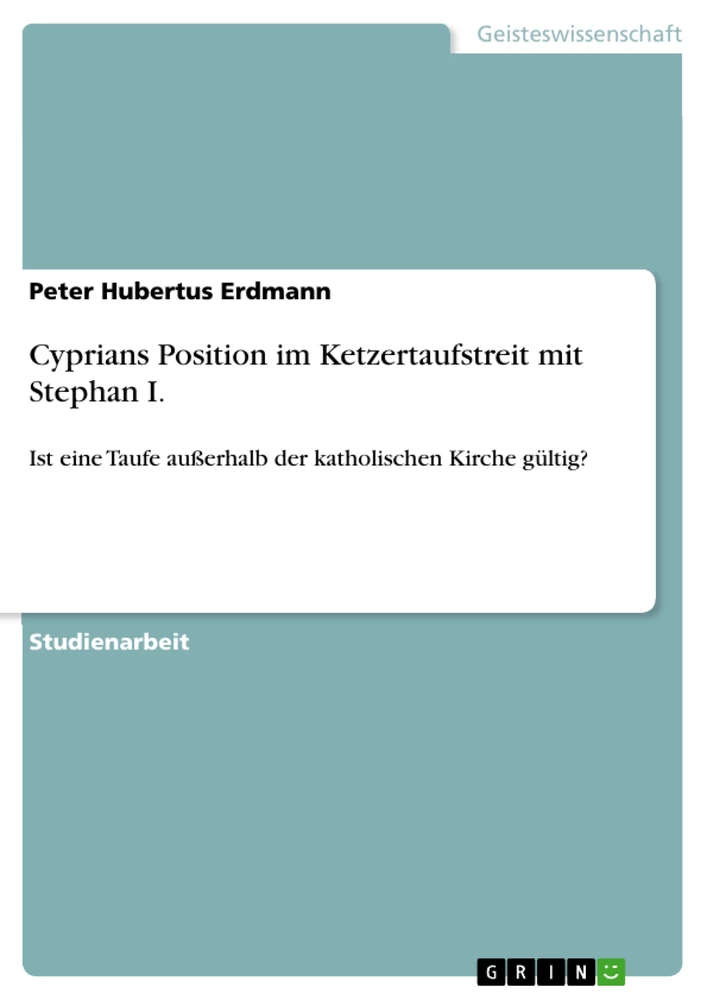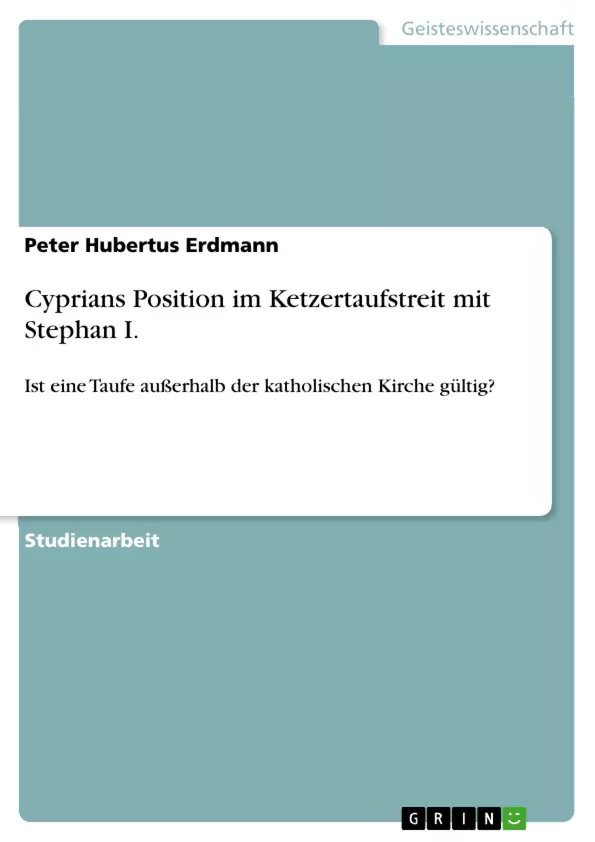In den Jahren 255 bis 256 n. Chr. führten der höchste Vertreter der nordafrikanischen Kirche, Bischof Cacilius Cyprianus, und der römische Bischof Stephanus I. einen brieflichen Disput über die Frage, ob eine in einer häretischen oder schismatischen Gemeinschaft vollzogene Taufe anzuerkennen und damit ein aus einer solchen Gemeinde zu der Katholischen Kirche Konvertierender als bereits getauft zu betrachten sein sollte.
Die Frage nach der Gültigkeit der von nicht-katholischen Gruppierungen gespendeten Taufe (der sogenannten „Ketzertaufe“) entstand zwar bereits zu Beginn des 3. Jahrhunderts, als Anhänger der verschiedenen Häresien um Eintritt in die katholische Kirche baten. Doch hatten sich als Reaktion zwei verschiedene Bräuche entwickelt, die bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts hinein friedlich nebeneinander existierten, ohne dass es zum Streit gekommen war. In Afrika und in den meisten Kirchen des Ostens taufte man die Konvertiten als bisher Ungetaufte. In Rom und Alexandrien dagegen wurde die von Schismatikern vollzogene Taufe als gültig angesehen, da sie im Namen Christi gespendet und empfangen wurde. Man wollte dadurch die Heiligkeit des Sakraments von der Würdigkeit des Spenders trennen. Bei der Aufnahme in die katholische Gemeinde wurde daher lediglich im Rahmen eines Bußakts bzw. zur Mitteilung des Geistes die Hand des Bischofs aufgelegt.
Als jedoch 255 und 266 zwei Synoden unter Cyprians Leitung die Ungültigkeit der Ketzertaufe deklarierten, wogegen Stephan I. die Forderung nach der Aufnahme der römischen Praxis setzte, entbrannte ein heftiger Konflikt, welcher in der Kirchengeschichte als sogenannter „Ketzertaufstreit“ bezeichnet wird.
Die Aufgabe der vorliegenden Hausarbeit soll darin bestehen, die Position Cyprians hinsichtlich der „Ketzertaufe“ mittels einer Kurzanalyse eines cyprianischen Briefs aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu den Briefformalia
- Zum Briefinhalt
- Historischer Epilog
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Position des nordafrikanischen Kirchenführers Cyprian im "Ketzertaufstreit" des 3. Jahrhunderts. Sie befasst sich mit der Frage, ob eine in einer häretischen oder schismatischen Gemeinschaft vollzogene Taufe anzuerkennen sei.
- Der Brief als Quelle für Cyprians Position zur Ketzertaufe
- Die Entwicklung des Taufstreits im 3. Jahrhundert
- Die Briefformalia und der Kontext von Cyprians epistula 71
- Die Synodalen Beschlüsse und ihre Bedeutung für den Taufstreit
- Die Rolle von Cyprian und Stephan I. im Streit um die Ketzertaufe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt den historischen Hintergrund des Ketzertaufstreits vor und erläutert die Positionen von Cyprian und Stephan I. Sie beschreibt die Entwicklung der beiden unterschiedlichen Bräuche in Afrika und Rom, die zur Mitte des 3. Jahrhunderts zu einem heftigen Konflikt führten.
2. Zu den Briefformalia
Dieses Kapitel analysiert den Brief Cyprians an Quintus (epistula 71) hinsichtlich seiner Entstehungszeit, Authentizität und Funktion. Es wird der Briefaufbau, die Rezeption in anderen Sprachen und die Einordnung in den Kontext des Taufstreits beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Ketzertaufstreit, Cyprian, Stephan I., der Gültigkeit der Ketzertaufe, der Briefliteratur des 3. Jahrhunderts, der nordafrikanischen Kirche, der römischen Kirche, Synodalen Beschlüssen und der Geschichte der frühen Kirche.
Häufig gestellte Fragen
Was war der zentrale Konflikt im „Ketzertaufstreit“?
Es ging um die Frage, ob eine Taufe, die in einer häretischen Gemeinschaft vollzogen wurde, bei einem Übertritt zur katholischen Kirche gültig ist oder wiederholt werden muss.
Welche Position vertrat Bischof Cyprian von Karthago?
Cyprian und die afrikanische Kirche vertraten die Ansicht, dass die Ketzertaufe ungültig sei und Konvertiten daher als bisher Ungetaufte erneut getauft werden müssten.
Wie unterschied sich die römische Praxis unter Stephan I.?
In Rom wurde die Ketzertaufe als gültig anerkannt, da sie im Namen Christi gespendet wurde. Die Aufnahme erfolgte lediglich durch Handauflegung als Bußakt.
Welche Rolle spielt die „epistula 71“ in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt diesen Brief Cyprians an Quintus für eine Kurzanalyse, um Cyprians theologische Position zum Taufstreit aufzuzeigen.
Wann fand dieser kirchengeschichtliche Disput statt?
Der heftigste Teil des Konflikts entbrannte in den Jahren 255 bis 256 n. Chr. nach mehreren Synoden unter der Leitung Cyprians.
- Quote paper
- Dipl. theol. Peter Hubertus Erdmann (Author), 2004, Cyprians Position im Ketzertaufstreit mit Stephan I., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153654