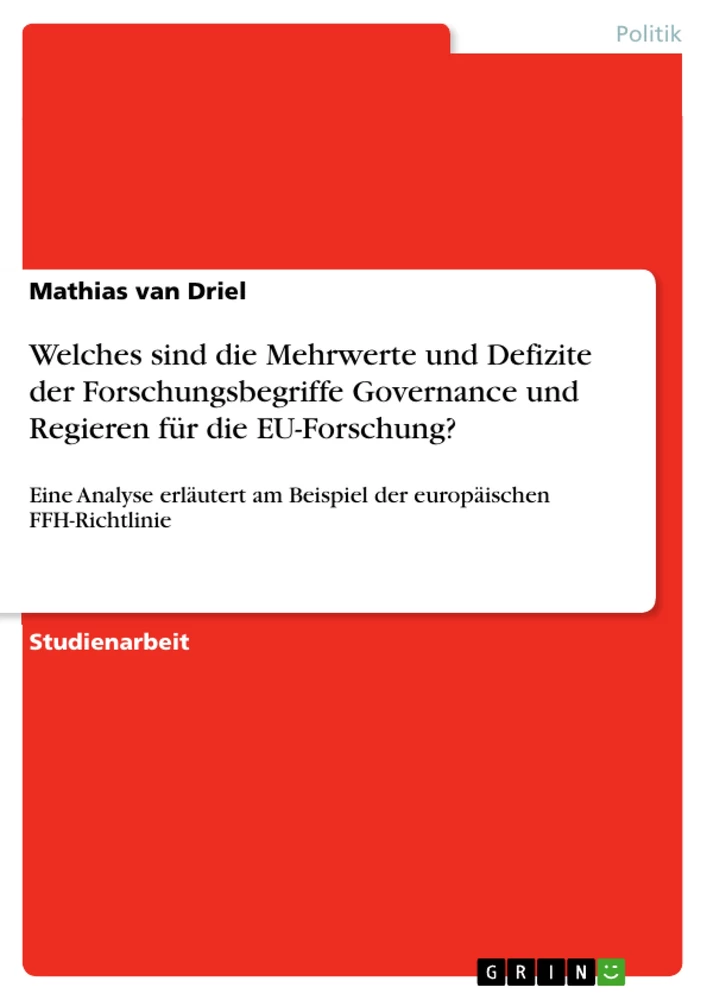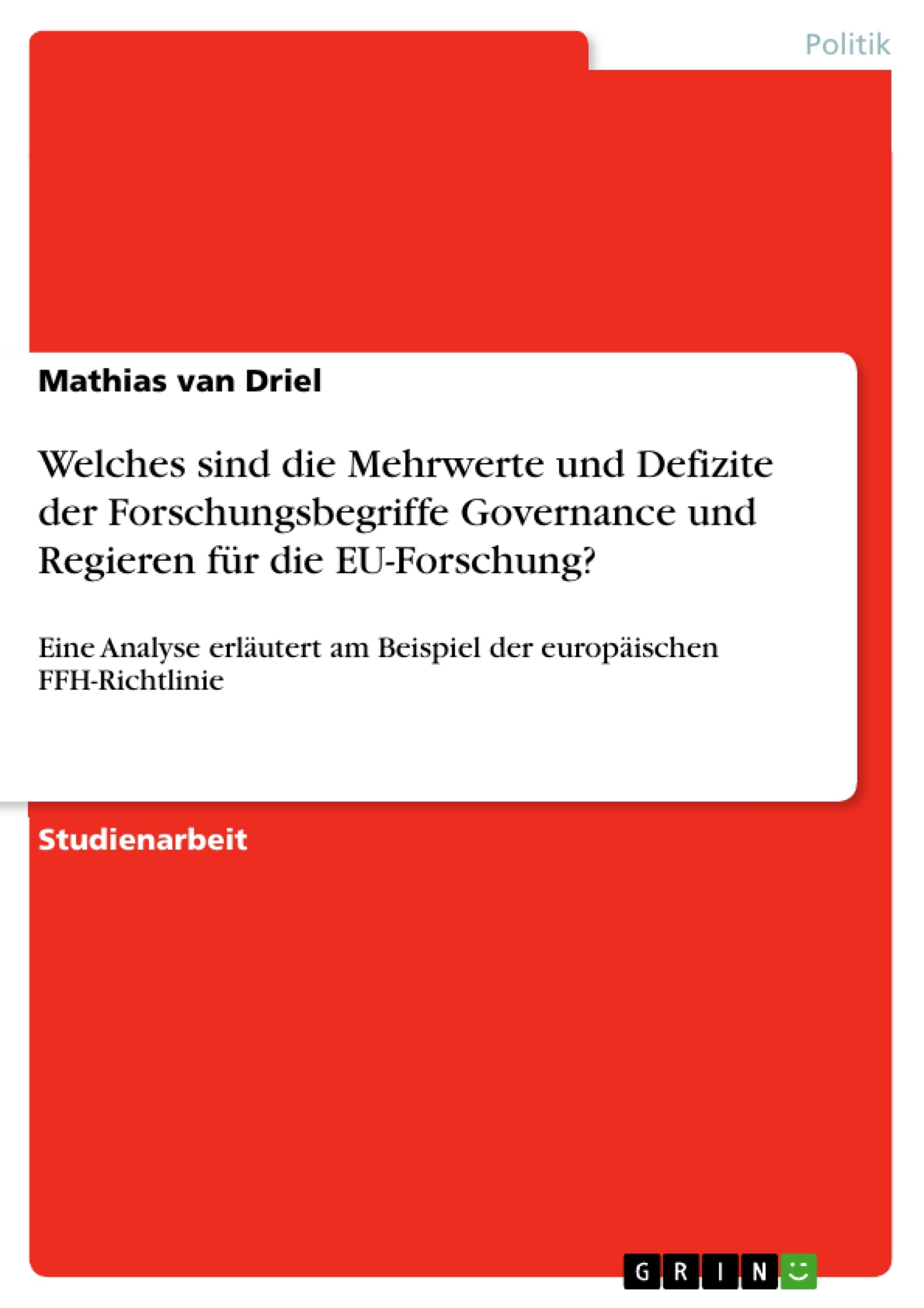Die vorliegende Arbeit liefert eine Bestandsaufnahme und Gegenüberstellung der Begriffe Governance und Regieren als Forschungsbegriffe der europäischen Politikforschung. Die Bearbeitung hat damit zum Ziel, beispielhaft über die Vor- und Nachteile dieser Begriffe als Forschungstermini des Gegenstands-bereichs der EU-Politik abzuwägen. Für das Forschungsfeld der EU ist die ständige Absicherung der Funktion und Anwendungsfähigkeit der hier zur Diskussion gestellten Begriffe von aktueller Relevanz: Mit steigender qualitativer Vertiefung der EU-Verträge zu einem in der Forschung so konstatierten politischen System eigener Art (Tömmel 2008 / Wessels 2008 / Hix 2005), stellen sich für die EU zunehmend steuerungs-technische Fragen und Probleme. Governance ist inzugedessen zu einem „omnipräsenten“ (Kohler-Koch / Rittberger 2006: 27) Leitkonzept von EU-Forschung avanciert1. Bemerkenswert ist dabei die weitverbreitete Etablierung von Governance als einem englischsprachigen Terminus in der deutschen Wissenschaftssprache. Diese Entwicklung legt die Annahme nahe, dass Governance-Begriffe adäquatere Zugänge zu Objektbereichen von EU-Politik zulassen, als es mit Hilfe klassischer Termini der deutschen Wissenschaftssprache gelingt. Diese Forschungsentwicklung kann auf den ersten Blick als Kritik an der forschungstechnischen Angemessenheit, allen voran, des zentralen deutsch-sprachigen Terminus Regieren gelesen werden, denn Regieren ist bisweilen als EU-Forschungsbegriff durch Governance ersetzt oder ausgetauscht worden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Governance und Regieren - Begriffsgenese und -abgrenzung
- Regieren - Begriffsgenese unter Berücksichtigung der EU-Forschung
- Governance - Begriffsgenese unter Berücksichtigung der EU-Forschung
- Zwischenbilanz und Gegenüberstellung der Begriffe
- Ausgewähltes Fallbeispiel - der FFH-Richtlineinprozess
- Die FFH-Richtlinie Inhalt und Problemstellung
- Verlauf der FFH-Richtlinie
- Initialisierung der Richtlinie
- Entscheidungsfindung und Agenda-Settig der FFH-Richtlinie
- Die Umsetzung der FFH-Richtlinie
- Absicherung der Richtlinie
- Betrachtung der Begriffe auf Basis des angeführten Fallbeispiel
- Governance als Analysezugang für die Betrachtung des Fallbeispiels
- Mehrwerte des Governance-Begriffes im Hinblick auf das Fallbeispiel
- Defizite des Governance-Begriffes im Hinblick auf das Fallbeispiel
- Regieren als Analysezugang des ausgewählten Fallbeispiels
- Mehrwerte des Regierungs-Begriffes im Hinblick auf das Fallbeispiel
- Defizite des Regierungs-Begriffes im Hinblick auf das Fallbeispiel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Begriffen Governance und Regieren im Kontext der europäischen Politikforschung. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile dieser Begriffe als Forschungstermini im Bereich der EU-Politik zu analysieren. Dabei werden die ständigen Anforderungen an die Funktion und Anwendungsfähigkeit der beiden Begriffe in der EU-Forschung untersucht, insbesondere im Hinblick auf die zunehmenden Steuerungsfragen und -probleme, die durch die qualitative Vertiefung der EU-Verträge entstehen.
- Die Begriffsgenese und -abgrenzung von Governance und Regieren im Kontext der EU-Forschung
- Die Analyse des Mehrwerts und der Defizite von Governance und Regieren als Analysezugänge für die EU-Politik
- Die Anwendung der beiden Begriffe anhand des Fallbeispiels der europäischen FFH-Richtlinie
- Die exemplarische Untersuchung von system- und handlungstheoretischen Problemen im Kontext der EU-Richtlinien
- Die Bedeutung von nationalen, supranationalen und internationalen formalen und informellen Dimensionen für die Umsetzung von EU-Richtlinien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor, welche sich mit den Vor- und Nachteilen der Begriffe Governance und Regieren als Forschungstermini für die EU-Politik befasst. Das erste Kapitel behandelt die Begriffsgenese und -abgrenzung von Governance und Regieren unter Berücksichtigung der EU-Forschung. Das zweite Kapitel analysiert die FFH-Richtlinie als Fallbeispiel und stellt die relevanten Aspekte für die Anwendung der beiden Begriffe dar. Im dritten Kapitel werden die Mehrwerte und Defizite von Governance und Regieren als Analysezugänge für die FFH-Richtlinie im Detail untersucht.
Schlüsselwörter
EU-Forschung, Governance, Regieren, FFH-Richtlinie, Politikforschung, Mehrwert, Defizit, Begriffsgenese, Anwendungsfähigkeit, Steuerungsfragen, System- und Handlungstheorie, nationale, supranationale und internationale Dimensionen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Governance und Regieren?
"Regieren" bezieht sich oft auf klassische hierarchische Strukturen des Staates. "Governance" umfasst auch informelle Netzwerke und das Zusammenwirken staatlicher und privater Akteure.
Warum ist Governance in der EU-Forschung so wichtig?
Da die EU kein klassischer Staat ist, hilft der Governance-Begriff dabei, die komplexen Steuerungsprozesse zwischen nationalen und supranationalen Ebenen besser zu verstehen.
Was sind die Mehrwerte des Governance-Begriffs?
Er ermöglicht einen adäquateren Zugang zu neuen Formen der politischen Steuerung, die über rein staatliche Hierarchien hinausgehen.
Welches Fallbeispiel wird in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert den Prozess der europäischen FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat), um die Begriffe Governance und Regieren in der Praxis zu vergleichen.
Was sind Defizite des Begriffs "Regieren" für die EU?
Klassische Regierungsbegriffe greifen oft zu kurz, wenn es darum geht, die Rolle nicht-staatlicher Akteure und weiche Steuerungsmechanismen in der EU zu erfassen.
Wie beeinflussen informelle Dimensionen die EU-Politik?
Informelle Absprachen und Netzwerke sind oft entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung von Richtlinien auf nationaler Ebene.
- Quote paper
- Mathias van Driel (Author), 2009, Welches sind die Mehrwerte und Defizite der Forschungsbegriffe Governance und Regieren für die EU-Forschung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153708