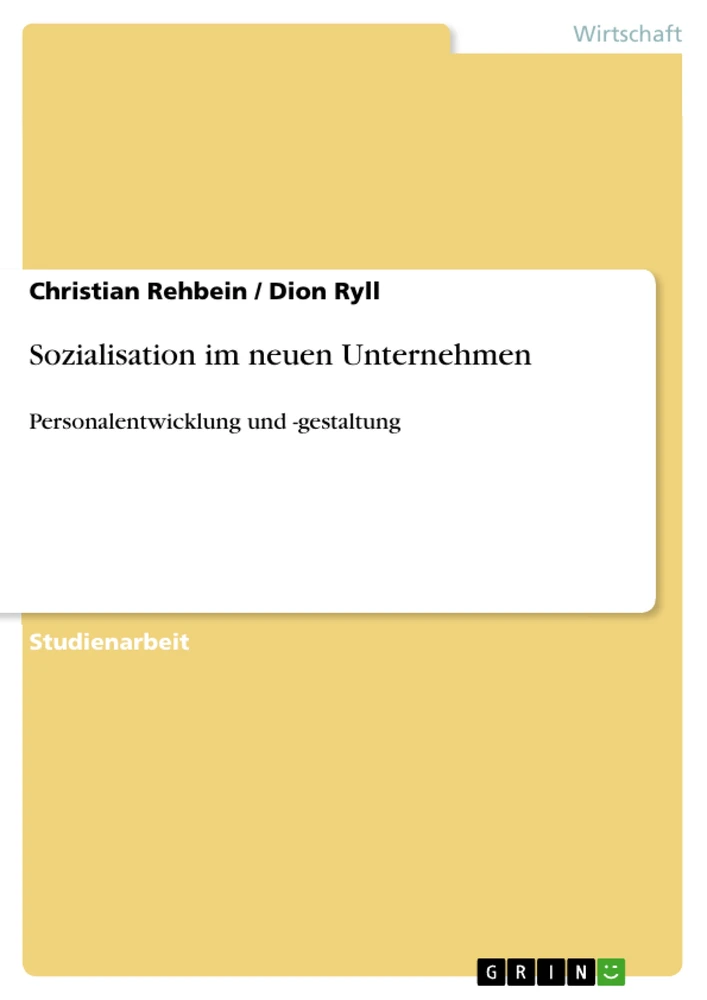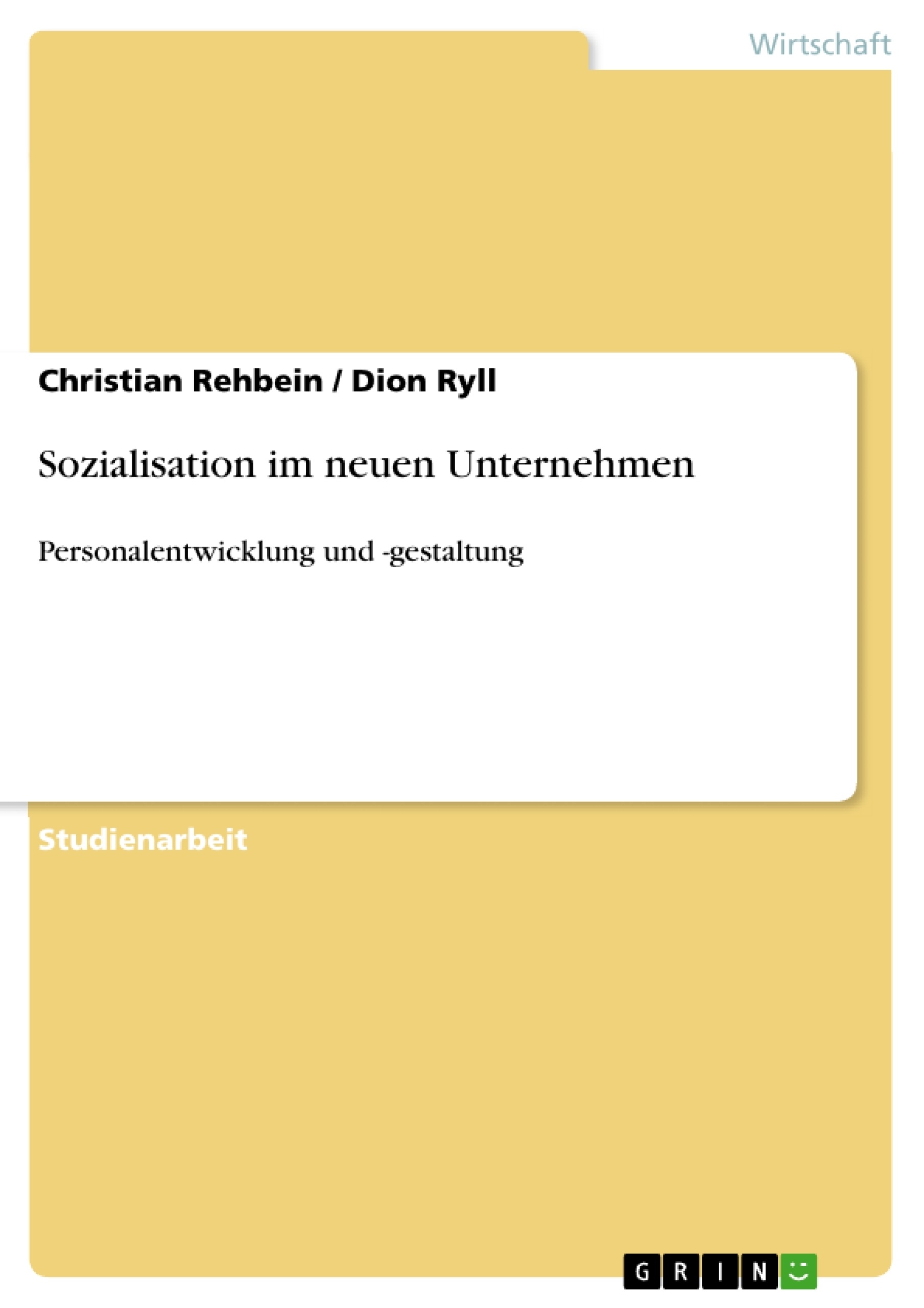In dieser Arbeit wird untersucht, ob betriebliche Sozialisation
als personalwirtschaftliche Maßnahme einen Effekt auf die Grundfunktionen Lernen, Leistung und Kooperation hat. Ausschlaggebend für die Grundidee dieser Arbeit ist,
dass in vielen Theorien und Modellen zur betrieblichen Sozialisation immer der Mitarbeiter als quantifizierbares „Betriebsmittel“ angesehen wird. Wir aber sehen den
Menschen als Persönlichkeit, der sich mit allen Realitätseinflüssen einzigartig auseinandersetzt.
Dazu wird die alte und neue Definition des Begriffs der Sozialisation aufgezeigt und deren Verbundenheit mit der jeweiligen Gesellschaftsauffassung herausgestellt, um
eine allgemeingültige Definition für diese Arbeit festzuhalten. Anschließend werden drei Annahmen der Sozialisationstheorie
vorgestellt, um einerseits ein grundlegendes Verständnis von Sozialisation aufzubauen und für diese Arbeit herauszustellen. Andererseits wird durch die Annahmen aufgezeigt, dass auch
Betriebe die Möglichkeit haben deren Mitglieder zu sozialisieren. In Punkt fünf wird die betriebliche Sozialisation aus Sicht des Unternehmens dargestellt und welche Dimensionen des Personalwesens bei der Gestaltung eine Rolle spielen. Im
Folgenden zeigt die Arbeit den Sozialisationsprozess nach Schein auf und beurteilt kritisch die Aussagekraft dieses Modells. Im weiteren Ablauf wird eine eigene Verknüpfung aus theoretischen Annahmen und praktischen Erfahrungen erarbeitet, mit dem Ziel Einflussfaktoren auf die betriebliche Sozialisation herauszustellen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Effektivität von personalwirtschaftlichen Eingriffen im Bezug auf die betriebliche Sozialisation aufzuweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff der Sozialisation - „von alt zu neu“
- Thesen „von der Definition zur Theorie“
- Betriebliche Sozialisation
- Der Prozess
- Verknüpfung - „Gibt es die richtige Sozialisation?“
- Was ist eine positive betriebliche Sozialisation
- Was ist eine negative betriebliche Sozialisation
- Fazit - Individuelle Probleme der Sozialisation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen betrieblicher Sozialisation als personalwirtschaftliche Maßnahme auf die Grundfunktionen Lernen, Leistung und Kooperation. Sie betrachtet den Menschen als Persönlichkeit, die sich mit allen Realitätseinflüssen einzigartig auseinandersetzt. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Begriffs der Sozialisation, stellt drei Annahmen der Sozialisationstheorie vor und analysiert die betriebliche Sozialisation aus Sicht des Unternehmens.
- Entwicklung des Begriffs der Sozialisation
- Annahmen der Sozialisationstheorie
- Betriebliche Sozialisation aus Unternehmenssicht
- Der Sozialisationsprozess nach Schein
- Einflussfaktoren auf die betriebliche Sozialisation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der betrieblichen Sozialisation ein und stellt die zentrale These der Arbeit dar: Der Mensch als Persönlichkeit im Kontext der Sozialisation. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von personalwirtschaftlichen Maßnahmen auf die Grundfunktionen Lernen, Leistung und Kooperation.
Begriff der Sozialisation - „von alt zu neu“
Dieses Kapitel diskutiert die Entwicklung des Begriffs der Sozialisation von seiner ursprünglichen Definition durch Emile Durkheim bis hin zu einer modernen, erweiternden Interpretation. Es werden die gesellschaftlichen Veränderungen aufgezeigt, die eine Anpassung des Begriffs notwendig machten.
Thesen - „von der Definition zur Theorie“
Dieses Kapitel stellt drei Annahmen der Sozialisationstheorie vor, die als Grundlage für die Analyse der betrieblichen Sozialisation dienen. Es wird die dynamisch-produktive Natur der Persönlichkeitsentwicklung, die sich aus der inneren und äußeren Realität ergibt, erläutert.
Betriebliche Sozialisation
Dieses Kapitel befasst sich mit der betrieblichen Sozialisation aus Sicht des Unternehmens und den relevanten Dimensionen des Personalwesens. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Gestaltung der Sozialisation im Unternehmen beleuchtet.
Der Prozess
Dieses Kapitel präsentiert den Sozialisationsprozess nach Schein und beurteilt dessen Aussagekraft kritisch. Es wird eine eigene Verknüpfung aus theoretischen Annahmen und praktischen Erfahrungen entwickelt, um Einflussfaktoren auf die betriebliche Sozialisation herauszustellen.
Verknüpfung - „Gibt es die richtige Sozialisation?“
Dieses Kapitel analysiert die positiven und negativen Auswirkungen von betrieblicher Sozialisation. Es werden konkrete Beispiele und Fallstudien herangezogen, um die verschiedenen Facetten der betrieblichen Sozialisation aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Sozialisation, betriebliche Sozialisation, Persönlichkeitsentwicklung, Lernen, Leistung, Kooperation, Einflussfaktoren, Personalwirtschaft, Unternehmenskultur, Sozialisationsinstanzen, Realität, genetische Veranlagung, innerer Realität, äußere Realität. Sie untersucht die Auswirkungen von personalwirtschaftlichen Maßnahmen auf die Grundfunktionen des Menschen und die Bedeutung der individuellen Persönlichkeit im Prozess der Sozialisation.
- Citation du texte
- Christian Rehbein (Auteur), Dion Ryll (Auteur), 2009, Sozialisation im neuen Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153776