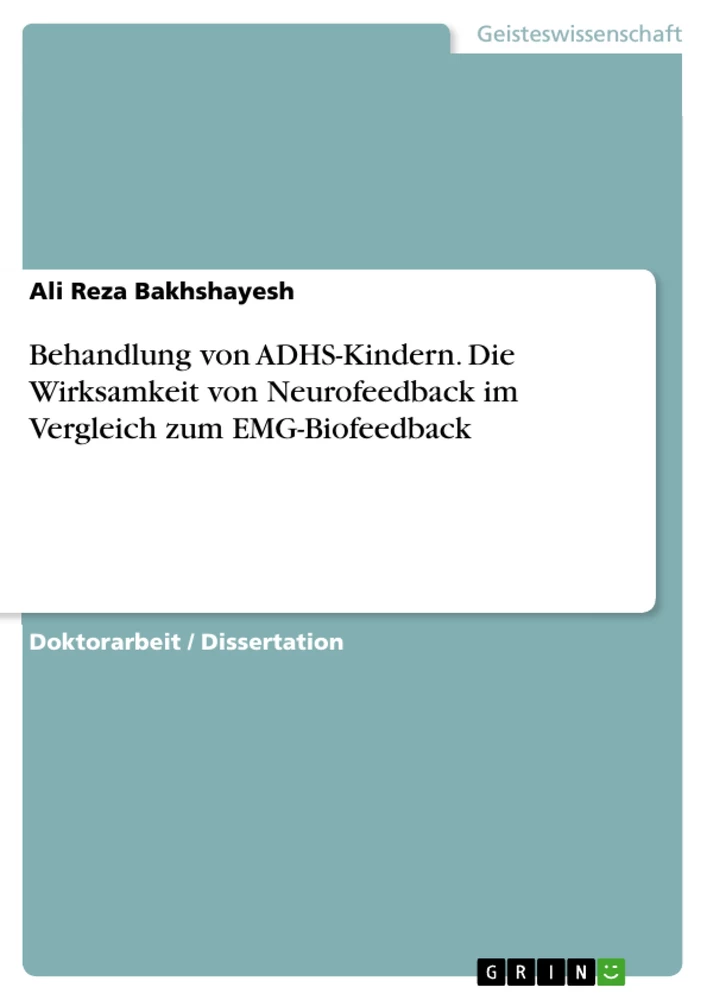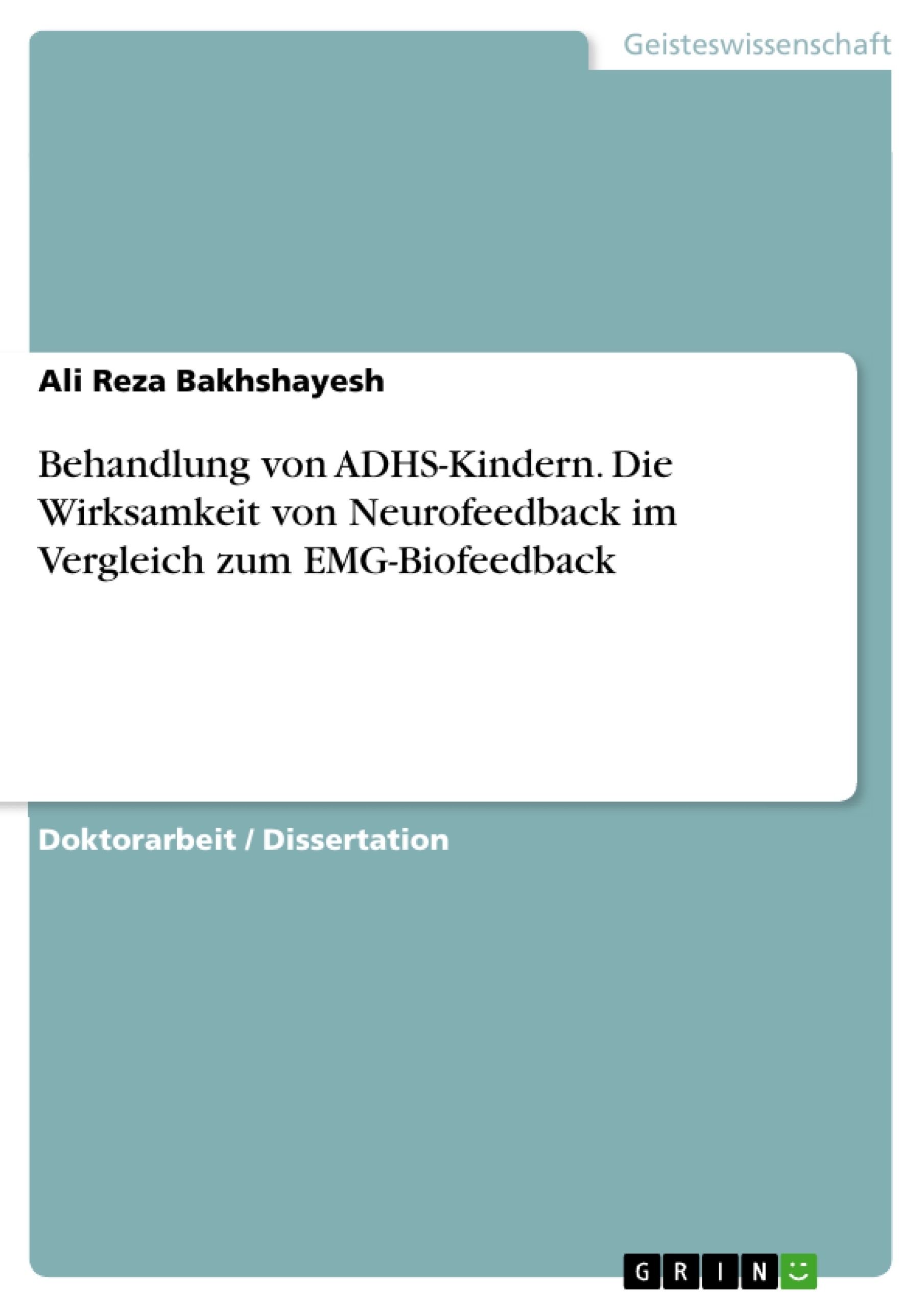Seit vier Jahrzehnten werden verschiedene Neurofeedbackmethoden bei der Behandlung unterschiedlicher Störungen, unter anderem bei AD/HS-Kindern, eingesetzt. Die Grundlage der Anwendung von Neurofeedback bei dieser Störung besteht darin, dass die Kinder Auffälligkeiten in ihrem EEG zeigen. Dort treten im Vergleich zu unauffälligen Kindern vermehrt Theta-Gehirnwellen und weniger Beta-Gehirnwellen auf. Mittels Neurofeedback wird versucht, die Gehirnfunktionen zu korrigieren. Zahlreiche Einzelfallstudien bestätigen die Wirksamkeit dieser Therapiemethode bei der AD/HS-Behandlung. Bisher wurde jedoch keine Studie veröffentlicht, in der die Wirksamkeit von Neurofeedback mit einer Placebogruppe verglichen wurde. Ziel der vorliegenden Studie war es, die Wirksamkeit eines Theta/Beta-Neurofeedbacks (NF) bei der Behandlung von AD/HS-Kindern zu überprüfen und mit einem EMG-Biofeedback (BF) als Placebobedingung zu vergleichen.
Es wurden 35 ADHS-Kinder (6 -14 Jahre; 26 Jungen und 9 Mädchen) untersucht. Nach Standarddiagnostik und Vergabe der AD/HS-Diagnose durch einen unabhängigen Psychotherapeuten wurden die Kinder per Zufall zwei Gruppen (NF: n = 18 bzw. BF: n = 17) zugeteilt. Alle Kinder beider Gruppen erhielten ein 30 Sitzungen umfassendes Training mittels Theta/Beta-Neurofeedback bzw. EMG-Biofeedback. Unmittelbar vor und nach dem Training wurden Intelligenz- bzw. Aufmerksamkeitsleistungen untersucht und Einschätzungen des Verhaltens von Eltern und Lehrern erhoben. Im Anschluss an das Training erfolgte eine erneute diagnostische Einschätzung durch einen unabhängigen Psychotherapeuten.
Die EEG-Daten in der NF-Gruppe zeigen eine Reduktion der Theta/Beta-Quotienten im Laufe der NF-Sitzungen. Die EMG-Daten zeigen für die EMG-Biofeedback-Bedingung gleichfalls eine Reduktion der EMG-Amplitude. Die Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung auf einem Faktor zeigen für die angewendeten diagnostischen Verfahren die erwarteten signifikanten Interaktionen zwischen Messzeitpunkt und Gruppe. Die Ergebnisse des t-Tests zeigen signifikante Verbesserungen in der Aufmerksamkeitsleistung, dem Intelligenzniveau und im Verhalten der Kinder aus der NF-Gruppe im Vergleich zu den Resultaten des Prä-Tests. Die EMG-Biofeedbackgruppe zeigt mit Ausnahme einer Erhöhung des Arbeitstempos in den Paper-Pencil-Aufmerksamkeitstests (die im CPT nicht repliziert werden konnte) keine signifikanten Verbesserungen relativ zum Prä-Test.[...]
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Theorie
- 1. Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- 1.1. Definition
- 1.2. ADHS-Diagnose
- 1.2.1. Alters-, Geschlechts-, und Komorbiditätsunterschiede bei der ADHS-Diagnose
- 1.2.2. Psychophysiologische vs. psychometrische Auswertungen bei der ADHS-Diagnose
- 1.2.3. Differentialdiagnose
- 1.3. Prävalenz
- 1.3.1. ADHS: Geschlechtsunterschiede
- 1.3.2. ADHS-Prävalenz und Lehrer-Einschätzungen
- 1.4. Komorbidität
- 1.5. Ätiologie
- 1.5.1. „Schlechtes-Kind“-Theorie
- 1.5.2. Disharmonische Familie
- 1.5.3. Elterliche Schwäche
- 1.5.4. Umwelt- und allergische Faktoren
- 1.5.5. Genetische Faktoren
- 1.5.6. Hirnschädigung
- 1.5.7. Hirnkreislauf und Hirnmetabolismus
- 1.5.8. Elektroenzephalogramm (EEG)
- 1.6. Aufmerksamkeit und Arousalniveau
- 2. ADHS-Behandlung
- 2.1. Medikamentöse Behandlung
- 2.1.1. Psychostimulanzien
- 2.1.2. Nebenwirkungen
- 2.1.3. Anwendung anderer Medikamente bei der ADHS-Behandlung
- 2.1.4. Kritik an der medikamentösen Behandlung bei ADHS-Patienten
- 2.2. Verhaltenstherapie
- 2.2.1. Medikamentöse Behandlungen in Kombination mit verhaltenstherapeutischen Methoden
- 2.3. Alternative Therapiemethoden
- 2.3.1. Kognitive Verhaltenstherapie
- 2.3.2. Diät
- 2.3.3. Yoga
- 2.4. Therapieerfolg bei Standard- und alternativen Behandlungen
- 3. Biofeedback
- 3.1. Geschichte des Biofeedbacks
- 3.2. Biofeedbackarten
- 3.3. EEG-Biofeedback/ Neurofeedback/ Neurotherapie
- 3.3.1. Neurofeedback in der ADHS-Behandlung
- 3.3.2. Neurofeedbackwirkungen auf psychologische, physiologische, und neurologische Parameter
- 3.3.3. Neurofeedback in Kombination mit anderen Methoden bei der ADHS-Behandlung
- 3.3.3.1. Neurofeedback in Kombination mit Musik
- 3.3.3.2. Neurofeedback in Kombination mit virtueller Realität
- 3.3.3.3. Neurofeedback in Kombination mit Schulaufgaben
- 3.3.3.4. Neurofeedback in Kombination mit metakognitiven Strategien
- 3.3.3.5. Neurofeedback in Kombination mit EMG-Biofeedback
- 3.3.3.6. Neurofeedback in Kombination mit medikamentösen Behandlungen
- 3.3.4. Anwendung von Neurofeedback in einer Schulsituation
- 3.3.5. Probleme bisheriger Forschungsarbeiten zum Neurofeedback an ADHS-Patienten
- III Methode
- 1. Fragestellungen und Hypothesen
- 2. Die Anwendung einer Placebogruppe
- 3. Design und Zeitplan
- 4. Statistische Verfahren
- 5. Messinstrumente
- 5.1. Tests
- 5.1.1. Intelligenztests
- 5.1.1.1. Standardform der progressiven Matrizen (SPM), Raven
- 5.1.1.2. CPM-Farbige Matrizen, Raven
- 5.1.2. Aufmerksamkeitstests
- 5.1.2.1. bp-Test
- 5.1.2.2. Test d2 (Aufmerksamkeits-Belastungstest)
- 5.1.2.3. Continuous Performance Task (CPT)
- 5.2. Fragebogen
- 5.2.1. Fremdbeurteilungsbogen für hyperkinetische Störungen (FBB-HKS)
- 5.2.2. Mannheimer Elternfragebogen (MEF)
- 6. Institutioneller Rahmen und Patienten
- 7. Elterngespräch
- 8. Therapieprogramm
- 8.1. Biofeedback und dessen Software
- 8.1.1. NeXus-10
- 8.1.2. BioTrace+
- 8.1.3. Theta/Beta-Neurofeedbackprotokoll
- 8.2. Die Elektroden
- 8.2.1. Die Elektroden in der Neurofeedbackgruppe
- 8.2.1.1. Aktive Elektroden
- 8.2.1.2. Referenzelektrode
- 8.2.2. Elektroden in der EMG-Biofeedbackgruppe
- 8.2.2.1. Aktive Elektroden
- 8.2.2.2. Referenzelektrode
- 8.3. Elektrodenplatzierung
- 8.3.1. Elektrodenplatzierung in der Neurofeedbackgruppe
- 8.3.2. Elektrodenplatzierung in der EMG-Biofeedbackgruppe
- 8.4. Therapiesitzungen und deren Ziele
- 8.5. Eine exemplarische Therapiesitzung
- 8.5.1. Neurofeedbacksitzungen
- 8.5.2. EMG-Biofeedbacksitzungen
- IV Ergebnisse
- 1. Drop-out
- 2. Daten aus den Therapiesitzungen
- 2.1. EEG-Daten
- 2.2. EMG-Daten
- 3. Fragebogen-Daten
- 3.1. Mannheimer Eltern Fragebogen (MEF)
- 3.2. Fremdbeurteilungsbogen- hyperkinetische Störung (FBB-HKS)
- 3.2.1. Elterneinschätzungen im Fremdbeurteilungsbogen- hyperkinetische Störung (FBB-HKS)
- 3.2.2. Lehrereinschätzungen im Fremdbeurteilungsbogen- hyperkinetische Störung (FBB-HKS)
- 4. Daten der Leistungstests
- 4.1. Intelligenztest
- 4.2. Aufmerksamkeitstests
- 4.2.1. Paper-Pencil-Aufmerksamkeitstests (bp/ d2)
- 4.2.2. Continuous Performance Task (CPT)
- 5. Diagnose
- V Diskussion
- 1. Zielsetzung
- 2. EEG-Daten und Neurofeedbacksitzungen
- 3. EMG-Daten und EMG-Biofeedbacksitzungen
- 4. Beurteilungen
- 4.1. Elternbeurteilungen
- 4.1.1. Mannheimer Elternfragebogen (MEF)
- 4.1.2. Elternurteil im Fremdbeurteilungsbogen-hyperkinetische Störung (FBB-HKS)
- 4.2. Lehrerbeurteilung
- 5. Testdaten
- 5.1. Intelligenz
- 5.2. Aufmerksamkeit
- 6. Klinische Verbesserungen
- 7. Spezifische Wirkfaktoren
- 8. Überlegen zur Anwendung des EMG-Biofeedbacks als Placebobedingung
- 9. Anregungen für weitere Neurofeedbackuntersuchungen
- VI Literatur
- VII Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Dissertation untersucht die Wirksamkeit von Theta/Beta-Neurofeedback im Vergleich zu EMG-Biofeedback bei der Behandlung von ADHS-Kindern. Hauptziel ist der Vergleich der beiden Methoden unter kontrollierten Bedingungen, um spezifische Effekte des Neurofeedbacks von unspezifischen Einflüssen zu trennen und methodische Mängel vorheriger Studien zu vermeiden.
- Wirksamkeit von Neurofeedback bei ADHS
- Vergleich von Neurofeedback und EMG-Biofeedback als Placebokontrolle
- Identifizierung spezifischer Wirkfaktoren von Neurofeedback
- Analyse der Auswirkungen auf kognitive Leistungen und Verhalten
- Methodologische Verbesserungen in der ADHS-Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ein, beschreibt deren Ausprägungen und die damit verbundenen Schwierigkeiten in verschiedenen Lebensbereichen. Es werden die gängigen Behandlungsmethoden (medikamentös und verhaltenstherapeutisch) sowie deren Limitationen vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit alternativer Behandlungsansätze wie Neurofeedback und den methodischen Schwächen bisheriger Studien zu diesem Thema. Die vorliegende Studie wird als Versuch zur Verbesserung der methodischen Ansätze vorgestellt.
II Theorie: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur ADHS. Es werden Definition, Diagnose, Prävalenz, Komorbidität und Ätiologie der Störung detailliert beleuchtet. Es werden verschiedene Theorien zur Entstehung von ADHS diskutiert, einschließlich genetischer, umweltbedingter und neurologischer Faktoren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von EEG-Befunden bei ADHS-Kindern und der Bedeutung des Arousalniveaus. Des Weiteren werden die gängigen Behandlungsmethoden, ihre Wirkmechanismen und ihre Limitationen im Detail beschrieben. Abschließend wird der aktuelle Stand der Forschung zum Biofeedback, insbesondere Neurofeedback, im Zusammenhang mit ADHS präsentiert, inklusive einer kritischen Auseinandersetzung mit methodischen Schwächen bisheriger Studien.
III Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten Studie. Es werden die Forschungsfragen und Hypothesen formuliert. Die Wahl des EMG-Biofeedbacks als Placebokontrolle wird begründet und das Studiendesign (randomisierte kontrollierte Studie) detailliert erläutert. Es wird der Ablaufplan der Studie und die verwendeten Messinstrumente (Intelligenztests, Aufmerksamkeitstests, Fragebögen) präzise beschrieben. Die statistischen Methoden zur Auswertung der Daten werden ebenfalls erläutert.
IV Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Zuerst wird der Drop-out beschrieben. Es folgen die Ergebnisse aus den Therapiesitzungen (EEG- und EMG-Daten), den Fragebogen (MEF und FBB-HKS) und den Leistungstests (Intelligenztests, Aufmerksamkeitstests). Die Ergebnisse werden mit Hilfe von Tabellen und Abbildungen anschaulich dargestellt und statistisch auf ihre Signifikanz geprüft.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Neurofeedback, EMG-Biofeedback, EEG, Theta-Wellen, Beta-Wellen, Aufmerksamkeit, Impulsivität, Hyperaktivität, kognitive Leistungen, Verhaltenstherapie, Placebokontrolle, Wirksamkeit, randomisierte kontrollierte Studie, Effektstärke.
Häufig gestellte Fragen zur Dissertation: Wirksamkeit von Neurofeedback bei ADHS
Was ist das Thema der Dissertation?
Die Dissertation untersucht die Wirksamkeit von Theta/Beta-Neurofeedback im Vergleich zu EMG-Biofeedback bei der Behandlung von Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Das Hauptziel ist der Vergleich der beiden Methoden unter kontrollierten Bedingungen, um spezifische Effekte des Neurofeedbacks von unspezifischen Einflüssen zu trennen und methodische Mängel vorheriger Studien zu vermeiden.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie ist eine randomisierte kontrollierte Studie. Es wurden verschiedene Messinstrumente eingesetzt, darunter Intelligenztests (SPM, CPM), Aufmerksamkeitstests (bp-Test, d2, CPT), und Fragebögen (MEF, FBB-HKS, sowohl für Eltern als auch Lehrer). Die EEG- und EMG-Daten aus den Therapiesitzungen wurden ebenfalls analysiert. Das Neurofeedback wurde mit dem System NeXus-10 und BioTrace+ durchgeführt, wobei ein Theta/Beta-Protokoll angewendet wurde.
Welche Hypothesen wurden untersucht?
Die Dissertation formuliert spezifische Forschungsfragen und Hypothesen bezüglich der Wirksamkeit von Neurofeedback im Vergleich zu EMG-Biofeedback bei ADHS. Genauer wird untersucht, ob Neurofeedback zu signifikanten Verbesserungen in kognitiven Leistungen, Verhalten und subjektiven Beurteilungen (Eltern, Lehrer) führt im Vergleich zur EMG-Biofeedback-Kontrollgruppe. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung spezifischer Wirkfaktoren des Neurofeedbacks.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Studie werden detailliert in Kapitel IV präsentiert. Dies beinhaltet Daten zum Drop-out, EEG- und EMG-Daten aus den Therapiesitzungen, Ergebnisse der Fragebögen (MEF und FBB-HKS von Eltern und Lehrern) und der Leistungstests (Intelligenz- und Aufmerksamkeitstests). Die statistische Signifikanz der Ergebnisse wird geprüft und durch Tabellen und Abbildungen veranschaulicht.
Wie wurde die Placebokontrolle gestaltet?
Als Placebokontrolle wurde EMG-Biofeedback verwendet. Die Wahl dieser Methode wird in Kapitel III begründet. Der Vergleich von Neurofeedback und EMG-Biofeedback erlaubt es, die spezifischen Effekte des Neurofeedbacks von unspezifischen Einflüssen (z.B. Aufmerksamkeit durch die Therapiesitzungen) zu trennen.
Welche Schlussfolgerungen wurden gezogen?
Kapitel V (Diskussion) fasst die Ergebnisse zusammen, interpretiert sie im Kontext des aktuellen Forschungsstands und zieht Schlussfolgerungen bezüglich der Wirksamkeit von Neurofeedback bei ADHS. Es wird diskutiert, welche spezifischen Wirkfaktoren zum Erfolg des Neurofeedbacks beigetragen haben könnten, und es werden Vorschläge für zukünftige Forschungsarbeiten gemacht.
Welche Kapitel beinhaltet die Dissertation?
Die Dissertation umfasst folgende Kapitel: I Einleitung, II Theorie (inklusive detaillierter Informationen zu ADHS, Behandlungsmethoden und Biofeedback), III Methode (Beschreibung des Studiendesigns, der Messinstrumente und der statistischen Verfahren), IV Ergebnisse (Präsentation der Daten), V Diskussion (Interpretation der Ergebnisse und Schlussfolgerungen) und VI Literaturverzeichnis sowie VII Anhang.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Dissertation am besten?
Schlüsselwörter sind: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Neurofeedback, EMG-Biofeedback, EEG, Theta-Wellen, Beta-Wellen, Aufmerksamkeit, Impulsivität, Hyperaktivität, kognitive Leistungen, Verhaltenstherapie, Placebokontrolle, Wirksamkeit, randomisierte kontrollierte Studie, Effektstärke.
- Citar trabajo
- Ali Reza Bakhshayesh (Autor), 2007, Behandlung von ADHS-Kindern. Die Wirksamkeit von Neurofeedback im Vergleich zum EMG-Biofeedback, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153798