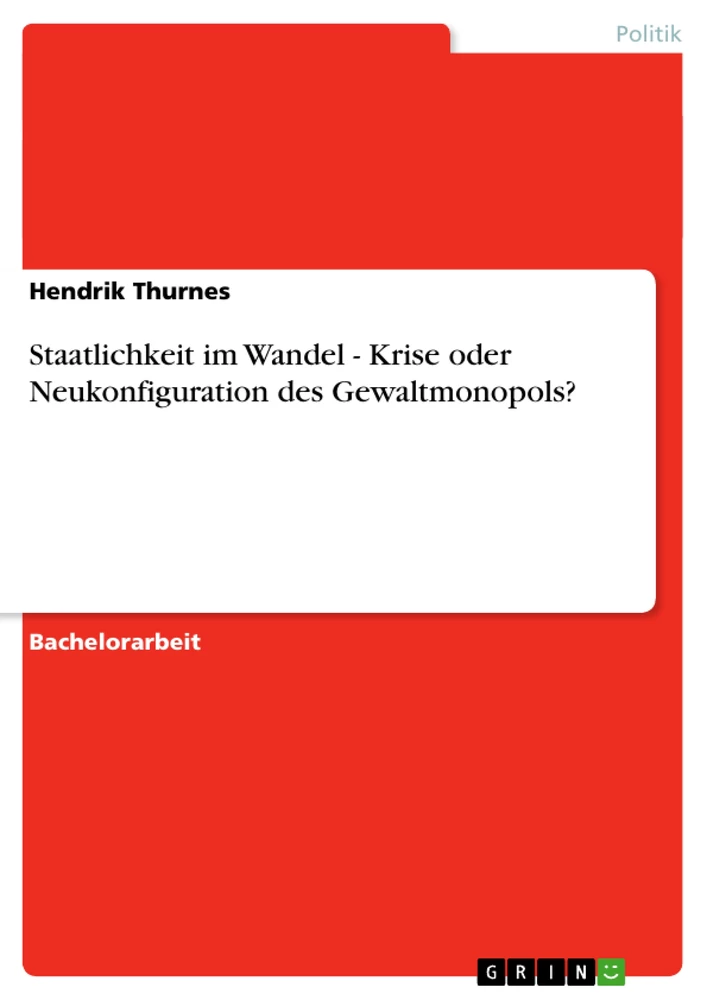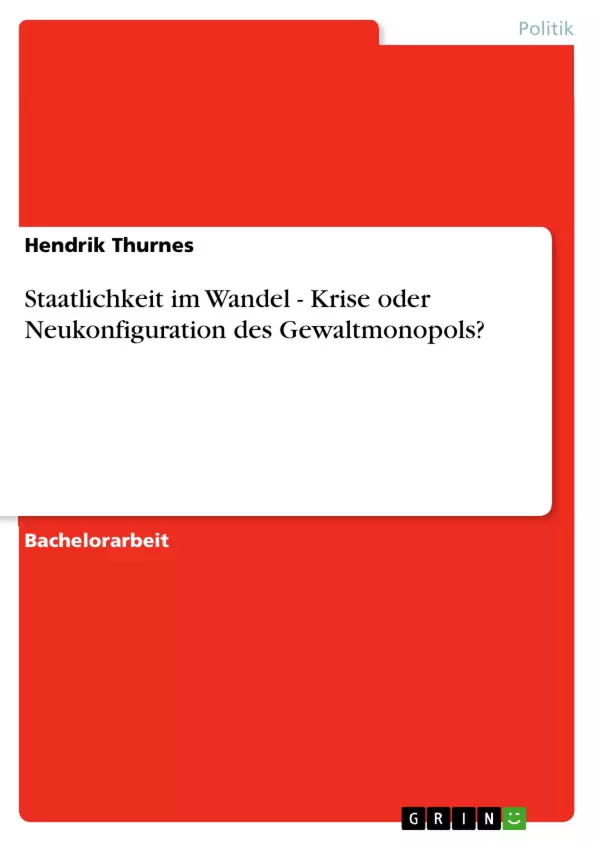Mit der Frage nach der Transformation von Staatlichkeit greift der Verfasser eine komplexe, in den gegenwärtigen Politik- und Sozialwissenschaften, vor allem auch in den neueren Entwicklungen in den Internationalen Beziehungen, der Friedens- und Konfliktforschung höchst kontrovers geführte und äußerst voraussetzungsreiche Debatte auf. Der Verfasser dokumentiert in einer sehr beeindruckenden Weise, dass er mit wesentlichen Themen und Positionen der Debatte vertraut ist und den Anspruch erhebt, eine eigenständige Position zu der Frage zu begründen, ob die in der jüngeren Diskussion unter dem Label des "Westpahlian State" subsumierten Strukturen moderner Staatlichkeit unter dem Druck neuer sozialer und globaler Entwicklungen und Akteure an ihr historisches Ende gekommen sind und sich folglich eine Art Epochenbruch vollzieht. Den Dreh- und Angelpunkt dieser Diskussion sieht der Verfasser dabei im Gewaltmonopol, insofern das Monopol physischer Gewalt als grundlegendste Funktion von Staaten angesehen wird. Dabei stellt sich der Verfasser in die Tradition einer spezifischen Lesart u.a. der Hobbes'schen Theorie, deren ebenso spezifisches Staatsverständnis für die Arbeit leitend ist. Der Staat wird als (in der Moderne privilegierter bzw. einziger) Gewaltakteur verstanden, der mit der Fähigkeit, sich auf je spezifischen Territorien als einziger Gewalthaber durchzusetzen, (ent-)steht und fällt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. GESELLSCHAFTS- UND STAATSTHEORETISCHE GRUNDLEGUNGEN
- 2.1 MACHTKÄMPFE
- 2.2 GEWALT
- 2.3 GENESE MODERNER STAATLICHKEIT
- 3. STAATLICHKEIT IM WANDEL
- 3.1 GEWALT IN DEN ENTWICKLUNGSLÄNDERN
- 3.1.1 DAS MOSAIK DER GEWALT
- 3.1.2 DIE POLITISCHE ÖKONOMIE VON GEWALTAKTEUREN
- 3.1.3 HERRSCHAFT IN RÄUMEN BEGRENZTER STAATLICHKEIT
- 3.2 TRANSFORMATIONEN DES MODERNEN GEWALTMONOPOLS
- 3.2.1 BEDEUTUNGSVERLUST DES NATIONALSTAATES
- 3.2.2 DIE PRIVATISIERUNG DER GEWALT
- 3.1 GEWALT IN DEN ENTWICKLUNGSLÄNDERN
- 4. KRISE ODER NEUKONFIGURATION?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Transformationsprozesse von Staatlichkeit, insbesondere in Bezug auf das staatliche Gewaltmonopol. Sie untersucht, ob der Wandel von Staatlichkeit zu einer Krise oder Neukonfiguration des Gewaltmonopols führt.
- Die Genese moderner Staatlichkeit und ihre theoretischen Grundlagen
- Die Rolle des Gewaltmonopols in der modernen Staatlichkeit
- Transformationsprozesse von Staatlichkeit in Entwicklungsländern und Industrieländern
- Die Auswirkungen von Globalisierung auf das staatliche Gewaltmonopol
- Die Debatte um das Ende der Moderne und die Frage nach dem Fortbestand des Gewaltmonopols
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung von Staatlichkeit im Wandel für das staatliche Gewaltmonopol. Kapitel 2 behandelt die gesellschaftlichen und staatstheoretischen Grundlagen, indem es sich mit den Konzepten von Macht, Gewalt und der Entstehung moderner Staatlichkeit auseinandersetzt. Kapitel 3 untersucht die Transformationen von Staatlichkeit sowohl in Entwicklungsländern als auch in Industrieländern. Hier werden verschiedene Formen von Gewalt und die Herausforderungen des Gewaltmonopols in verschiedenen Kontexten beleuchtet. Kapitel 4 befasst sich mit der Debatte um die Krise oder Neukonfiguration des staatlichen Gewaltmonopols im Kontext des Wandels von Staatlichkeit. Es werden verschiedene Perspektiven auf den Wandel von Staatlichkeit und die Folgen für das Gewaltmonopol diskutiert.
Schlüsselwörter
Staatlichkeit, Gewaltmonopol, Transformationsprozesse, Entwicklungsländer, Industrieländer, Globalisierung, Moderne, Postmoderne, Governance, Privatisierung von Sicherheit, responsibility to protect.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die "Transformation von Staatlichkeit"?
Es beschreibt den Wandel klassischer staatlicher Strukturen, wie des "Westfälischen Staates", unter dem Druck von Globalisierung und neuen sozialen Entwicklungen.
Was ist das staatliche Gewaltmonopol?
Es ist die grundlegende Funktion des Staates, als einziger Akteur physische Gewalt auf seinem Territorium rechtmäßig auszuüben und durchzusetzen.
Was sind "Räume begrenzter Staatlichkeit"?
Dies sind Gebiete, oft in Entwicklungsländern, in denen der Staat sein Gewaltmonopol nicht mehr vollständig durchsetzen kann und andere Akteure Herrschaft ausüben.
Führt die Privatisierung von Sicherheit zur Krise des Staates?
Die Arbeit diskutiert, ob die zunehmende private Sicherheitsvorsorge das staatliche Monopol aushöhlt oder lediglich zu einer Neukonfiguration von Staatlichkeit führt.
Was besagt die Hobbes'sche Theorie in diesem Kontext?
Der Staat wird nach Hobbes als privilegierter Gewaltakteur verstanden, dessen Existenz mit der Fähigkeit steht und fällt, Sicherheit auf einem Territorium zu garantieren.
- Citar trabajo
- Dipl. Verwaltungswirt (FH) Hendrik Thurnes (Autor), 2010, Staatlichkeit im Wandel - Krise oder Neukonfiguration des Gewaltmonopols?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153820