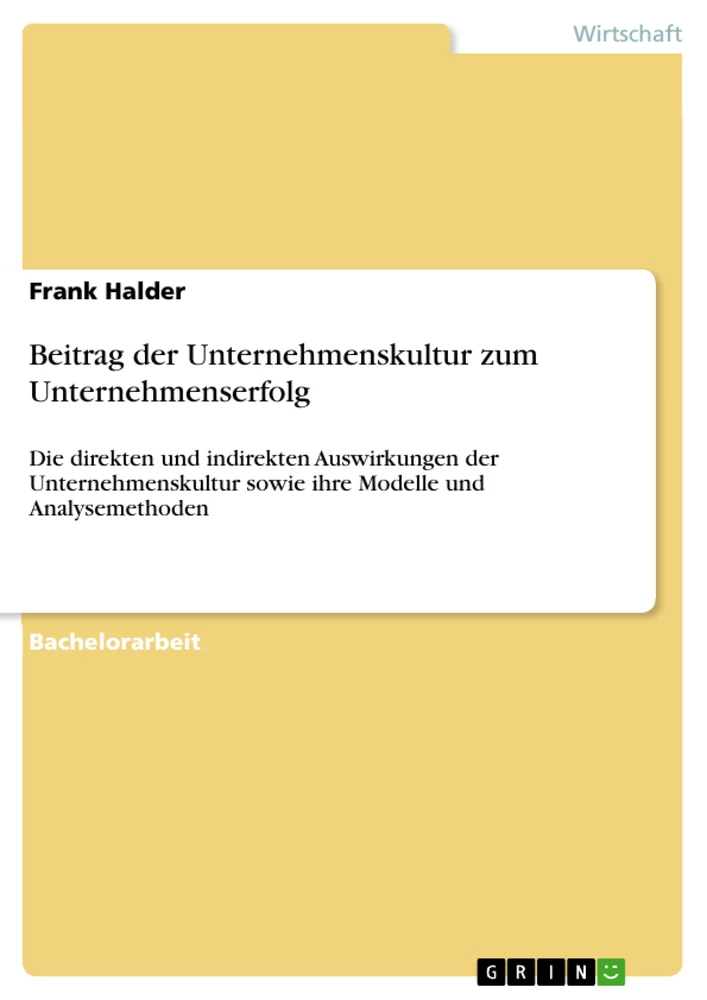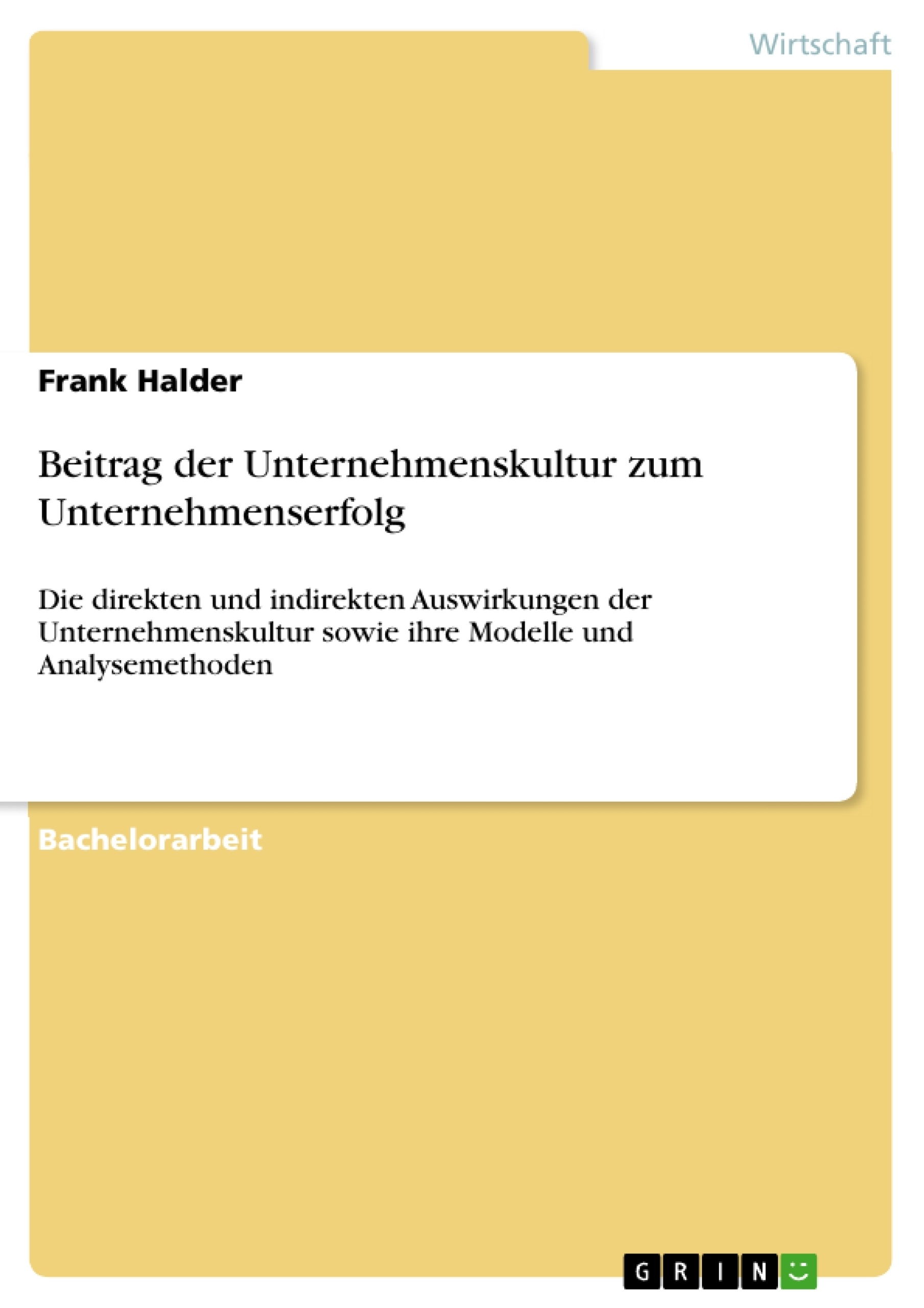Vor dem Hintergrund der zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Unternehmen rückt die Frage nach dem Konzept einer erfolgreichen Unternehmenskultur zunehmend in den Fokus des Interesses. Die vorliegende Arbeit thematisiert den Einfluss der Unternehmenskultur auf den Erfolg unter Berücksichtigung intervenierender Variablen. Hierzu wurden zuerst die Begriffe „Kultur“ und „Unternehmen“ getrennt voneinander analysiert, um darauf aufbauend das Konstrukt Unternehmenskultur näher erläutern zu können. Durch verschiedene Modelle sollte dabei zusätzlich die Komplexität über das Phänomen Kultur in Unternehmen reduziert werden. Des Weiteren wurden unterschiedliche Forschungsrichtungen aufgezeigt und Methoden zur Erhebung vorgestellt. Die Ergebnisse einiger quantitativer und qualitativer Studien belegen, dass die Unternehmenskultur einen bedeutenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg ausübt und dass es vermittelnde Variablen gibt, die diesen Erfolg begünstigen. Aufgrund der Ergebnisse haben sich die Kulturdimensionen Mitarbeiterorientierung, Kundenorientierung, Anpassungsfähigkeit, Unternehmertum und Führungskultur als förderlich für den Erfolg herauskristallisiert. Als Fazit zeigte sich, dass die Forschung hier noch am Anfang steht und weitere theoretische und praktische Untersuchungen zur Klärung folgen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitender Teil
- 1. Problemstellung
- 1.1 Globalisierung
- 1.2 Demografische Entwicklung
- 1.3 Wertewandel
- 1.4 Technische Entwicklung
- 2. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 3. Anfänge der Unternehmenskulturforschung
- II. Theoretische Grundlagen
- 1. Begriffsbestimmungen
- 1.1 Kultur
- 1.1.1 Problematik einer einheitlichen Definition
- 1.1.2 Das Kultur-Modell nach Hofstede
- 1.1.2.1 Individualität/Kollektivität
- 1.1.2.2 Ungleichheit von Macht
- 1.1.2.3 Vermeiden von Unsicherheit
- 1.1.2.4 Maskulinität/Femininität
- 1.2 Unternehmen und Organisation
- 1.3 Erfolg
- 1.4 Unternehmenskultur
- 2. Unternehmenskulturmodelle
- 3. Funktionen der Unternehmenskultur
- III. Erfassung der Unternehmenskultur
- 1. Richtungen der Unternehmenskulturforschung
- 2. Methoden zur Datenerhebung der Unternehmenskultur
- IV. Empirische Studien über den Zusammenhang von Unternehmenskultur und Erfolg
- 1. Eine qualitative Studie in den USA
- 2. Eine Langzeitstudie amerikanischer Unternehmen
- 3. Erste repräsentative Studie in Deutschland
- 4. Eine multimethodale Studie europäischer Unternehmen
- 5. Vorläufiges Fazit und weitere Überlegungen
- V. Abschließender Teil
- 1. Integratives Unternehmenskulturmodell
- 2. Kritische Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der Unternehmenskultur zum Unternehmenserfolg. Ziel ist es, die direkten und indirekten Auswirkungen der Unternehmenskultur zu analysieren und verschiedene Modelle sowie Analysemethoden zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet dabei sowohl theoretische Grundlagen als auch empirische Studien.
- Definition und Modelle der Unternehmenskultur
- Methoden zur Erfassung von Unternehmenskulturen
- Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg
- Analyse verschiedener empirischer Studien
- Entwicklung eines integrativen Modells
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitender Teil: Dieser einführende Teil der Arbeit skizziert die Problemstellung, indem er globale, demografische, wertebezogene und technologische Entwicklungen als Einflussfaktoren auf Unternehmen und deren Kulturen beleuchtet. Er beschreibt die Zielsetzung der Arbeit und ihren Aufbau, bevor er einen kurzen Abriss der Anfänge der Unternehmenskulturforschung gibt. Der Teil dient der Einleitung der zentralen Thematik und legt den Grundstein für die folgenden, tiefer gehenden Kapitel.
II. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beginnt mit der Definition von Kultur und Unternehmen, inklusive der Auseinandersetzung mit verschiedenen Organisations- und Unternehmensbegriffen. Es werden bedeutende Kulturmodelle nach Hofstede, Schein, Kotter & Heskett, Hatch und Sackmann vorgestellt und erläutert. Schließlich werden die Funktionen von Unternehmenskultur (Komplexitätsreduktion, Koordiniertes Handeln, Motivation, Commitment, Identifikation und Kontinuität) eingehend diskutiert und mit relevanten Theorien (z.B. VIE-Theorie, Zwei-Faktoren-Theorie) verknüpft. Dieser Teil liefert ein umfassendes Verständnis der relevanten Konzepte.
III. Erfassung der Unternehmenskultur: Kapitel III befasst sich mit den verschiedenen Richtungen und Methoden der Unternehmenskulturforschung. Es werden die funktional-objektivistische, die interpretative-subjektivistische und die integrative Perspektive gegenübergestellt und diskutiert. Weiterhin werden verschiedene Methoden zur Datenerhebung, wie Dokumentenanalyse, Firmenrundgänge, Sitzungsbeobachtungen, Fragebögen, Einzelinterviews und Gruppendiskussionen, vorgestellt und deren jeweilige Vor- und Nachteile beleuchtet. Dies bietet einen detaillierten Überblick über die Möglichkeiten der empirischen Untersuchung von Unternehmenskulturen.
IV. Empirische Studien über den Zusammenhang von Unternehmenskultur und Erfolg: In diesem Kapitel werden mehrere empirische Studien zum Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Erfolg präsentiert und analysiert. Es werden qualitative und quantitative Studien aus den USA und Deutschland berücksichtigt, die unterschiedliche methodische Ansätze und Ergebnisse aufweisen. Die Ergebnisse der einzelnen Studien werden im Detail beschrieben und in Bezug zu den vorgestellten theoretischen Modellen gesetzt. Der Fokus liegt auf der Synthese der Ergebnisse und deren Bedeutung für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Unternehmenskultur und Erfolg.
Schlüsselwörter
Unternehmenskultur, Unternehmenserfolg, Kulturmodelle (Hofstede, Schein, Kotter & Heskett), Datenerhebungsmethoden, empirische Studien, Zusammenhang Unternehmenskultur und Erfolg, integratives Modell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg. Sie analysiert die direkten und indirekten Auswirkungen der Unternehmenskultur und beleuchtet verschiedene Modelle und Analysemethoden. Sowohl theoretische Grundlagen als auch empirische Studien werden berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Modelle der Unternehmenskultur, Methoden zur Erfassung von Unternehmenskulturen, den Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg, die Analyse verschiedener empirischer Studien und die Entwicklung eines integrativen Modells.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: I. Einleitender Teil: Einführung in die Problemstellung (Globalisierung, demografische Entwicklung, Wertewandel, technische Entwicklung), Zielsetzung und Aufbau der Arbeit, Anfänge der Unternehmenskulturforschung. II. Theoretische Grundlagen: Begriffsbestimmungen (Kultur, Unternehmen, Erfolg, Unternehmenskultur), Unternehmenskulturmodelle (Hofstede, Schein u.a.), Funktionen der Unternehmenskultur. III. Erfassung der Unternehmenskultur: Richtungen der Unternehmenskulturforschung, Methoden zur Datenerhebung (Dokumentenanalyse, Interviews etc.). IV. Empirische Studien über den Zusammenhang von Unternehmenskultur und Erfolg: Analyse verschiedener empirischer Studien aus den USA und Deutschland. V. Abschließender Teil: Integratives Unternehmenskulturmodell, kritische Diskussion und Ausblick.
Welche Kulturmodelle werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und erläutert verschiedene bedeutende Kulturmodelle, darunter insbesondere das Modell von Hofstede, sowie weitere Modelle von Schein, Kotter & Heskett, Hatch und Sackmann.
Welche Methoden zur Erfassung der Unternehmenskultur werden diskutiert?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden zur Datenerhebung, wie Dokumentenanalyse, Firmenrundgänge, Sitzungsbeobachtungen, Fragebögen, Einzelinterviews und Gruppendiskussionen, und beleuchtet deren Vor- und Nachteile.
Welche empirischen Studien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert mehrere empirische Studien zum Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Erfolg aus den USA und Deutschland, darunter qualitative und quantitative Studien mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen.
Was ist das Ergebnis der Arbeit?
Die Arbeit entwickelt ein integratives Modell der Unternehmenskultur und bietet eine kritische Diskussion der Ergebnisse sowie einen Ausblick auf zukünftige Forschung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter: Unternehmenskultur, Unternehmenserfolg, Kulturmodelle (Hofstede, Schein, Kotter & Heskett), Datenerhebungsmethoden, empirische Studien, Zusammenhang Unternehmenskultur und Erfolg, integratives Modell.
- Quote paper
- Frank Halder (Author), 2010, Beitrag der Unternehmenskultur zum Unternehmenserfolg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153828