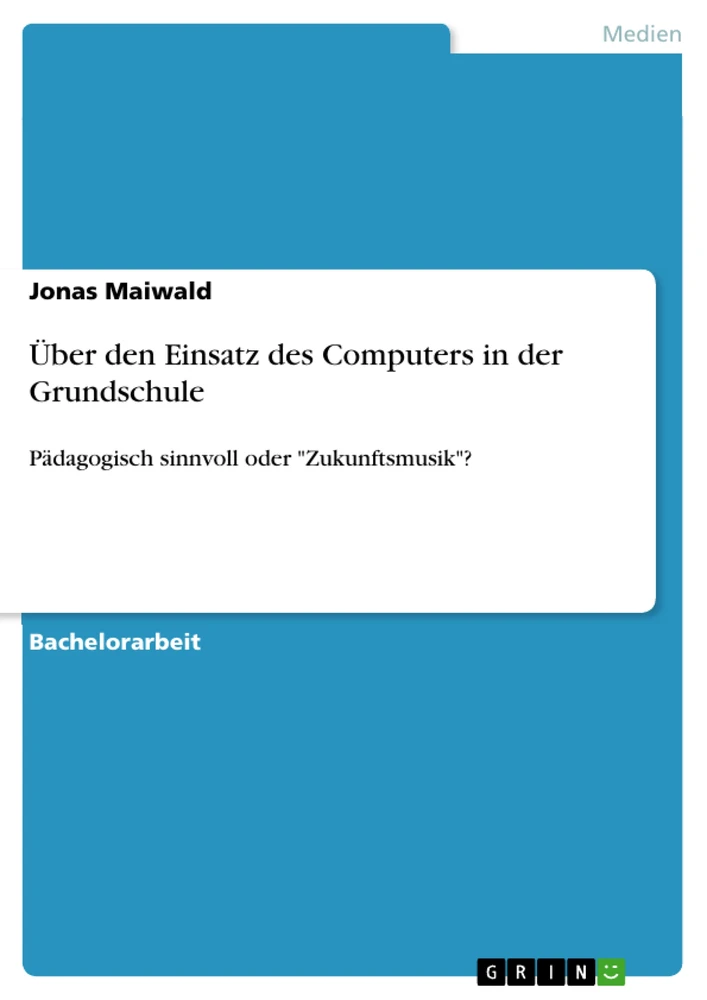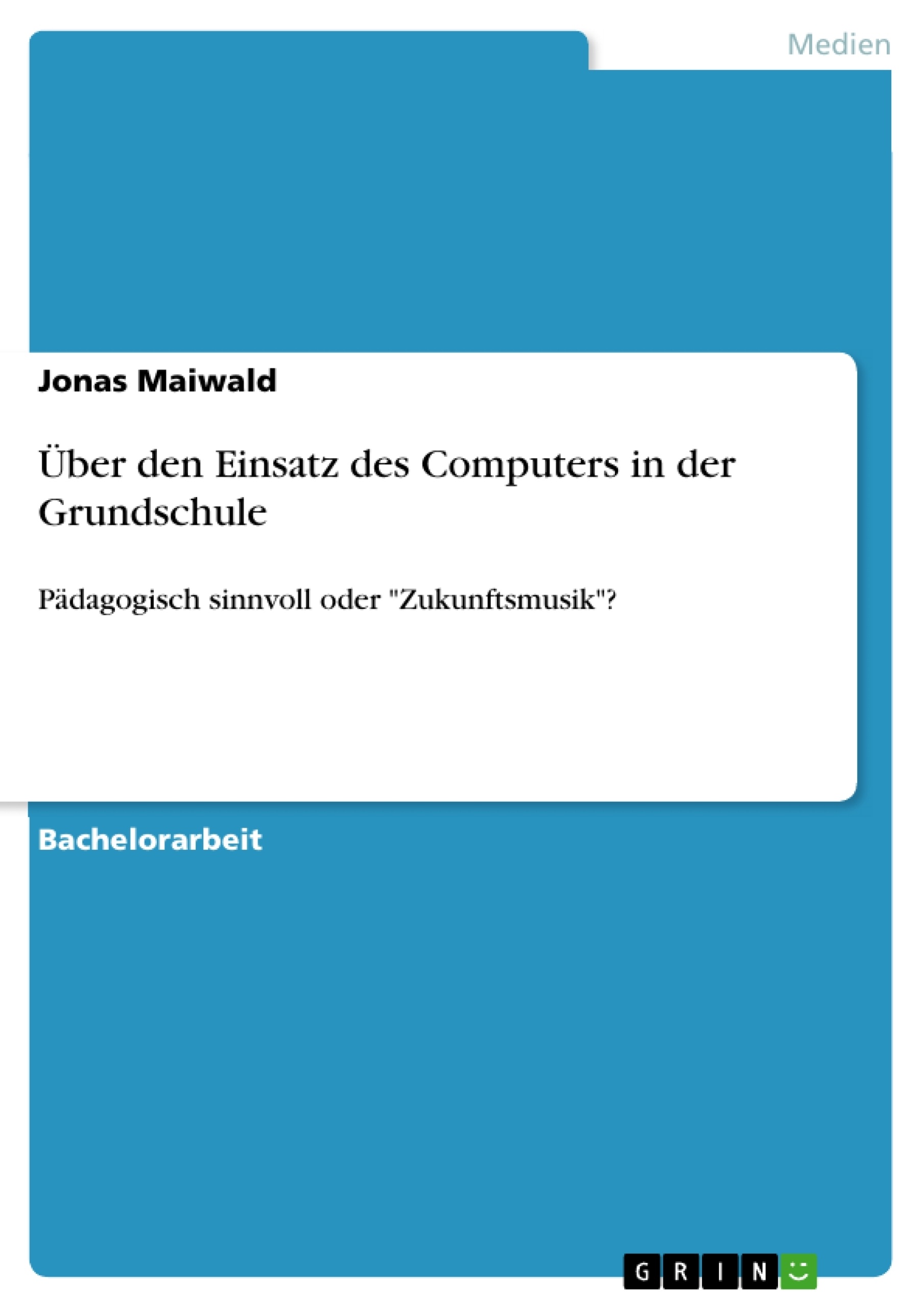Moderne Technologien halten immer mehr Einzug in unseren Alltag. Sie sind oft wichtiger Bestandteil der Arbeitswelt geworden und auch im privaten Bereich erfreuen sich die Erwachsenen am neuesten Notebook und an digitalen Videokameras. Die Industrie zielt mit ihren technischen Produkten jedoch längst nicht mehr nur auf die Erwachsenen, sondern vor allem auf die Kinder: Zu Weihnachten soll es ein „schickes Handy“ sein, zum Geburtstag die „beste Spielkonsole“ und zwischendurch ein schnellerer Computer. „Den braucht man doch heute für die Schularbeiten“, rechtfertigen manche Eltern den Kauf dieser Neuanschaffung und hoffen dabei der Bildung und Entwicklung ihres Kindes „Gutes“ zu tun. Dass sie durch den Kauf und die Bereitstellung des PCs möglicherweise Gegenteiliges bewirken, da eben nicht nur Vokabeln mit diesem Medium gelernt werden, sondern vor allem tüchtig gespielt wird, haben viele Eltern im Vorfeld nicht bedacht.1
Laut Statistik sind heute beinahe alle Kinder mit einem Handy ausgestattet und haben zu Hause sowohl Zugang zum Computer als auch zum Internet.2 Durch diese Allgegenwärtigkeit der High-Tech-Geräte und der intensiven Beschäftigung mit diesen, kennen sich Kinder und Jugendliche mit den neuen Technologien gut aus. Gerade im Bereich der Musik wissen sie genauestens Bescheid – manchmal besser als die Erwachsenen selbst: Sie tauschen mit ihren Handys über „Bluetooth“3 MP3's aus und erstellen „Playlists“4 aus ihrer Musiksammlung. Sie „brennen“ sich gegenseitig Musik-Cd's, schneiden Musikvideos für „youtube“5 zusammen oder gebrauchen die „DJ-Features“6 ihres Multimedia-Handys um Musik zu „scratchen“, zu „faden“ oder für's „Sampling“7.
Die Kinder und Jugendlichen sind also in der Lage, ihre Medienkompetenzen zum Teil selbstständig auszubilden. Dieser Umstand könnte sich für den Schulunterricht durchaus Vorteilhaft auswirken, da die Lehrerinnen und Lehrer die Zeit für das Einführen in die Computerbedienung sparen und somit gleich mit der Arbeit an den „richtigen“ Programmen beginnen könnten.
Aber welche sind die „richtigen“ Programme für den Schulunterricht? Ist die auf dem Markt erhältliche Software für den Unterricht geeignet?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Verwendung des Computers in der Schule
- 2.1. Argumente gegen den Computereinsatz
- 2.2. Argumente für den Computereinsatz
- 2.3. Pädagogische Aspekte zum Einsatz des Computers in der Grundschule
- 2.4. Psychologische Aspekte zum Einsatz des Computers in der Grundschule
- 3. Über den Einsatz des Computers im Musikunterricht
- 3.1. Die fachwissenschaftliche Diskussion zum Thema Computer im Musikunterricht
- 3.2. Überlegungen zum Thema Computereinsatz im Musikunterricht der Grundschule
- 3.2.1. Organisatorische und technische Rahmenbedingungen der Schulen
- 3.2.2. Musiklehrerkompetenzen
- 3.2.3. Planung des Musikunterrichts mit dem Computer
- 3.3. Computersoftware für den Grundschulunterricht im Fach Musik
- 3.3.1. Kategorien von Unterrichtssoftware
- 3.3.1.1. Lehr- und Lernprogramme
- 3.3.1.2. Multimediale Informationsprogramme
- 3.3.1.3. Musikorientierte Spiele
- 3.3.1.4. Werkzeugprogramme
- 3.3.1.5. Tutorielle Systeme und Kommunikations- und Kooperationsumgebungen
- 3.3.2. Softwareangebot für den Bereich des Musikunterrichts
- 3.3.3. Qualitätstest und Bewertungsmöglichkeiten für Musik-Lernsoftware
- 3.3.4. Im Musikunterricht der Grundschule eingesetzte Software
- 4. Zusammenfassung
- 5. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob der Einsatz des Computers im Musikunterricht der Grundschule pädagogisch sinnvoll ist. Hierzu werden Argumente für und gegen den Computereinsatz im Unterricht analysiert und die didaktischen sowie methodischen Aspekte des Themas beleuchtet.
- Der Einfluss des Computers auf die kindliche Entwicklung
- Die Rolle des Computers als Lernmedium im Musikunterricht
- Die Relevanz von Musiklehrerkompetenzen im Umgang mit Computern
- Die Auswahl und Bewertung von geeigneter Musiksoftware
- Die pädagogische Bedeutung des Computers im Kontext des Musikunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas im Kontext der modernen Medienlandschaft beleuchtet. Kapitel 2 analysiert die Argumente für und gegen den Einsatz des Computers in der Schule, wobei sowohl pädagogische als auch psychologische Aspekte berücksichtigt werden. Kapitel 3 widmet sich dem Einsatz des Computers im Musikunterricht, wobei insbesondere die fachwissenschaftliche Diskussion, die organisatorischen Rahmenbedingungen und die Auswahl geeigneter Software beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Computerspiel, Medienpädagogik, Musikunterricht, Grundschule, Pädagogische Psychologie, Lernsoftware, Didaktik, Methodische Prinzipien, Musikalische Bildung, Neue Medien, Unterrichtsgestaltung.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Einsatz von Computern in der Grundschule sinnvoll?
Die Arbeit wägt Argumente ab und betont, dass der Computer bei richtiger pädagogischer Einbettung ein wertvolles Lernmedium sein kann.
Welche Vorteile bietet der Computer im Musikunterricht?
Er ermöglicht das Experimentieren mit Klängen (Sampling, Scratchen) und unterstützt kreative Prozesse beim Komponieren und Bearbeiten von Musik.
Welche Arten von Musiksoftware gibt es für die Schule?
Unterschieden werden Lehr- und Lernprogramme, multimediale Informationsprogramme, musikorientierte Spiele und Werkzeugprogramme.
Welche Kompetenzen brauchen Musiklehrer für digitale Medien?
Lehrer müssen nicht nur die Technik beherrschen, sondern auch die didaktische Planung des Unterrichts mit dem Computer gezielt steuern können.
Wie beurteilt man die Qualität von Lernsoftware?
Die Arbeit stellt Kriterien für Qualitätstests und Bewertungsmöglichkeiten vor, um geeignete Software für den Grundschulunterricht auszuwählen.
- Quote paper
- Jonas Maiwald (Author), 2010, Über den Einsatz des Computers in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153883