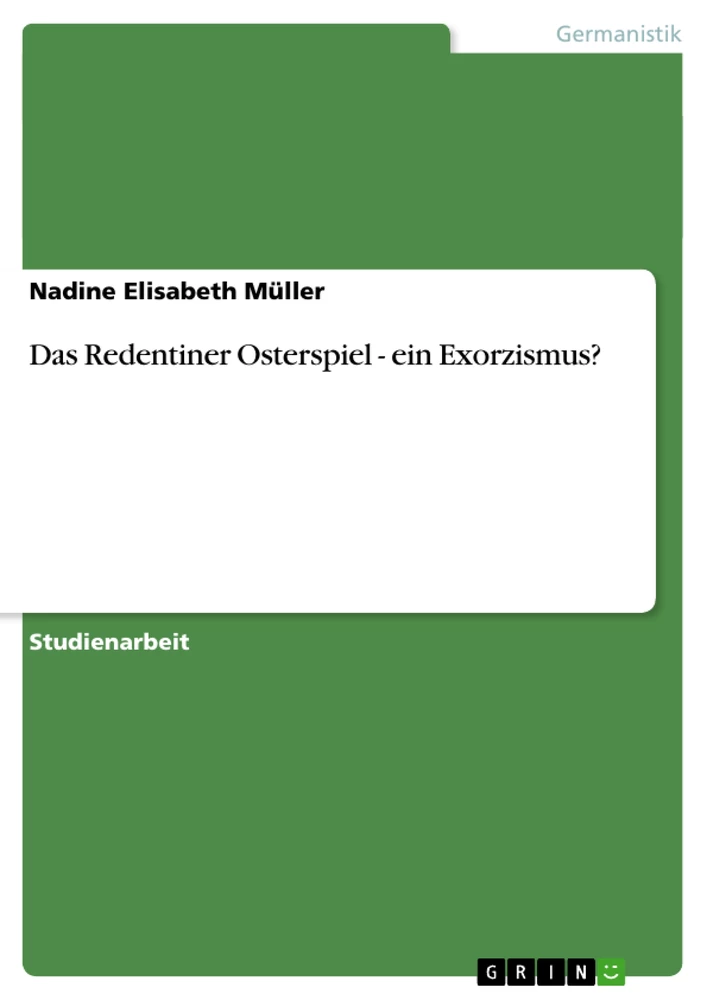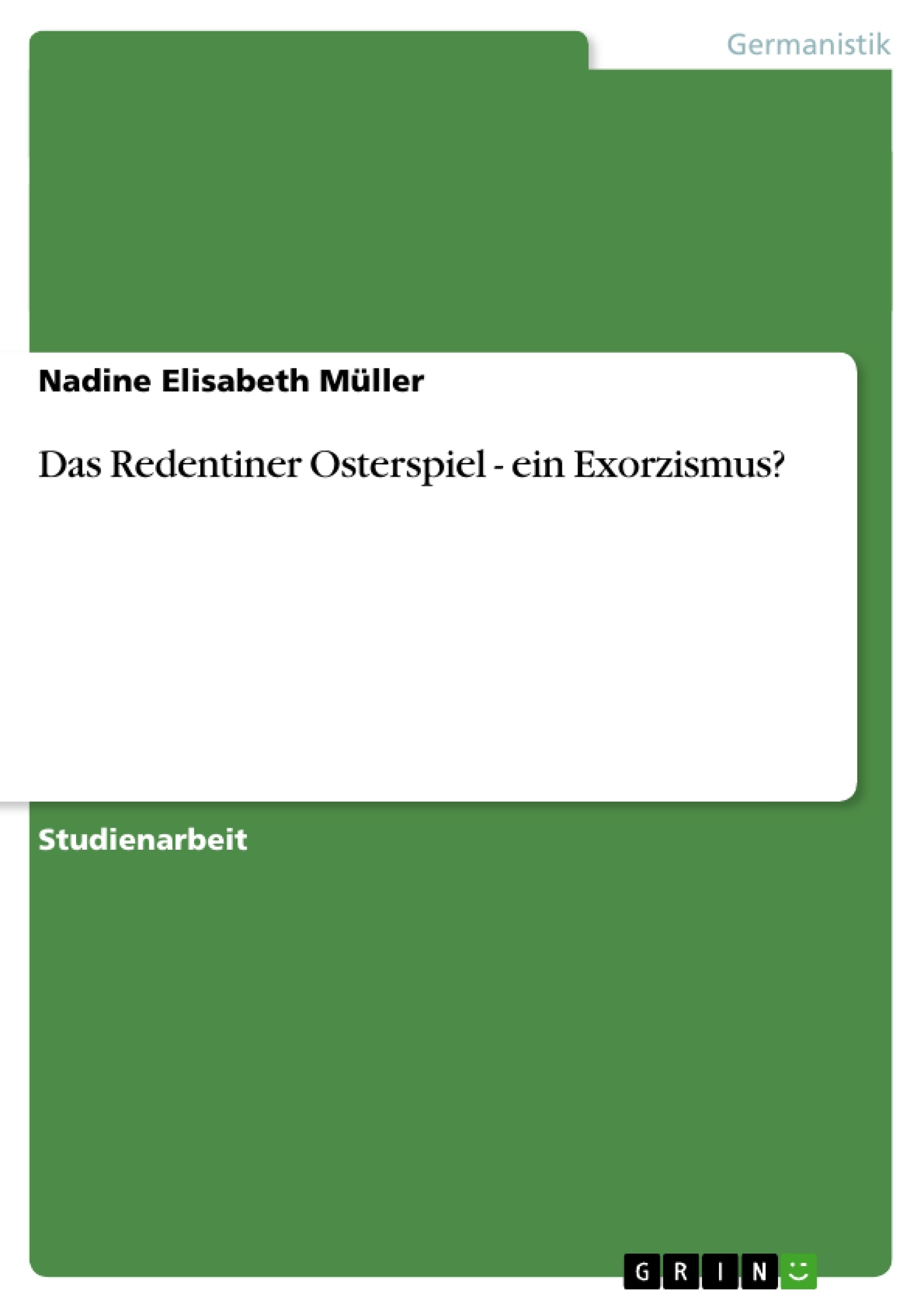Exi, immunde spiritus, et da locum spiritui sancto!
(Fahre aus, Du unreiner Geist, und gib Raum dem heiligen Geist ! )1
Dies ist die älteste überlieferte kirchliche Exorzismusformel aus dem 7./8.Jahrhundert n. Chr., der vor dem Taufakt in der Regel dreimal gesprochen wurde.
Besessenheit und Exorzismus waren noch bis in das 19. Jahrhundert hinein Bestandteil der abendländisch-christlichen Alltagskultur. Besessenheit gilt heute als eine aus einem religiös-mythologischen Weltbild entstandene Interpretation von bestimmten psychischen Krankheitsbildern; Exorzismen als überholter christlicher Ritus. Aber wie war das Verhältnis zum Exorzismus im Mittelalter? Finden wir gar im Redentiner Osterspiel einen Exorzismus?
Im ersten Teil dieser Arbeit stehen grundlegende, religionswissenschaftliche Definitionen im Vordergrund, damit eine einheitliche Sprache in der Diskussion vorherrscht. Außerdem soll geklärt werden, wie der Glaube an Besessenheit in der christlich-abendländischen Kultur entstand und wie sich Besessenheit und Exorzismus im mittelalterlichen Alltag darstellten. Außerdem sollen der Verlauf einer Besessenheit und eines Exorzismus dargestellt, sowie die wissenschaftlichen Erklärungen aus heutiger Zeit für das Phänomen Besessenheit aufgezeigt werden.
Im zweiten Teil möchte ich einen kurzen Überblick über die mittelalterlichen Osterspiele geben und auf die Bedeutung bzw. den Bedeutungswandel bezüglich der Zuschauer2 eingehen. Denn anders als Theater heute war das mittelalterliche Drama eine "dramatisch-szenische Darstellung geistlicher Stoffe, welche Belehrung bezweckt" 3.
Im dritten Teil wird dieses Wissen auf ausgewählte Szenen des Redentiner Osterspiels angewendet und es soll überprüft werden, ob dort ein Exorzismus (oder mehrere Exorzismen) vollführt werden und wie die Forschung diese wichtige Thematik behandelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I Exorzismus – Besessenheit - Rituale Romanum
- Definitionen
- Exorzismus (religionswissenschaftlich)
- Dämon
- Teufel
- Luzifer
- Grundlagen
- Stellung der Kirche im Mittelalter
- Exorzismen im Alten und Neuen Testament
- Exorzismen im Mittelalter
- Der Exorzismus nach dem „Rituale Romanum“
- Vorbemerkung
- Vorgang der Besessenheit
- Verlauf des Exorzismus
- Wissenschaftliche Erklärungen des Besessenheit
- Definitionen
- Teil II Das mittelalterliche Drama – Passions- und Osterspiele
- Definition
- Die Quellen
- Bildungssprache Latein vs. Volkssprache Deutsch
- Die Veränderung des Spieles: aus der Kirche auf den Marktplatz
- Das geistige Spiel - mehr als Unterhaltung
- Der mittelalterliche Zuschauer
- Passions- bzw. Osterspiele
- Teil III Das Teufelsspiel im Redentiner Osterspiel - ein Exorzismus ?
- Einleitung
- Die Teufelsszenen
- Aufbau des Osterspiels
- Erster Hauptteil „Das Osterspiel“
- Die Höllenfahrtsszene(n)
- Religionswissenschaftlicher Exkurs Religion - Magie
- Ergebnis des Exkurses bezüglich Fischer-Lichte
- Wird in der Höllenfahrtsszene ein Exorzismus vollführt?
- Zweiter Hauptteil „Das Teufelsspiel“
- Teufelsspiel
- Wird im Teufelsspiel ein Exorzismus vollführt?
- Zusammenfassung und Ergebnisse
- Forschungsüberblick und Kritik
- Zusammenhang Exorzismus und Erlösung
- Erlösung
- Religionswissenschaftliche Definition von Erlösung
- Forschungsüberblick Erlösung
- Ergebnis
- Ausblick
- Erster Hauptteil „Das Osterspiel“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob im Redentiner Osterspiel ein Exorzismus stattfindet. Zunächst werden die Begriffe "Exorzismus" und "Besessenheit" aus religionswissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Die Arbeit untersucht die Entstehung des Glaubens an Besessenheit innerhalb der abendländischen Kultur und die Rolle des Exorzismus im mittelalterlichen Alltag. Anschließend wird das mittelalterliche Drama im Allgemeinen und die Passions- und Osterspiele im Besonderen beleuchtet. In einem dritten Teil werden ausgewählte Szenen des Redentiner Osterspiels analysiert, um zu prüfen, ob ein Exorzismus stattfindet und wie die Forschung dieses Thema behandelt hat.
- Exorzismus und Besessenheit im Mittelalter
- Das Redentiner Osterspiel als Beispiel für mittelalterliches Drama
- Analyse des Redentiner Osterspiels auf Exorzismus-Elemente
- Der Zusammenhang zwischen Exorzismus und Erlösung
- Religionswissenschaftliche Betrachtung von Ritual und Spiel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Arbeit und stellt die Forschungsfrage nach dem Vorhandensein eines Exorzismus im Redentiner Osterspiel. Teil I definiert die Begriffe "Exorzismus" und "Besessenheit" aus religionswissenschaftlicher Sicht und beleuchtet die Entstehung des Glaubens an Besessenheit sowie die Rolle des Exorzismus in der abendländischen Kultur im Mittelalter. Teil II behandelt die mittelalterlichen Osterspiele und ihre Bedeutung im Kontext des damaligen Theaterverständnisses. Teil III analysiert ausgewählte Szenen des Redentiner Osterspiels, um zu prüfen, ob ein Exorzismus stattfindet, und diskutiert die Ergebnisse der Forschung zu diesem Thema.
Schlüsselwörter
Exorzismus, Besessenheit, Rituale Romanum, mittelalterliches Drama, Passions- und Osterspiele, Redentiner Osterspiel, Teufelsspiel, Erlösung, Religionswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Findet im Redentiner Osterspiel tatsächlich ein Exorzismus statt?
Die Arbeit untersucht diese Frage religionswissenschaftlich und analysiert Teufelsszenen sowie die Höllenfahrt Christi auf exorzistische Ritualelemente hin.
Was war der Zweck mittelalterlicher Osterspiele?
Anders als modernes Theater dienten sie der dramatisch-szenischen Darstellung geistlicher Stoffe zur Belehrung und religiösen Erbauung des Volkes.
Wie wurde „Besessenheit“ im Mittelalter definiert?
Besessenheit galt als religiös-mythologische Interpretation psychischer Krankheitsbilder, bei der ein Dämon oder der Teufel vom Körper eines Menschen Besitz ergriffen hat.
Was ist das „Rituale Romanum“?
Es ist das offizielle liturgische Buch der katholischen Kirche, das unter anderem die genauen Vorschriften und Gebete für die Durchführung eines Exorzismus enthält.
Wie hängen Exorzismus und Erlösung zusammen?
Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Vertreibung des Bösen (Exorzismus) und dem christlichen Heilsversprechen der Erlösung durch Christus.
- Citar trabajo
- M.A. Nadine Elisabeth Müller (Autor), 1999, Das Redentiner Osterspiel - ein Exorzismus?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15391