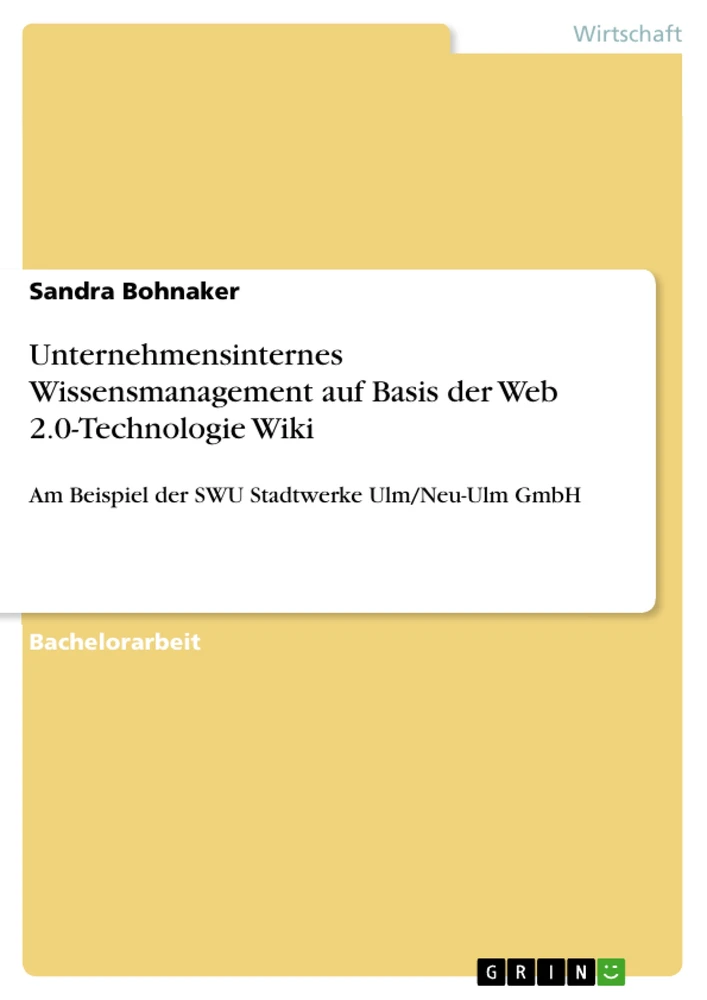Wikis können das technologische Rüstzeug für eine effiziente und effektive Organisation und Durchführung von wissensbasierten Tätigkeiten bei der SWU sein. Die vorliegende Arbeit untersucht an Hand von aktueller Literaturrecherche, unter welchen betrieblichen Voraussetzungen Wikis das Tool der Wahl sein sollten.
Es werden zahlreiche Ansatzpunkte für den Einsatz einer Wiki-Applikation als hilfreiches Wissensmanagementtool für die SWU gezeigt. Auf Basis der aus dem Literaturstudium gewonnenen Erkenntnisse und den daraus ableitbaren erfolgsfördernden Maßnahmen lassen sich folgende Aussagen treffen:
Je besser die bestehenden internen Unternehmenskommunikationsmittel reduziert und kanalisiert und teilweise vollständig durch das SWU-Wiki abgelöst werden können, desto mehr Anklang wird das Wiki im Unternehmen finden. Ebenso stark hängt es davon ab, ob die Mitarbeiter davon überzeugt werden können, dass ihr Engagement im Wiki ihnen tatsächlich einen (persönlichen) Nutzen liefern wird. Nur sie können durch die Verwaltung und Verbreitung ihres impliziten Wissens zu dessen Erfolg beitragen. Je flacher und teamorientierter ein Unternehmen geführt ist, je konstruktiver Mitarbeiter sind und je (hyper-) textbasierter das Wissen im Unternehmen vorliegt, desto besser eignen sich Wikis als Wissensmanagementtool.
Die vorliegende Arbeit zeigt aber auch Grenzen und Risiken auf, wenn lediglich die Wiki Software eingeführt wird, ohne dass auf personeller oder organisatorischer Seite die entsprechenden Bedingungen und Voraussetzungen geschaffen wurden. Letztendlich ist es der Faktor Mensch, mit dem ein gelebtes Wissensmanagement funktionieren und einen Beitrag zu den Unternehmenszielen leisten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Relevanz des Themas
- Ziel der Arbeit und Abgrenzung
- Wissenschaftliche theoretische Grundlagen
- Vom Informations- zum Wissensmanagement
- Wissen
- Wissensmanagement
- Der Wissensmanagement-Prozess
- Web 2.0
- Social Software
- Wiki
- Funktionsweise eines Wiki
- Kausalitätsprinzip eines Wiki
- Innerbetriebliches Wissensmanagement mit Wikis
- Ein Corporate Wiki ist nicht Wikipedia
- Einsatzmöglichkeiten von Wikis im Unternehmen
- Chancen und Risiken eines Corporate Wiki
- Vom Informations- zum Wissensmanagement
- Wissensmanagement am Beispiel SWU
- Der deutsche Energiemarkt
- Das Unternehmen SWU
- Die Ausgangsposition
- Ziele eines SWU-Wissensmanagements
- Situationsanalyse bei der SWU
- Ansatzpunkte für ein SWU-Wiki
- Erfolgsfördernde Maßnahmen
- Handlungsempfehlung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Implementierung eines unternehmensinternen Wissensmanagementsystems auf Basis der Web 2.0-Technologie Wiki am Beispiel der SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH. Das Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen eines Corporate Wikis im Kontext der Energiebranche zu beleuchten und konkrete Handlungsempfehlungen für die SWU zu entwickeln. Die Arbeit befasst sich dabei mit den theoretischen Grundlagen des Wissensmanagements, den Funktionsweisen von Wikis und der spezifischen Situation der SWU im deutschen Energiemarkt.
- Theoretische Grundlagen des Wissensmanagements
- Die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Wikis im Unternehmenskontext
- Die Chancen und Risiken eines Corporate Wikis
- Die spezifische Situation der SWU im deutschen Energiemarkt
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Implementierung eines SWU-Wikis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Relevanz des Themas sowie das Ziel der Arbeit vor. Sie erläutert, warum Wissensmanagement im digitalen Zeitalter von entscheidender Bedeutung für Unternehmen ist und warum Wikis als Werkzeug für ein effektives Wissensmanagement eingesetzt werden können.
Kapitel 2 befasst sich mit den wissenschaftlichen theoretischen Grundlagen des Wissensmanagements. Es definiert den Begriff "Wissen", erklärt die Funktionsweise des Wissensmanagement-Prozesses und beschreibt die Bedeutung von Web 2.0-Technologien wie Wikis für die Wissensvermittlung in Unternehmen.
Kapitel 3 analysiert die Situation der SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH. Es beleuchtet den deutschen Energiemarkt, beschreibt die Ausgangsposition der SWU und untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen für ein SWU-Wissensmanagement auf Basis eines Corporate Wikis.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Corporate Wiki, Web 2.0, Social Software, Energiebranche, SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH, Wissensvermittlung, Unternehmenskommunikation, Handlungsempfehlung, Digitalisierung.
- Quote paper
- Sandra Bohnaker (Author), 2009, Unternehmensinternes Wissensmanagement auf Basis der Web 2.0-Technologie Wiki, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153925