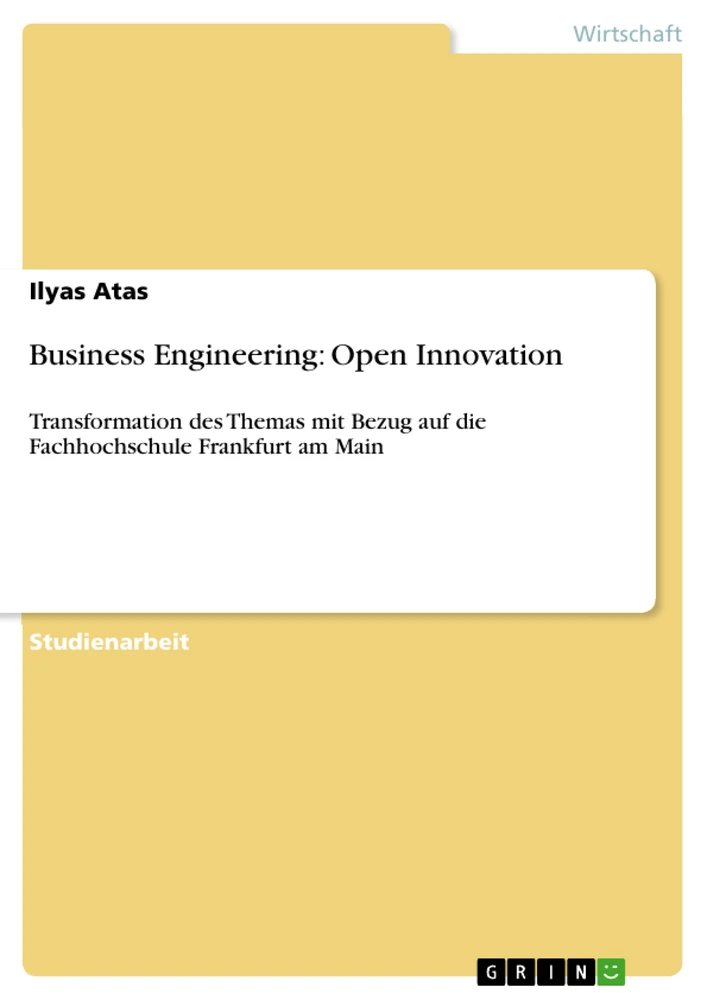In den letzten Jahren ist Open Innovation sowohl in der Theorie als auch in der Praxis zu einem wichtigen Phänomen geworden. Unternehmen betreiben nicht nur intern Forschung und Entwicklung, sondern greifen auch auf sämtliche Wissensquellen außerhalb des eigenen Unternehmens. Sie haben erkannt, dass man durch das Einbeziehen von Kunden und Lieferanten und Integration externer Forschungs- -und Entwicklungseinrichtungen in den Entwicklungsprozess, das unternehmerische Innovationspotenzial vergrößert.
Die Gründe für Open Innovation sind kürzere Innovationszyklen, erfolgreiche und an Kunden ausgerichtete Innovationen und die Reduzierung der Kosten. Aufgrund steigenden Wettbewerbsdrucks in einen komplexen und globalen Markt nutzen viele Unternehmen Open Innovation und nutzen dabei möglichst alle Wissensquellen. Open Innovation ist eine neue Perspektive, um Probleme wie steigende Kosten oder kürzere Produktlebenszyklus zu meistern.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Thematische Abgrenzung
- Zielsetzung
- Grundlagen
- Invention vs. Innovation
- Innovationsprozess
- Innovationsansätze
- Open Innovation Ansatz nach Chesbrough
- Der Closed Innovation Paradigma
- Der Open Innovation Paradigma
- Open Innovation Ansatz nach Reichwald/Piller
- Kritische Würdigung beider Ansätze
- Open Innovation Ansatz nach Chesbrough
- Open Innovation
- Kernprozesse von Open Innovation
- Outside-in-Prozesse
- Inside-out-Prozesse
- Coupled Prozess
- Vorteile von Open Innovation
- Vorteile aus Unternehmersicht
- Vorteile aus Kundensicht
- Grenzen von Open Innovation
- Kernprozesse von Open Innovation
- Fachhochschule Frankfurt am Main
- Situationsanalyse
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Open Innovation Ansatz
- Kritik an das betriebliches Vorschlagswesen der FH FFM
- Verbesserungsvorschlag
- Kooperationsnetzwerke
- FH FFM und Kernprozesse von Open Innovation
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Phänomen Open Innovation und analysiert dessen Bedeutung für Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Der Fokus liegt auf der Anwendung von Open Innovation in der Praxis, insbesondere im Kontext der Fachhochschule Frankfurt am Main.
- Definition und Abgrenzung von Open Innovation
- Analyse der Kernprozesse von Open Innovation
- Vorteile und Grenzen von Open Innovation
- Anwendung von Open Innovation in der Praxis
- Evaluierung des Potenzials von Open Innovation für die Fachhochschule Frankfurt am Main
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Open Innovation. Es werden Definitionen und Abgrenzungen des Konzepts erläutert. Anschließend werden die Grundlagen der Innovation und des Innovationsprozesses beleuchtet, sowie verschiedene Innovationsansätze, insbesondere die Open Innovation Ansätze nach Chesbrough und Reichwald/Piller, vorgestellt. Die Arbeit geht dann auf die Kernprozesse von Open Innovation ein, welche die Bereiche Outside-in, Inside-out und Coupled Prozesse umfassen. Des Weiteren werden die Vorteile von Open Innovation aus Unternehmersicht und Kundensicht sowie die Grenzen des Ansatzes diskutiert. Im Folgenden werden konkrete Anwendungsbeispiele von Open Innovation an der Fachhochschule Frankfurt am Main präsentiert. Dabei werden das betriebliche Vorschlagswesen, Kooperationsnetzwerke und die Integration der Kernprozesse von Open Innovation in die FH FFM betrachtet. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Innovationsmanagement, Open Innovation, Innovationsprozess, technologische Innovation, Open Source Produkte und Märkte, sowie die Anwendung dieser Konzepte im Kontext der Fachhochschule Frankfurt am Main.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Open Innovation"?
Open Innovation ist ein Ansatz, bei dem Unternehmen ihren Innovationsprozess öffnen, um externes Wissen von Kunden, Lieferanten oder Forschungseinrichtungen zu integrieren.
Was ist der Unterschied zwischen Invention und Innovation?
Eine Invention ist eine bloße Erfindung, während eine Innovation die erfolgreiche wirtschaftliche Umsetzung und Markteinführung dieser Erfindung beschreibt.
Was sind "Outside-in"-Prozesse?
Dabei wird externes Wissen (z.B. durch Crowdsourcing oder Kooperationen) in das eigene Unternehmen geholt, um die interne Innovationskraft zu stärken.
Was sind die Vorteile von Open Innovation?
Zu den Vorteilen zählen kürzere Innovationszyklen, geringere Entwicklungskosten und Produkte, die besser an den tatsächlichen Kundenbedürfnissen ausgerichtet sind.
Was sind "Inside-out"-Prozesse?
Hierbei werden intern entwickelte Ideen, die nicht zum Kerngeschäft passen, nach außen gegeben (z.B. durch Lizenzen oder Spin-offs), um sie dort zu verwerten.
- Citation du texte
- MSc Ilyas Atas (Auteur), 2010, Business Engineering: Open Innovation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153973