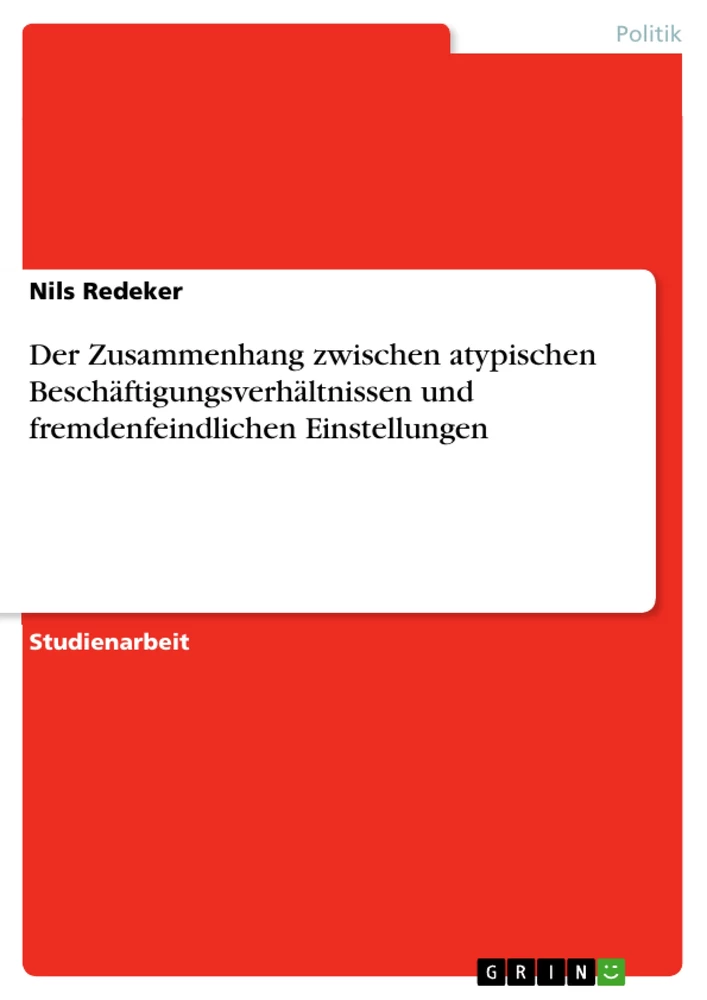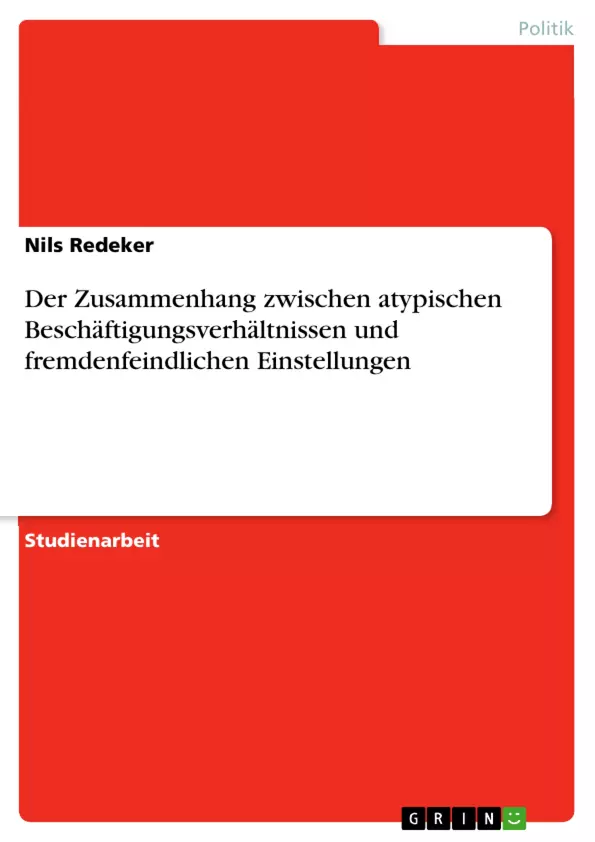Erwerbsarbeit entwickelte sich in der bundesrepublikanischen Gesellschaft nach 1945 zum zentralen gesellschaftlichen Integrationsmedium. In der neuen „Lohnarbeitsgesellschaft“, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der BRD etablierte, bedeutete Arbeit und Lohn mehr als nur die Vergütung verrichteter Aufgaben. Sie verschaffte Zugang zu elementaren Teilhaberechten, ermöglichte Leistungen außerhalb der Arbeit und war Voraussetzung für die Teilnahme am sozialen Leben. Im Rahmen eines allgemein relativ normierten Arbeitsverhältnis kam Erwerbstätigkeit dabei entscheidende integrative Funktionen zu.
Dieses Normalarbeitsverhältnis (NAV) erfährt seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts vermehrt einen Bedeutungsrückgang. Demgegenüber entsteht eine immer größere Anzahl nichtstandardisierter oder atypischer Beschäftigungsverhältnisse. Befördert durch Unternehmensstrategien, die sich immer stärker an den kurzfristigen Erwartungshaltungen der Kapitalmärkte orientieren, und dem systematischen Abbau gesetzlicher Rahmenbedingungen breiten sich seitdem Erwerbsverhältnisse aus, die wesentliche dieser integrativen Funktionen nur noch bedingt erfüllen.
Für viele der Betroffenen stellt diese Entwicklung vor allem die Rückkehr einer ständiger Unsicherheit dar, die man zur Hochzeit des „rheinischen Kapitalismus“ eigentlich für überwunden hielt. Diese Arbeit beschäftigt sich vor allem mit der subjektivem Verarbeitung der dadurch entstehende Desintegrationsprozesse und mit ihren möglichen Einflüssen auf fremdenfeindliche Haltungen. Dabei wird von folgender Fragestellungen ausgegangen:
Hat die Erfahrung von Beschäftigungsverhältnisse, die wesentliche Funktionen von klassischer Erwerbsarbeit nicht mehr erfüllen, einen Einfluss auf mögliche fremdenfeindliche Einstellungen der Arbeitnehmer?
Die Arbeitshypothese lautet dementsprechend:
Erfüllt Erwerbsarbeit ihre zentralen integrativen Funktionen nicht mehr, können die daraus resultierenden Desintegrationsprozesse fremdenfeindliche Einstellungen der Betroffenen fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klassische Erwerbsarbeit und soziale Integration
- Atypische Beschäftigungsformen
- Eingrenzung und Formen des Begriffs
- Desintegrationseffekte atypische Beschäftigungsverhältnisse
- Auswirkungen auf mögliche fremdenfeindliche Einstellungen
- (Des-)Integrationsparadoxon und Überintegration
- Ausgrenzende Integrationsnorm
- Relative Deprivation
- Einschränkungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen atypischen Beschäftigungsverhältnissen und möglichen fremdenfeindlichen Einstellungen. Sie untersucht, ob die Erfahrung von Beschäftigungsverhältnissen, die wesentliche Funktionen klassischer Erwerbsarbeit nicht mehr erfüllen, einen Einfluss auf fremdenfeindliche Einstellungen der Arbeitnehmer hat.
- Die integrative Rolle klassischer Erwerbsarbeit und das Normalarbeitsverhältnis (NAV)
- Eingrenzung und Formen atypischer Beschäftigungsverhältnisse
- Die Desintegrationseffekte atypischer Beschäftigungsverhältnisse
- Mögliche Zusammenhänge zwischen Desintegrationsprozessen und fremdenfeindlichen Einstellungen
- Einschränkungen und kritische Betrachtung des Zusammenhangs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit setzt sich mit der Bedeutung klassischer Erwerbsarbeit für die soziale Integration in der Bundesrepublik Deutschland auseinander. Sie beleuchtet den Wandel vom Normalarbeitsverhältnis hin zu atypischen Beschäftigungsformen und deren potenziellen Folgen für die Integration. Die zentrale Fragestellung lautet, ob die Erfahrung von atypischen Beschäftigungsverhältnissen, die wesentliche integrative Funktionen nicht mehr erfüllen, einen Einfluss auf fremdenfeindliche Einstellungen der Arbeitnehmer hat.
Klassische Erwerbsarbeit und soziale Integration
Dieser Abschnitt befasst sich mit den verschiedenen Funktionen, die klassische Erwerbsarbeit für die soziale Integration erfüllt. Neben der ökonomischen Integration durch Existenzsicherung und soziokulturelle Teilhabe wird die Bedeutung von Erwerbsarbeit für die bürgerschaftliche Integration durch gesellschaftlichen Nutzen, Identitätsstiftung und soziale Beziehungen hervorgehoben. Es wird argumentiert, dass klassische Erwerbstätigkeit trotz Veränderungen in der Arbeitswelt eine hohe Bedeutung für die gesellschaftliche Integration des Einzelnen hat.
Atypische Beschäftigungsformen
Dieser Abschnitt behandelt den Begriff der atypischen Arbeit und beschreibt verschiedene Formen dieser Beschäftigungsverhältnisse. Der Fokus liegt auf den Desintegrationseffekten, die mit diesen Arbeitsformen einhergehen können. Hier werden die Folgen für die ökonomische und bürgerschaftliche Integration beleuchtet, die durch Unsicherheit, mangelnde soziale Absicherung und fehlende gesellschaftliche Anerkennung entstehen können.
Auswirkungen auf mögliche fremdenfeindliche Einstellungen
Dieser Abschnitt untersucht mögliche Zusammenhänge zwischen Desintegrationsprozessen durch atypische Beschäftigung und fremdenfeindlichen Einstellungen. Im Fokus stehen zwei Theorien: Die Theorie der ausschließenden Integrationsnorm und das Konzept der Relativen Deprivation. Es wird argumentiert, dass die Erfahrung von Desintegrationsprozessen durch atypische Beschäftigung zu Frustration und Ressentiments führen kann, die sich in fremdenfeindlichen Einstellungen manifestieren können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen atypischen Beschäftigungsverhältnissen, Desintegrationsprozessen und möglichen fremdenfeindlichen Einstellungen. Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Normalarbeitsverhältnis (NAV), atypische Beschäftigung, Desintegration, Integration, soziale Integration, ökonomische Integration, bürgerschaftliche Integration, relative Deprivation, fremdefeindliche Einstellungen, Ausschließende Integrationsnorm.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Normalarbeitsverhältnis (NAV)?
Das NAV bezeichnet ein standardisiertes Arbeitsverhältnis, das soziale Sicherheit, Identität und gesellschaftliche Teilhabe garantiert.
Welche Desintegrationseffekte haben atypische Beschäftigungen?
Atypische Arbeit (z. B. Befristung, Zeitarbeit) führt oft zu ökonomischer Unsicherheit, mangelnder sozialer Absicherung und fehlender gesellschaftlicher Anerkennung.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen prekärer Arbeit und Fremdenfeindlichkeit?
Die Arbeitshypothese besagt, dass Desintegrationsprozesse durch unsichere Arbeit Frustration und Ressentiments fördern können, die sich in fremdenfeindlichen Einstellungen äußern.
Was erklärt das Konzept der „Relativen Deprivation“?
Es beschreibt das Gefühl der Benachteiligung im Vergleich zu anderen Gruppen, was zu Unzufriedenheit und der Suche nach Sündenböcken führen kann.
Was besagt die Theorie der „ausschließenden Integrationsnorm“?
Sie untersucht, wie Menschen versuchen, ihre eigene gefährdete soziale Position durch die Abwertung und Ausgrenzung von „Anderen“ (z. B. Migranten) zu stabilisieren.
- Citar trabajo
- Nils Redeker (Autor), 2010, Der Zusammenhang zwischen atypischen Beschäftigungsverhältnissen und fremdenfeindlichen Einstellungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154142