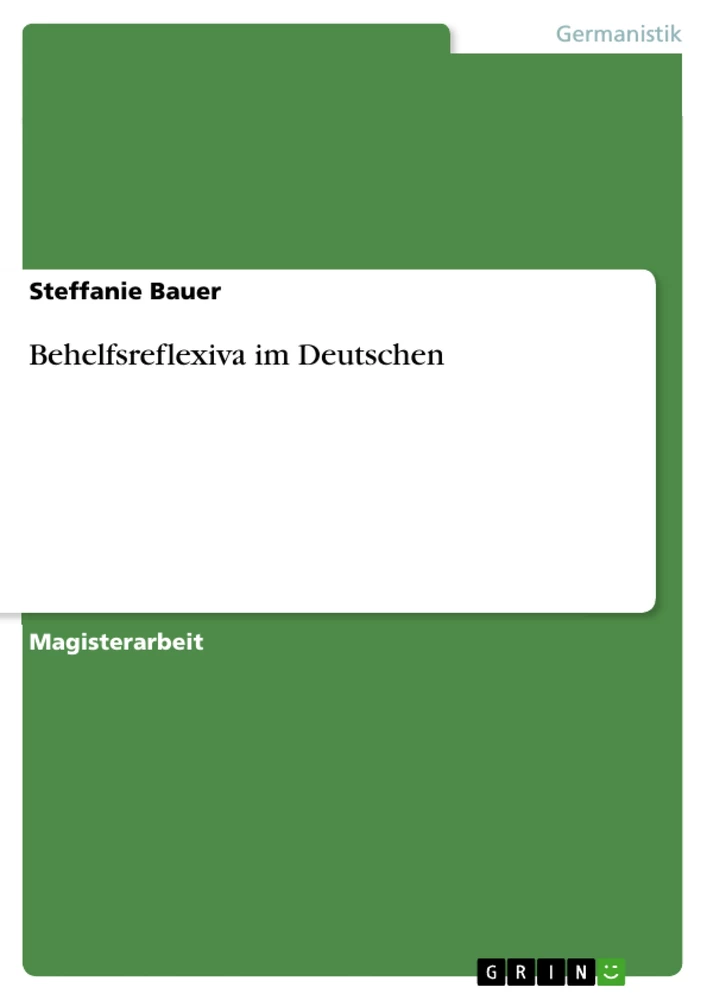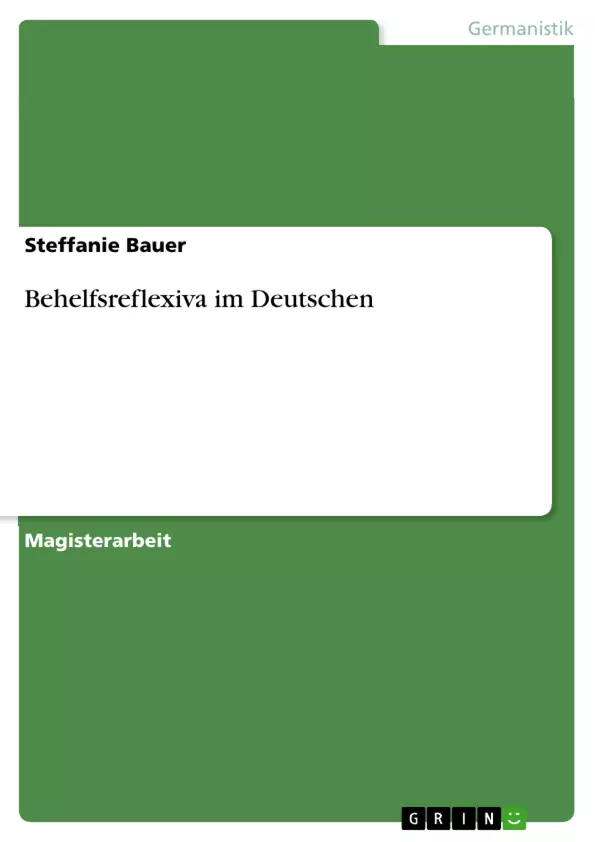Die folgende Arbeit befasst sich, um es in einem Satz zu sagen, mit der Frage, ob sich eigen-Ausdrücke wie Reflexiva verhalten, daher der frei erfundene Begriff Behelfsreflexiva .
Um dieser Frage nachzugehen, werden im folgenden zunächst verschiedene Quellen herangezogen, die sich allgemein mit der Reflexivierung im Deutschen beschäftigen, um einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu geben. Dazu gehören die Duden-Grammatik, ein Werk von Günther Grewendorf und die Grammatik des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim. Diese werden inhaltlich kurz wiedergegeben.
Danach wird Noam Chomskys Bindungstheorie kurz umrissen. Darauf aufbauend folgt die Darstellung des Ansatzes von Stephen Levinson, der diese Theorie aufnimmt und auf pragmatische Weise neu definiert. Er zeigt dabei einen historischen Verlauf der Entwicklung von Reflexiva auf. Am Ende dieser Arbeit wird versucht, eigen-Ausdrücke in eins der dort erwähnten Stadien einzuteilen.
Im weiteren Verlauf werden 1100 von der Homepage des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim zufällig ausgewählte Sätze auf die Frage hin untersucht, wie eigen-Ausdrücke dort verwendet, das heißt, gebunden werden. Die Ergebnisse werden in Kategorien eingeteilt, ausgezählt und dargestellt. Dabei werden alle Möglichkeiten der Bindung vorgestellt und an Beispielen illustriert.
Im Zuge dieser Auswertung wird noch die Frage versucht zu beantworten, ob die Verwendung eines vorangestellten Personalpronomens etwas an der Art der Bindung des eigen-Ausdrucks ändert und wenn dieses der Fall sein sollte, inwiefern.
Danach folgt ein kurzer Exkurs zum Bindungsverhalten des Wortes „seine“, um einen Vergleich zu dem von sein-eigen-Ausdrücken zu bekommen. Dazu werden 100 Sätze aus dem gleichen Korpus untersucht und tabellarisch dargestellt.
Die These, die zu bestätigen gilt, ist, dass sich eigen-Ausdrücke wie Reflexivpronomen im Sinne der Bindungstheorie Chomsky verhalten und dem entsprechenden Prinzip A, welches besagt, dass diese in ihrer Domäne gebunden sind, folgen. Eventuell resultierende Beweise oder Gegenbelege werden erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Behelfsreflexiva im Deutschen
- Reflexivierung im Deutschen
- Grewendorf
- Die Duden-Grammatik
- IDS-Grammatik
- Die zugrunde liegenden Theorien
- Chomsky und die Bindungstheorie
- Der Ansatz von Levinson
- Exkurs zu den Grice'schen Maximen
- Von „sich“ zu „eigen“
- Das Material
- „eigene“
- „eigenen“
- „eigener“
- „eigenes“
- „,seine eigene“
- „,seine eigenen“
- „,seinen eigenen“
- „,seinem eigenen“
- „,sein eigener“
- „,sein eigenes“
- Eine kurze Zusammenfassung
- Verwendung des Possessivpronomens
- Das Verhalten von „,seine“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, ob eigen-Ausdrücke im Deutschen sich wie Reflexiva verhalten, daher der Begriff Behelfsreflexiva. Dazu werden verschiedene Quellen zur Reflexivierung herangezogen und Chomskys Bindungstheorie sowie Levinsons pragmatischer Ansatz vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Analyse von 1100 Sätzen aus dem IDS-Korpus, um die Verwendung von eigen-Ausdrücken zu untersuchen.
- Analyse der Reflexivierung im Deutschen
- Anwendung von Chomskys Bindungstheorie auf eigen-Ausdrücke
- Empirische Untersuchung der Verwendung von eigen-Ausdrücken in einem Sprachkorpus
- Vergleich des Verhaltens von eigen-Ausdrücken mit dem Possessivpronomen „seine“
- Bewertung der These, dass sich eigen-Ausdrücke wie Reflexivpronomen verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und skizziert die Vorgehensweise, die verschiedene Quellen zur Reflexivierung und Bindungstheorie umfasst sowie eine empirische Analyse von Sprachdaten.
- Behelfsreflexiva im Deutschen: Dieses Kapitel beleuchtet die Reflexivierung im Deutschen anhand der Werke von Grewendorf, der Duden-Grammatik und der IDS-Grammatik. Es werden verschiedene Arten von Reflexivpronomen und Reflexivierungsregeln beschrieben.
- Die zugrunde liegenden Theorien: Dieses Kapitel erläutert Chomskys Bindungstheorie und Levinsons pragmatischen Ansatz, der die Theorie erweitert und einen historischen Verlauf der Entwicklung von Reflexiva aufzeigt.
- Von „sich“ zu „eigen“: Dieser Abschnitt behandelt den Übergang vom Reflexivpronomen „sich“ zu eigen-Ausdrücken.
- Das Material: Dieser Abschnitt analysiert ein Korpus von 1100 Sätzen, um die Verwendung von eigen-Ausdrücken in verschiedenen grammatikalischen Kontexten zu untersuchen. Es werden die Ergebnisse in Kategorien eingeteilt und an Beispielen illustriert.
- Eine kurze Zusammenfassung: Dieser Abschnitt fasst die Ergebnisse der Analyse der Verwendung von eigen-Ausdrücken zusammen.
- Verwendung des Possessivpronomens: Dieser Abschnitt untersucht das Verhalten des Possessivpronomens „seine“ in einem Korpus von 100 Sätzen und bietet einen Vergleich zu den Ergebnissen der Analyse von eigen-Ausdrücken.
- Das Verhalten von „,seine“: Dieser Abschnitt analysiert das Verhalten des Wortes „seine“ im Detail.
Schlüsselwörter
Reflexivpronomen, Behelfsreflexiva, Bindungstheorie, Chomsky, Levinson, Eigen-Ausdrücke, Sprachkorpus, empirische Analyse, Possessivpronomen, „sich“, „eigen“, „seine“
Was sind „Behelfsreflexiva“ im Deutschen?
Der Begriff bezieht sich auf Ausdrücke mit „eigen-“, die sich in bestimmten Kontexten ähnlich wie Reflexivpronomen (z. B. „sich“) verhalten.
Welche linguistische Theorie liegt der Untersuchung zugrunde?
Die Arbeit basiert primär auf Noam Chomskys Bindungstheorie und dem pragmatischen Ansatz von Stephen Levinson.
Was besagt das Prinzip A der Bindungstheorie für „eigen-“?
Prinzip A besagt, dass Reflexiva in ihrer lokalen Domäne gebunden sein müssen. Die Arbeit prüft, ob eigen-Ausdrücke dieser Regel folgen.
Wie wurde die Verwendung von eigen-Ausdrücken empirisch untersucht?
Es wurden 1100 zufällig ausgewählte Sätze aus dem Korpus des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim analysiert.
Gibt es einen Unterschied zwischen „eigen“ und dem Possessivpronomen „seine“?
Die Arbeit führt einen Vergleich durch und zeigt auf, wie sich das Bindungsverhalten von „seine“ von dem der „sein-eigen“-Ausdrücke unterscheidet.
Wie beeinflusst ein vorangestelltes Personalpronomen die Bindung?
Ein Teil der Untersuchung widmet sich der Frage, ob die Art der Bindung von „eigen-“ durch ein vorangestelltes Personalpronomen verändert wird.