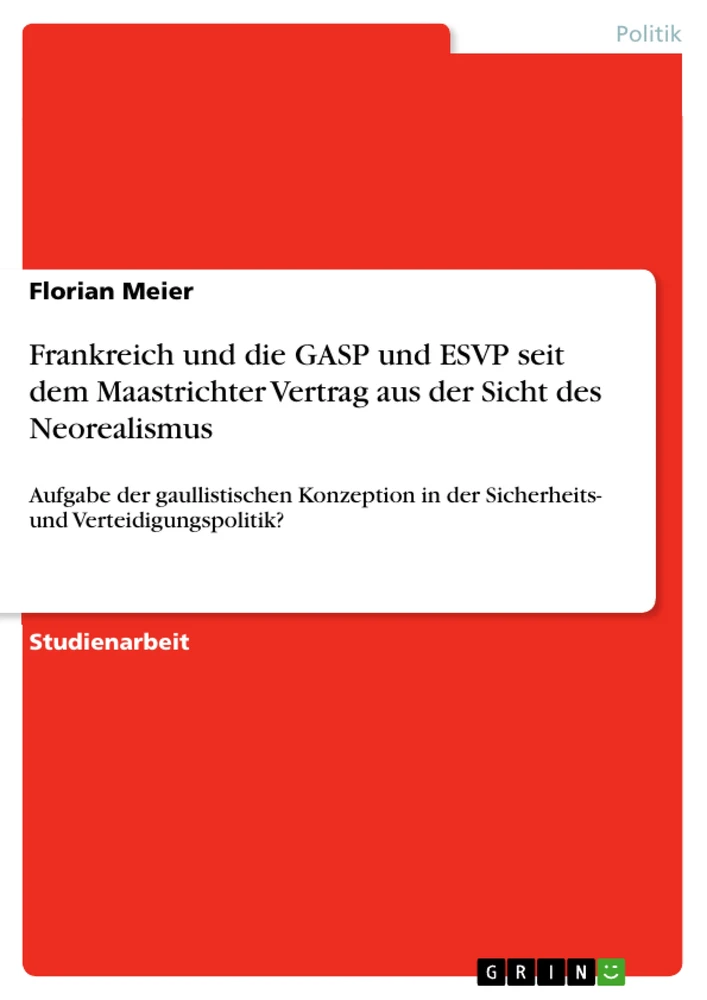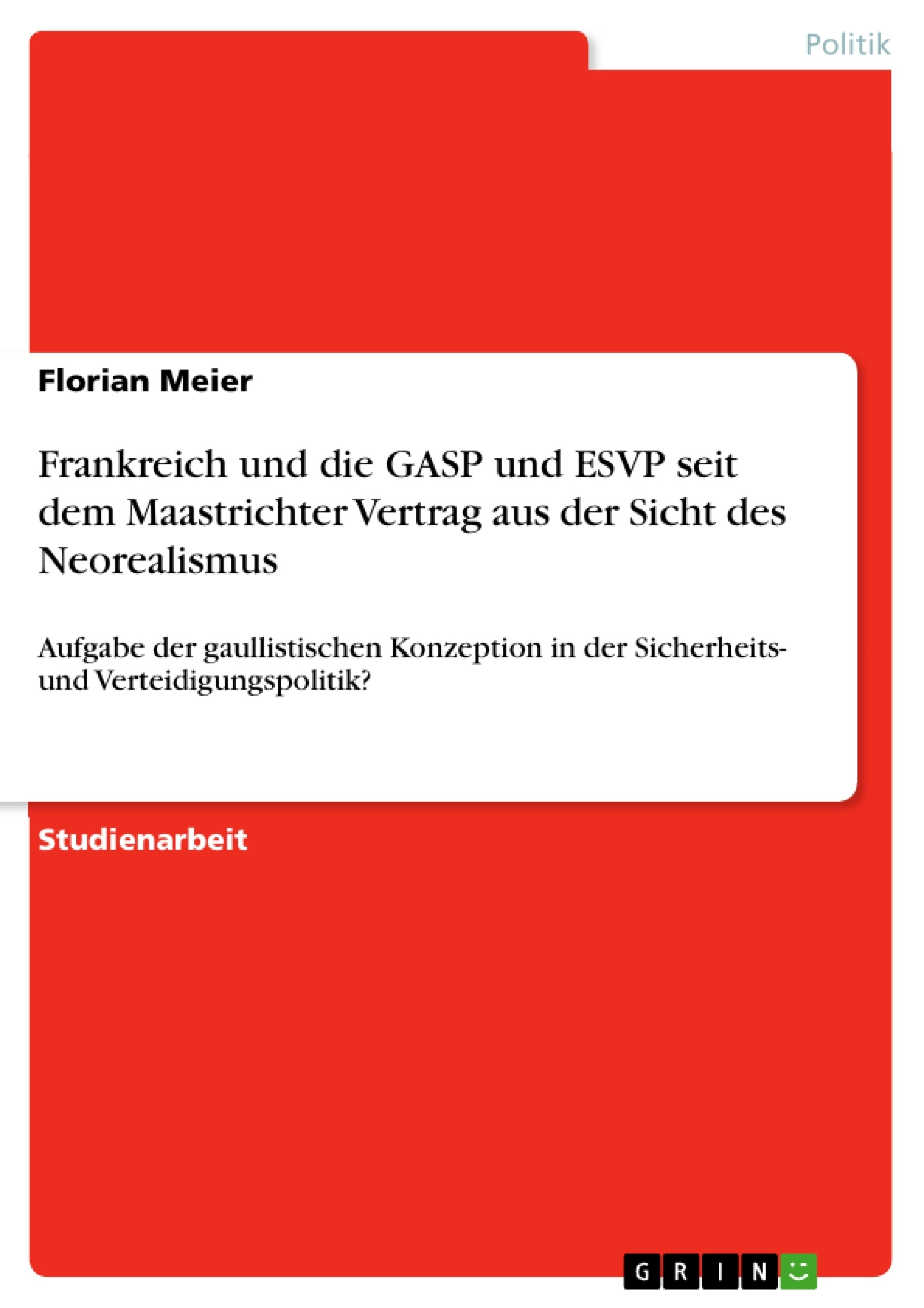[...]In dieser Ausarbeitung wird der Fokus jedoch auf einen spezifischen Bereich der französischen Außenpolitik gelegt: Im Mittelpunkt steht die französische Position in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik.
Um die heutige Position Frankreichs und Sarkozys Ambitionen in diesem Bereich zu verstehen, muss man bei einer Analyse einige Jahre zurückgehen, um einen geeigneten Ausgangspunkt zu haben. Hierbei rückt das Jahr 1990 in den Fokus, da hier ein weltpolitischer Umbruch stattfand, der Frankreich dazu zwang, seine gesamte Außen- und Sicherheitspolitik und damit auch seine Europapolitik zu überdenken[...]
-Wie sollte eine politische Neuorientierung im internationalen System aussehen?
-Von welchen Leitlinien und welchem Muster sollte die folgende Außenpolitik des Landes bestimmt sein?
[...]Als theoretische Grundlage dieser Arbeit wird der Neorealismus nach Kenneth Neal Waltz verwendet. Die Theorie dient als besonders geeignetes Analyseraster, da mit dem Zusammenbruch des Ostblocks eine Veränderung in der Struktur der internationalen Beziehungen stattfand, was im Sinne des Neorealismus auch eine Anpassung des außenpolitischen Verhaltens eines Staates nach sich ziehen sollte.
[...]Darauf folgend wird die Rolle Frankreichs beim Vertrag von Maastricht erläutert, der die Gründung einer „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ (im Folgenden „GASP“) beinhaltete. Danach werden dann die Ergebnisse des Amsterdamer Vertrags vorgestellt, bevor der St. Malo-Gipfel erwähnt wird, welcher die Gründung einer „Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ (im Folgenden „ESVP“) nach sich zog[...]
Darauf folgend wird dann untersucht, inwieweit der weltpolitische Umbruch im internationalen System Frankreichs Sicherheits- und Verteidigungspolitik verändert oder auch erneuert hat. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen, wie das außenpolitische Verhalten Frankreichs hierbei aus der Argumentation des Neorealismus heraus begründet werden kann. Hierbei wird die zentrale Frage der Arbeit beantwortet:
-Ist die Ideologie des Gaullismus nach wie vor prägend für die französische Außenpolitik oder kann man im Bereich der GASP und ESVP eine Aufgabe der gaullistischen Konzeption erkennen?
Nach dieser Darstellung werden dann noch mal die Ergebnisse im Fazit zusammengefasst vorgestellt. Dabei wird noch die Frage aufgeworfen, warum die Anwendung des Neorealismus in dieser Ausarbeitung problematisch sein könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlage: Der Neorealismus nach Kenneth N. Waltz
- Begriffliche Klärung: System, Struktur und Einheit im Neorealismus
- Drei Annahmen zu den Staaten
- Drei Kriterien zur Bestimmung politischer Strukturen
- Das Prinzip des „Balancing“ und „Bandwagoning” und die Rolle internationaler Organisationen
- Frankreich und seine Rolle bei der GASP und ESVP - Entwicklung nach dem Ende des Ost-West-Konflikts
- Vorbedingungen und Ausgangslage Frankreichs vor dem Maastrichter Vertrag
- Die Gestaltung der GASP durch den Maastrichter Vertrag im Jahre 1992
- Der „,Monsieur PESC (Politique étrangère et de sécurité commune, GASP)\" und die weiteren Entwicklungen durch den Vertrag von Amsterdam im Jahre 1997
- Der Gipfel von St. Malo 1998, Gründung der ESVP und der Nizzaer Vertrag
- Ausblick auf die GASP und ESVP-Entwicklung unter Nicolas Sarkozy
- Zwischenfazit
- Frankreichs Politik in der GASP und ESVP aus der Sicht des Neorealismus: Aufgabe der gaullistischen Konzeption?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die französische Position in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik im Lichte des Neorealismus und untersucht, ob der weltpolitische Umbruch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts Frankreichs Sicherheits- und Verteidigungspolitik verändert oder erneuert hat.
- Die theoretischen Grundlagen des Neorealismus nach Kenneth N. Waltz
- Die Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) und der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) nach dem Maastrichter Vertrag
- Die Rolle Frankreichs in der ESVP und GASP
- Die Frage, ob die gaullistische Konzeption in der französischen Außenpolitik weiterhin prägend ist oder ob eine Aufgabe dieser Konzeption in der GASP und ESVP zu beobachten ist
- Die Anwendung des Neorealismus als Analyseraster für die französische Außenpolitik im Kontext der ESVP und GASP
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den Kontext der französischen Außenpolitik im Wandel nach dem Ende des Ost-West-Konflikts beschreibt. Anschließend stellt sie die theoretische Grundlage des Neorealismus nach Kenneth N. Waltz dar und erläutert die wichtigsten Annahmen und Konzepte dieser Theorie. Das dritte Kapitel widmet sich der Entwicklung der GASP und ESVP und beleuchtet Frankreichs Rolle bei der Gestaltung dieser politischen Rahmenbedingungen. Es analysiert die französischen Positionen zu wichtigen Verträgen und Gipfeltreffen, die die europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik geprägt haben. Im vierten Kapitel wird die Frage untersucht, inwieweit die gaullistische Konzeption in der französischen Außenpolitik weiterhin prägend ist und ob eine Aufgabe dieser Konzeption in der GASP und ESVP zu beobachten ist. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und die Anwendung des Neorealismus als Analyseraster für die französische Außenpolitik kritisch reflektiert.
Schlüsselwörter
Neorealismus, Kenneth N. Waltz, Frankreich, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, GASP, ESVP, Gaullismus, Europapolitik, Mittelmeerunion, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac
Häufig gestellte Fragen
Was besagt der Neorealismus nach Kenneth Waltz?
Der Neorealismus erklärt das Verhalten von Staaten primär durch die Struktur des internationalen Systems (Anarchie) und die Machtverteilung, weniger durch interne Merkmale der Staaten.
Was ist der Unterschied zwischen GASP und ESVP?
Die GASP (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik) ist der breitere Rahmen der EU-Außenpolitik. Die ESVP (Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik) ist ein Teilbereich, der sich speziell auf militärische und krisenrelevante Aufgaben konzentriert.
Welche Rolle spielt der Gaullismus in der französischen Außenpolitik?
Der Gaullismus strebt nach nationaler Unabhängigkeit, Größe (Grandeur) und einer Führungsrolle Frankreichs in Europa, oft in Abgrenzung zum Einfluss der USA.
Wie veränderte das Ende des Ost-West-Konflikts Frankreichs Politik?
Der Umbruch zwang Frankreich dazu, seine Sicherheitsstrategie zu überdenken und sich stärker in europäische Strukturen zu integrieren, um seinen Einfluss in einem veränderten internationalen System zu wahren.
Was war die Bedeutung des Gipfels von St. Malo 1998?
In St. Malo legten Frankreich und Großbritannien den Grundstein für eine eigenständige europäische Verteidigungskapazität, was zur formellen Gründung der ESVP führte.
- Arbeit zitieren
- Florian Meier (Autor:in), 2008, Frankreich und die GASP und ESVP seit dem Maastrichter Vertrag aus der Sicht des Neorealismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154445