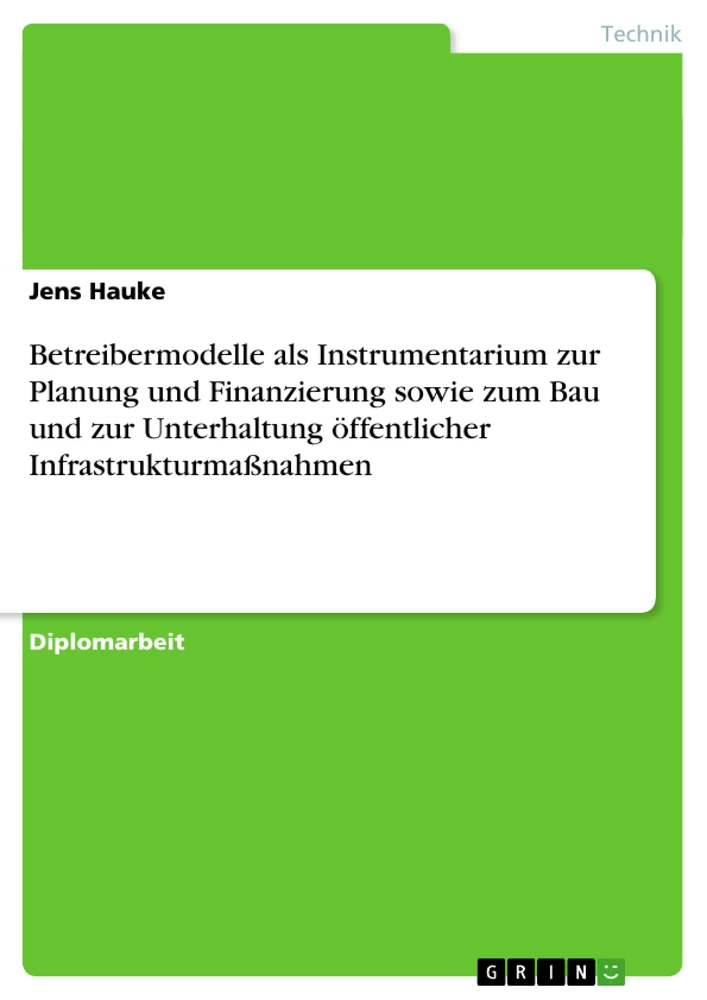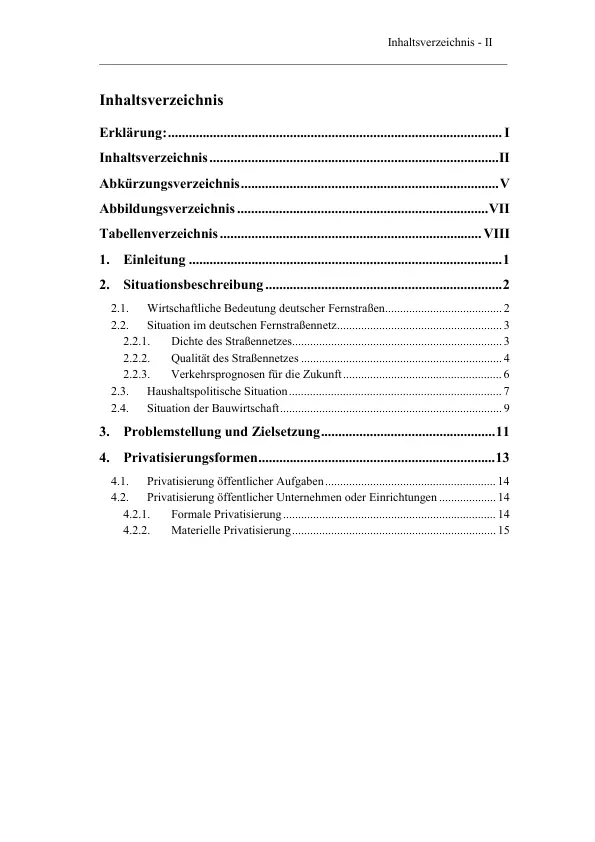1. Einleitung
In den letzten Jahren wird angesichts der zunehmend leeren öffentlichen Kassen und der sich seit Jahren in der Krise befindlichen Bauindustrie, bei gleichzeitig erforderlichen Investitionen im Infrastrukturbereich, immer wieder über Möglichkeiten der Privatisierung öffentlicher Aufgaben nachgedacht.
Zu diesem Zweck werden im Rahmen dieser Diplomarbeit Modelle der
privatwirtschaftlich-öffentlichen Zusammenarbeit als Instrumentarium zur Bereitstellung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen – insbesondere im Straßensektor – aufgezeigt und diskutiert.
Dazu wird zunächst im folgenden Kapitel auf die allgemeine Situation im
Straßenbau, die Lage der öffentlichen Haushalte sowie die Situation der Bauindustrie eingegangen.
In Kapitel 3 wird aus der gegebenen Situation die eigentliche Problemstellung hergeleitet.
Anschließend wird im 4. Kapitel ein kurzer Überblick über den Begriff der Privatisierung gegeben, bevor Kapitel 5 exemplarisch einige im kommunalen Bereich angewandte Modelle vorstellt, die es ermöglichen, private Unternehmen in die Erfüllung ehemals öffentlicher Aufgaben einzubeziehen.
Nach einer Erörterung der rechtlichen Grundlagen des Straßensektors in Kapitel 6 werden in Kapitel 8 im Rahmen einer Bestandsaufnahme die im Straßenbau angewandten Modelle vorgestellt.
In Kapitel 9 wird dann anhand der schon praktizierten Modelle überprüft, inwieweit sich die Privatisierungsmöglichkeiten der Kommunen auf den Bereich der Straße übertragen lassen und ob sich die gesteckten Ziele dadurch erreichen lassen.
In der Schlussbemerkung schließlich wird ein Fazit aus den gewonnenen
Erkenntnissen gezogen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Situationsbeschreibung
- Wirtschaftliche Bedeutung deutscher Fernstraßen
- Situation im deutschen Fernstraßennetz
- Dichte des Straßennetzes
- 2. Qualität des Straßennetzes
- 2.1. Verkehrsprognosen für die Zukunft
- 2.2. Haushaltspolitische Situation
- 2.3. Situation der Bauwirtschaft
- 3. Problemstellung und Zielsetzung
- 4. Privatisierungsformen
- 4.1. Privatisierung öffentlicher Aufgaben
- 4.2. Privatisierung öffentlicher Unternehmen oder Einrichtungen
- 4.2.1. Formale Privatisierung
- 4.2.2. Materielle Privatisierung
- 5. PPP Modelle im Kommunalen Bereich
- 5.1. Organisationsformen
- 5.1.1. Dienstleistungsmodell
- 5.1.2. Konzessionsmodell
- 5.1.3. Kooperationsmodell
- 5.1.4. Betreibermodell
- 5.2. Finanzierungsformen
- 5.2.1. Leasing Finanzierung
- 5.2.1.1. Funktionsweise
- 5.2.1.1.1. Sale and lease back Verfahren
- 5.2.1.1.2. Cross Border Leasing
- 5.2.1.2. Steuerrechtliche Aspekte
- 5.2.2. Fondsfinanzierung
- 5.2.3. Miet-/Mietkauf Modell
- 5.2.4. Factoring (Forfaitierung)
- 5.2.5. Projektfinanzierung
- 5.3. Zusammenfassung und Beurteilung
- 6. Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen
- 6.1. Die Straße als öffentliche Sache
- 6.2. Straßenbaulast
- 6.3. Zuständigkeiten
- 6.4. Eigentumsverhältnisse
- 6.5. Gebühren
- 6.5.1. Europarechtliche Regelungen
- 6.5.2. Bundes- und landesrechtliche Regelungen
- 6.6. Fazit
- 7. Wertschöpfungskette im Straßenbau
- 8. Modelle im Straßenbau
- 8.1. Sonderformen der Haushaltsfinanzierung
- 8.1.1. Modelle der privaten Vorfinanzierung
- 8.1.1.1. Bund Modell
- 8.1.1.2. Mogendorfer Modell
- 8.1.1.3. Zusammenfassung und Bewertung
- 8.1.2. Funktionsbauvertrag
- 8.1.2.1. Funktionale Leistungsbeschreibung
- 8.1.2.2. Leistungsinhalte des Funktionsbauvertrages
- 8.1.2.3. Zusammenfassung und Bewertung
- 8.2. Nutzerfinanzierte Modelle
- 8.2.1. F-Modell
- 8.2.1.1. Allgemeine Darstellung des Modells
- 8.2.1.2. Darstellung am Beispiel der Travequerung Lübeck
- 8.2.1.3. Bewertung
- 8.2.2. Ausbaumodell (A-Modell)
- 8.2.2.1. Einführung der Lkw-Maut
- 8.2.2.2. Leistungsinhalte beim A-Modell
- 8.2.2.3. Bewertung
- 9. Diskussion und Beurteilung
- 9.1. Anwendbarkeit der kommunalen Modelle
- 9.1.1. Organisationsmodelle
- 9.1.2. Finanzierungsmodelle
- 9.2. Auslagerung der Kosten aus dem Haushalt
- 9.3. Kostensenkung in der Planung
- 9.4. Auswirkungen auf die Nutzer
- 10. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Privatisierung von Fernstraßen in Deutschland. Sie untersucht die verschiedenen Formen der Privatisierung, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen auf die Nutzer.
- Die verschiedenen Formen der Privatisierung von Fernstraßen
- Die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Privatisierung
- Die Auswirkungen der Privatisierung auf die Nutzer
- Die Kosten und die Finanzierung der Privatisierung
- Die Rolle der Politik bei der Privatisierung von Fernstraßen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung in das Thema und beschreibt die aktuelle Situation im deutschen Fernstraßennetz. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Qualität des Straßennetzes und den Verkehrsprognosen für die Zukunft. Kapitel 3 erläutert die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 4 befasst sich mit den verschiedenen Formen der Privatisierung, die im Kontext von Fernstraßen relevant sind. Kapitel 5 stellt verschiedene PPP-Modelle im kommunalen Bereich vor und analysiert deren Organisation und Finanzierung. Kapitel 6 beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Privatisierung von Fernstraßen. Kapitel 7 beschreibt die Wertschöpfungskette im Straßenbau. Kapitel 8 analysiert verschiedene Modelle im Straßenbau, insbesondere Sonderformen der Haushaltsfinanzierung und Nutzerfinanzierte Modelle. Kapitel 9 diskutiert die Anwendbarkeit der kommunalen Modelle und deren Auswirkungen auf die Nutzer.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter und Themen: Privatisierung, Fernstraßen, PPP-Modelle, Rechtliche Rahmenbedingungen, Finanzierung, Nutzer, Verkehr, Straßenbau, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Betreibermodelle im Straßenbau?
Betreibermodelle sind Formen der öffentlich-privaten Zusammenarbeit (PPP), bei denen private Unternehmen Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb von Infrastrukturmaßnahmen übernehmen.
Welche Vorteile bietet die Privatisierung öffentlicher Infrastruktur?
Ziel ist die Entlastung öffentlicher Haushalte, die Nutzung privaten Kapitals und Know-hows sowie eine potenzielle Effizienzsteigerung und Kostensenkung in der Planung.
Was versteht man unter dem A-Modell und dem F-Modell?
Das A-Modell (Ausbaumodell) basiert auf der Vergütung durch die Lkw-Maut, während das F-Modell (Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz) eine direkte Nutzergebühr (Maut) für alle Fahrzeuge vorsieht.
Welche Finanzierungsformen gibt es bei PPP-Modellen?
Gängige Formen sind Leasing-Finanzierung (z.B. Sale-and-lease-back), Projektfinanzierung, Forfaitierung oder Fondsmodelle.
Sind Straßen in Deutschland „öffentliche Sachen“?
Ja, rechtlich gesehen sind Straßen öffentliche Sachen, was besondere Anforderungen an die Eigentumsverhältnisse und die Straßenbaulast bei Privatisierungsvorhaben stellt.
Was ist das „Sale and lease back“-Verfahren?
Dabei verkauft die öffentliche Hand eine Infrastruktur an einen Privaten und least sie sofort zurück, um kurzfristig Liquidität zu gewinnen und Kosten zu verteilen.
- Citar trabajo
- Jens Hauke (Autor), 2003, Betreibermodelle als Instrumentarium zur Planung und Finanzierung sowie zum Bau und zur Unterhaltung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15444