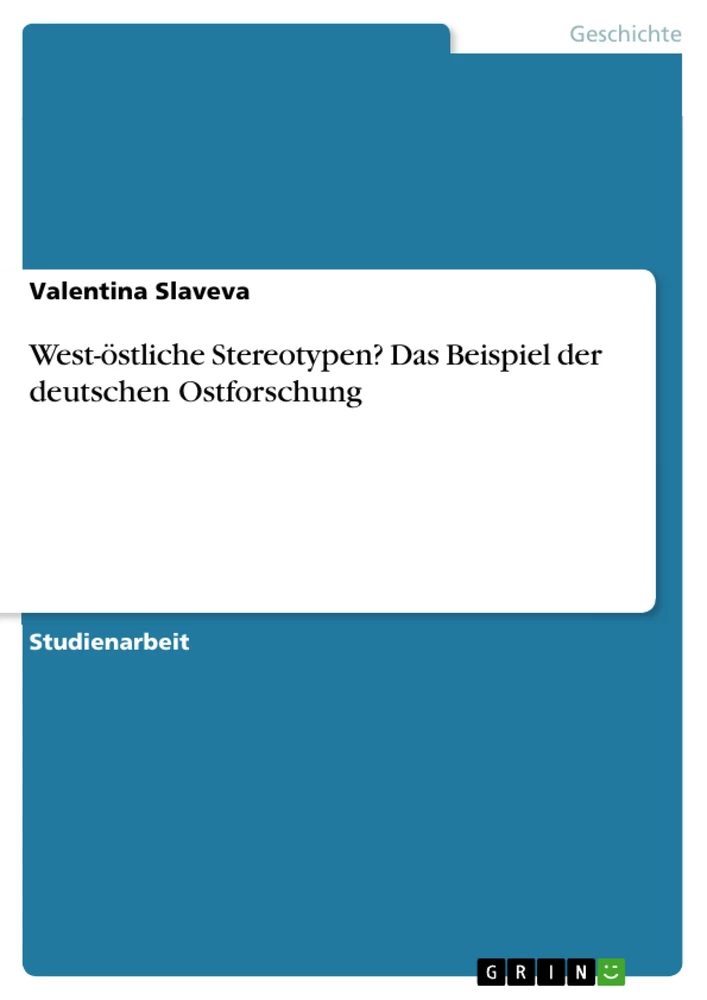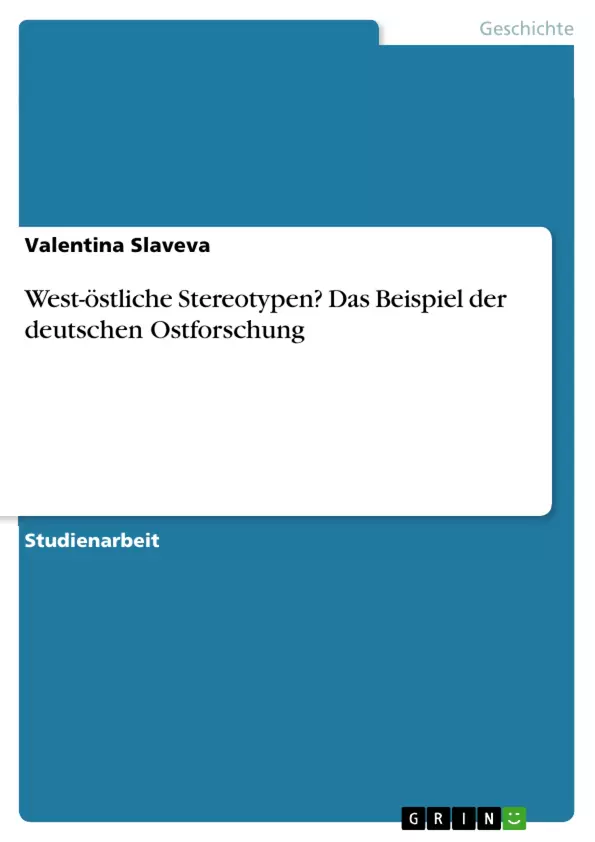Die Ursache für die Herausbildung und Verwendung von Stereotypen und Feindbildern sieht die historische Forschung in politische Krisen, Kriegen und damit verbundenen gesellschaftlichen Umbrüchen. Kennzeichnend für solche Extremsituationen ist, dass sie verunsichernd, bedrohlich und desorientierend auf die Menschen wirken können, was ihr Verhalten und ihre Denkweise besonders anfällig für Stereotype macht.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde die deutsche Gesellschaft, einerseits, durch die Niederlage und die Auflösung des Deutschen Reiches und anderseits durch die Gebietsverluste im Osten schwer erschüttert. Aus dem Wunsch nach Revision des Versailler Friedenvertrages und den Nachkriegsgrenzen entstand die Ostforschung, die sich nicht nur auf das Gebiet der Geschichtswissenschaft beschränkte, sondern auch andere Disziplinen wie Soziologie, Geographie, Wirtschaft und andere auffasste. Kennzeichnend für die deutsche Ostforschung war ihre starke Politisierung und deutschzentrierte Sicht der Geschichte, wobei das deutsche Volk in den Vordergrund der historischen Ereignisse gestellt wurde und die osteuropäischen Völker nur für die eigenen Forschung eine Relevanz hatten.
In den neu entstandenen Staaten Osteuropas, sowie in allen Ländern, die nach dem Krieg Teile ihres Territoriums verloren hatten, war die Zwischenkriegszeit durch eine Schwäche der Demokratie und zugleich durch eine Radikalisierung des Nationalismus und Antisemitismus gezeichnet. Da das Judentum in Osteuropa im Vergleich zu Westeuropa eine bedeutende Minderheit bildete, war es, einerseits, dem Antisemitismus der Staatsvölker ausgesetzt und wurde, anderseits, als Hindernis von den Ostforschern für die geplante deutsche Neuordnung des Raumes betrachtet. All dies kam zum Ausdruck durch zahlreiche antisemitische Publikationen in der Weimarer Republik, in denen das Judentum aus deutschzentrierter Sicht und anhand stereotyper und verzerrter Bilder dargestellt wurde.
In dieser Hausarbeit werden solche west-östliche Stereotype im Aufsatz „Deutschtum und Judentum in Osteuropa“ untersucht, dessen Autor Peter-Heinz Seraphim als Ostforscher in der Zwischenkriegszeit tätig war und aufgrund seiner Beschäftigung in der Judenforschung als „Judenexperte“ während des nationalsozialistischen Regimes bekannt war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Peter-Heinz Seraphim – zu seinem Leben und Werk
- 1.1. Kurze Biographie
- 1.2,,Deutschtum und Judentum in Osteuropa“
- II. Deutsches Selbstbild und jüdisches Feindbild in Seraphims Werk
- III. Polarisierte Bilder: deutsche Kolonisatoren und jüdische Einwanderer
- 3.1. Gründe und Ablauf der Wanderungsbewegung bei Deutschen und Juden
- 3.1.1 Das wirtschaftliche Motiv
- 3.1.2. Der Stereotyp des jüdischen Wanderers
- 3.2. Deutsche Gründer und Schöpfer neuer Werte und jüdische Unproduktivität
- 3.3. Deutsche Wegbereiter und Pioniere und der Stereotyp des Parasitentums
- 3.1. Gründe und Ablauf der Wanderungsbewegung bei Deutschen und Juden
- IV. Der „Kampf ums Dasein“ - deutsch-jüdische Verhältnisse im Wirtschaftsleben
- 4.1. Der Stereotyp vom jüdischen Aufsteigertum
- 4.2. „Deutsche Wirtschaftspioniere und jüdische Finanzmänner“
- 4.3. Wirtschaftliche Position von Deutschtum und Judentum nach dem Ersten Weltkrieg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert west-östliche Stereotype im Aufsatz „Deutschtum und Judentum in Osteuropa“ von Peter-Heinz Seraphim. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie Seraphim, als ein bedeutender Ostforscher der Zwischenkriegszeit und ,,Judenexperte“ im nationalsozialistischen Regime, das Verhältnis zwischen Deutschtum und Judentum in Osteuropa aus einer deutschzentrierten Sicht darstellte.
- Deutsche Ostforschung und ihre Rolle in der Zwischenkriegszeit
- Die Konstruktion von Stereotypen und Feindbildern im Kontext von Krisen und gesellschaftlichen Umbrüchen
- Das Selbstbild der Deutschen in Osteuropa und die Konstruktion eines negativen Bildes des Judentums
- Der Einfluss von Stereotypen und Feindbildern auf die deutsche Politik und Gesellschaft
- Die Rolle des Judentums in der deutschen Ostforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Entstehungshintergrund der deutschen Ostforschung und die Rolle von Stereotypen und Feindbildern in diesem Kontext. Sie stellt den Fokus auf die politische Krisenlage nach dem Ersten Weltkrieg und die Entstehung einer deutschzentrierten Sicht auf die Geschichte Osteuropas.
Kapitel I gibt einen Einblick in das Leben und Werk von Peter-Heinz Seraphim, einem einflussreichen Ostforscher der Zwischenkriegszeit. Es beschreibt Seraphims Biographie und seinen Aufstieg zum ,,Judenexperten“ im nationalsozialistischen Regime.
Kapitel II analysiert das deutsche Selbstbild und das jüdische Feindbild in Seraphims Werk. Es untersucht die Verwendung von Stereotypen und Vorurteilen als Instrument der politischen und gesellschaftlichen Konstruktion von Identitäten.
Kapitel III erforscht die Darstellung von Deutschen und Juden als "Kolonisatoren" und "Einwanderer" in Osteuropa. Es betrachtet dabei die ökonomischen und sozialen Gründe für die Migration, sowie die damit verbundenen Stereotype.
Kapitel IV befasst sich mit dem "Kampf ums Dasein" zwischen Deutschen und Juden im Wirtschaftsleben. Es analysiert die Stereotype vom jüdischen Aufsteigertum und dem "jüdischen Finanzmann" im Kontext der deutschen Ostforschung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Ostforschung, Stereotype, Feindbilder, Judentum, Deutschtum, Wirtschaftsgeschichte, Nationalsozialismus, Politik, Gesellschaft und Geschichte Osteuropas.
- Quote paper
- Valentina Slaveva (Author), 2009, West-östliche Stereotypen? Das Beispiel der deutschen Ostforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154560