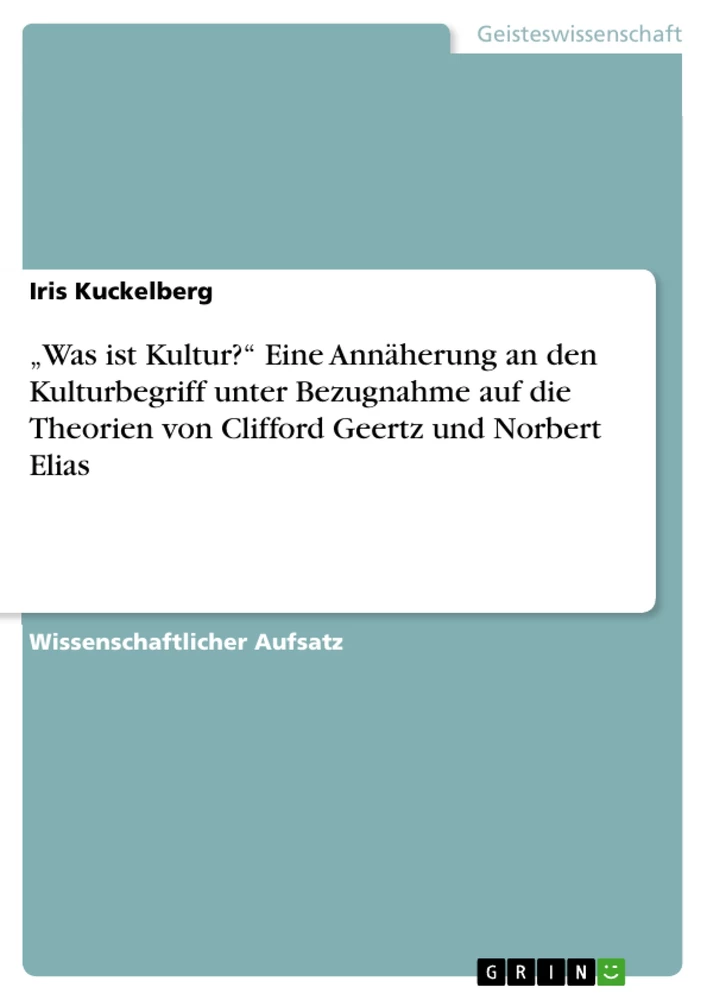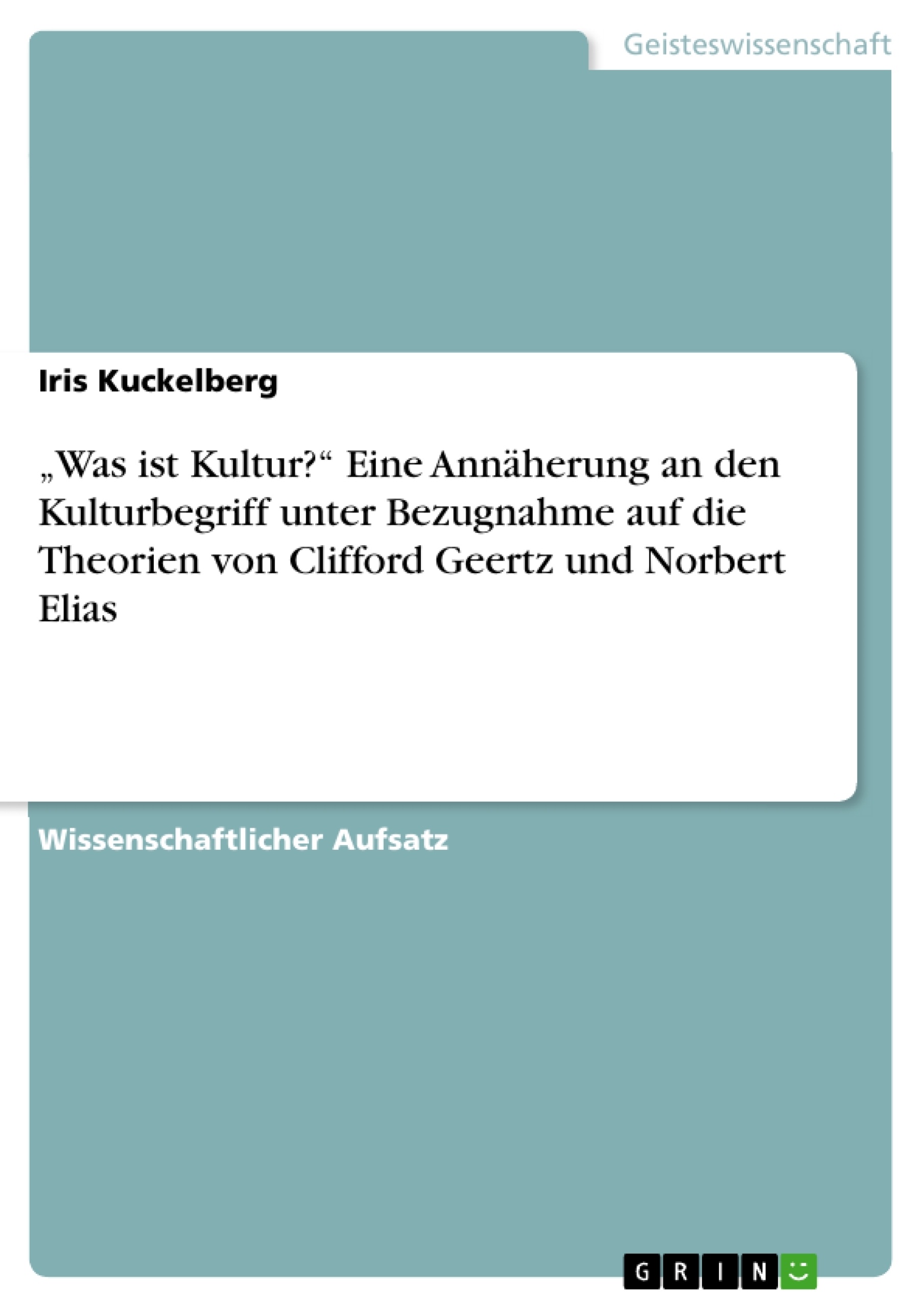Zur Wortbedeutung der Kultur
Der Begriff Kultur entstammt dem lateinischen Wort „cultura“ 1. „Cultura“ ist von „colere“ entlehnt, dessen Wortfamilie weit reichend ist und beispielsweise „praecolere“ (vorarbeiten), „recolere“ (wiederherstellen) oder „agri culta“ (bestellte Äcker) umfasst. „Cultura“ an sich bezieht sich auf die Agrartätigkeit und die dafür notwendige Basis, das Ackerland. Die lateinische Bedeutung, wie pflegen oder anbauen, impliziert, dass „Kultur“ als Gegensatz zur Natur bis ins 19. Jahrhundert gebraucht wurde. In Begriffen wie Obst-, Misch- oder Monokultur erkennt man heute noch den agrarischen Ursprung der Kultur 2. Allerdings wird heute mit Kultur vornehmlich die Kunst in all ihren Facetten in Verbindung gebracht. Grundlegend für das Entstehen einer „höheren“ Kultur ist die menschliche Begabung zu sinnhaftem und nicht allein triebgesteuertem Verhalten. 3 Dies ist der bedeutende Unterschied zur Tierwelt und macht den Menschen somit zu einem Kulturwesen, dessen Verhalten sich an Bedeutungen orientiert und welche darüber hinaus auch erst durch sein Verhalten generiert werden. In der Anthropologie entspricht Kultur den verschiedenen Werten, Normen, Bräuchen und Riten, die sich in den unterschiedlichen Gesellschaften entwickelt haben. Nach Sackmann (2002) lässt sich Kultur definieren als die von einer Gruppe gemeinsam gehaltenen grundlegenden Überzeugungen, die für eine Gruppe insgesamt typisch sind. 4 Die Kultur einer Einheit beeinflusst Wahrnehmung, Denken, Handeln und Fühlen der Gruppenmitglieder und kann sich in ihren Handlungen und Artefakten manifestieren. Die Überzeugungen der Individuen einer Kultur sind nicht bewusst gehalten, sondern haben sich aus der Erfahrung der Gruppe entwickelt, was impliziert, dass sie gelernt sind und an neue Gruppenmitglieder weitergegeben werden. Somit kommt es sukzessive zu Strukturwandlungen interdependenter Individuen in einer Gesellschaft.5 Dabei existiert generell keine „richtige“ oder „eindeutige“ Kultur, sondern es gibt nur eine, die zur Umwelt am besten passt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zur Wortbedeutung der Kultur
- 2. Zur Geschichte des Kulturbegriffs
- 2.1 Antike Kultur
- 2.2 Moderne Kultur
- 2.3 Kulturentwicklung in der Aufklärung
- 3. Kulturbegriff nach Elias und Geertz
- 3.1 Der Kulturbegriff in Anlehnung an die Theorie Norbert Elias´
- 3.2 Der Kulturbegriff in Anlehnung an die Theorie Clifford Geertz
- 3.2 Kultur und soziale Struktur
- 4. Kultur und Ihr Wandel
- 5. Zusammenfassende Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, den vielschichtigen Kulturbegriff zu beleuchten und verschiedene theoretische Ansätze zu vergleichen. Der Fokus liegt dabei auf den Theorien von Clifford Geertz und Norbert Elias. Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Kulturbegriffs und analysiert dessen Bedeutung in verschiedenen Kontexten.
- Die historische Entwicklung des Kulturbegriffs von der Antike bis zur Aufklärung.
- Der Wandel der Bedeutung von "Kultur" im Laufe der Zeit.
- Eine vergleichende Analyse der Kulturbegriffe nach Elias und Geertz.
- Die Beziehung zwischen Kultur und sozialer Struktur.
- Der Einfluss von Kultur auf Wahrnehmung, Denken, Handeln und Fühlen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema "Was ist Kultur?" ein und kündigt die Auseinandersetzung mit den Theorien von Clifford Geertz und Norbert Elias an. Sie beginnt mit einer etymologischen Betrachtung des Begriffs "Kultur", der aus dem lateinischen "cultura" stammt und ursprünglich mit landwirtschaftlicher Tätigkeit in Verbindung gebracht wurde. Die Einleitung hebt die Bedeutung des menschlichen, sinnhaften Verhaltens als Grundlage für Kultur hervor und skizziert den anthropologischen Aspekt des Begriffs, der Werte, Normen, Bräuche und Riten umfasst. Die Einleitung stellt die zentralen Fragen und den methodischen Ansatz der Arbeit vor, indem sie die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem komplexen Kulturbegriff ankündigt.
2. Zur Geschichte des Kulturbegriffs: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung des Kulturbegriffs von der Antike bis zur Aufklärung. In der Antike war der Begriff eng mit dem lateinischen Ursprung verbunden und beschränkte sich auf die Kultivierung von Dingen. Die moderne Entwicklung des Kulturbegriffs wird mit dem Werk von Samuel von Pufendorf diskutiert, der Kultur und Zivilisation gleichsetzt. Der Begriff "Kultur" entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem Sammelbegriff für Kunst, Rituale, Werte und Normen, insbesondere mit dem Aufstieg des Bürgertums und der Aufklärung, die Kultur für breitere Schichten zugänglich machten. Der Kontrast zwischen Zivilisation und vermeintlich "primitiven" Kulturen wird angesprochen, und unterschiedliche Perspektiven (z.B. Rousseau) auf den Wert von Kultur im Vergleich zum Naturzustand werden erwähnt.
3. Kulturbegriff nach Elias und Geertz: Das Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der Kulturbegriffe von Norbert Elias und Clifford Geertz. Es vergleicht beide Theorien und diskutiert deren jeweilige Stärken und Schwächen. Die Darstellung der Theorie von Elias, die möglicherweise den Prozess der Zivilisation und die Entstehung von Kultur als ein Zusammenspiel von sozialen Kräften beleuchtet, wird mit den Ansatz von Geertz gegenübergestellt, der wahrscheinlich einen interpretativen und symbolischen Ansatz verfolgt. Die Diskussion über "Kultur und soziale Struktur" vertieft die Beziehung zwischen kulturellen Phänomenen und gesellschaftlichen Ordnungen. Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und präsentiert die beiden Haupttheoretiker und ihre Ansichten über Kultur.
Schlüsselwörter
Kulturbegriff, Kulturgeschichte, Norbert Elias, Clifford Geertz, Zivilisation, Aufklärung, Anthropologie, Soziologie, soziale Struktur, Werte, Normen, Rituale.
Häufig gestellte Fragen zu "Was ist Kultur?"
Was ist der Inhalt des Textes "Was ist Kultur?"?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Kulturbegriff. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung des Kulturbegriffs und einem Vergleich der Theorien von Norbert Elias und Clifford Geertz.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die historische Entwicklung des Kulturbegriffs von der Antike bis zur Aufklärung, den Wandel der Bedeutung von "Kultur" im Laufe der Zeit, einen Vergleich der Kulturbegriffe nach Elias und Geertz, die Beziehung zwischen Kultur und sozialer Struktur sowie den Einfluss von Kultur auf Wahrnehmung, Denken, Handeln und Fühlen. Es wird auch die etymologische Bedeutung des Wortes "Kultur" beleuchtet.
Welche Theorien werden im Text verglichen?
Der Text vergleicht die Theorien von Norbert Elias und Clifford Geertz zum Kulturbegriff. Elias' Theorie beleuchtet möglicherweise den Prozess der Zivilisation und die Entstehung von Kultur als Zusammenspiel sozialer Kräfte, während Geertz einen interpretativen und symbolischen Ansatz verfolgt.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die den Kulturbegriff einführt und die Forschungsfrage formuliert. Es folgt ein Kapitel zur Geschichte des Kulturbegriffs, gefolgt von einem Kapitel, das die Theorien von Elias und Geertz detailliert darstellt und vergleicht. Der Text schließt mit einer Zusammenfassung der Erkenntnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter, die den Text beschreiben, sind: Kulturbegriff, Kulturgeschichte, Norbert Elias, Clifford Geertz, Zivilisation, Aufklärung, Anthropologie, Soziologie, soziale Struktur, Werte, Normen, Rituale.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Der Text umfasst Kapitel zu: 1. Einleitung (Einführung in den Kulturbegriff und die bevorstehende Analyse); 2. Zur Geschichte des Kulturbegriffs (Entwicklung des Begriffs von der Antike bis zur Aufklärung); 3. Kulturbegriff nach Elias und Geertz (Vergleich der Theorien von Elias und Geertz); 4. Kultur und Ihr Wandel (Die Veränderungen des Kulturbegriffs im Zeitverlauf); 5. Zusammenfassende Erkenntnisse (Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse).
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung des Textes ist es, den vielschichtigen Kulturbegriff zu beleuchten und verschiedene theoretische Ansätze, insbesondere die von Clifford Geertz und Norbert Elias, zu vergleichen. Der Text untersucht die historische Entwicklung des Kulturbegriffs und analysiert dessen Bedeutung in verschiedenen Kontexten.
- Quote paper
- Iris Kuckelberg (Author), 2009, „Was ist Kultur?“ Eine Annäherung an den Kulturbegriff unter Bezugnahme auf die Theorien von Clifford Geertz und Norbert Elias, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154592