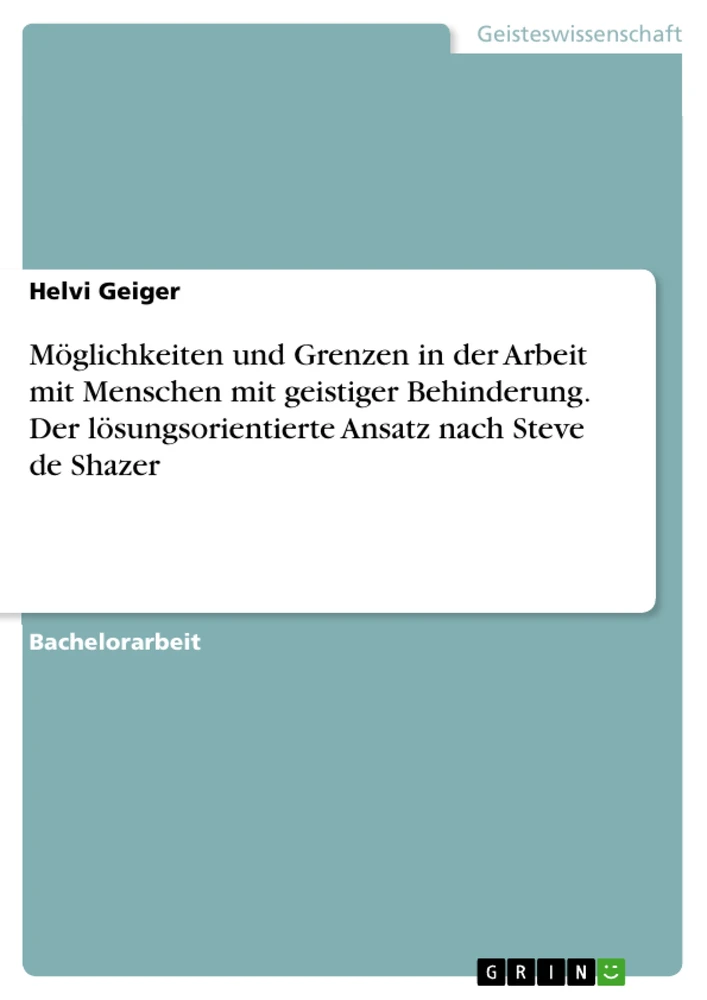Lösungsorientierter Ansatz – dies weckte meine Neugier. Was steckt hinter diesem Ansatz? Was ist der Unterschied zum Problem-Lösungs-Ansatz? Könnte dieser Ansatz hilfreich sein für meine, seit relativ kurzer Zeit begonnene, Tätigkeit in einer Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung?
Es schien mir unmöglich, alle 260 Menschen so kennen zu lernen, dass mir ihre jeweilige „Geschichte“ und ihre besondere Situation präsent sind. Wie kann ich als Sozialarbeiterin auf die unterschiedlichen Anliegen eingehen und dabei auch möglichst gut die Besonderheiten jeder KlientIn berücksichtigen? Was bietet mir der lösungsorientierte Ansatz zu diesem Zweck? Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung? Wo liegen die Grenzen?
Die Bearbeitung der Fragen erfolgt in Form einer Literaturrecherche. Zunächst wird im Teil A der lösungsorientierte Ansatz dargestellt, seine Entstehungsgeschichte, die Haltung und besondere Techniken im Gegensatz zu problemorientierten Ansätzen.
Im Teil B geht es darum, einen Einblick in das Thema der geistigen Behinderung zu geben... Die Darstellung des Erscheinungsbildes von Trisomie 21 beschränkt sich auf die aus meiner Sicht wichtigsten Fakten, um ein Verständnis für die besondere Situation dieser Menschen zu bekommen und daraus auch entsprechende Schlussfolgerungen für die konkreten Anwendungsmöglichkeiten des lösungsorientierten Ansatzes ziehen zu können.
Diese Schlussfolgerungen und konkreten Anwendungsmöglichkeiten folgen im Teil C. Dazu fanden sich in der Literatur nur spärliche Ausführungen.
Umso spannender war es nach diesen geringen Funden in der Fachliteratur, hier selbst zu recherchieren und das aktuelle Fachwissen zum lösungsorientierten Ansatz mit dem zu Trisomie 21 zu verknüpfen und so eine eigene Antwort auf die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung des lösungsorientierten Ansatzes in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung zu finden. Zur Veranschaulichung für die LeserInnen wurde noch ein kleines eigenes Fallbeispiel in diesen Teil eingefügt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil A
- Vorstellung des lösungsorientierten Ansatzes
- Geschichte
- Theoretische Überlegungen
- Fachliche Werte
- Menschliche Würde respektieren
- Visionen der KlientInnen fördern
- Normalisierung begünstigen
- Beziehungstypen als Stadien eines Entwicklungsprozesses
- Beziehungen vom Typ Besucherln
- Beziehungen vom Typ KlagendE
- Beziehungen vom Typ Kundin
- Phasen des Lösungen – Findens
- Beschreibung des Problems
- Wohlformulierte Ziele entwickeln
- Die Wunder-Frage
- (Unter)Suchen nach Ausnahmen
- Rückmeldung am Ende der Sitzung
- Skalierungsfragen
- Teil B Geistige Behinderung
- Was ist Trisomie 21
- Klinische Grundlagen
- Phänotypische Entwicklung
- Fehlbildungen
- Medizinische Probleme
- Prävalenz
- Sprachentwicklung
- Teil C
- Die Anwendung des lösungsorientierten Ansatzes in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung
- Fallbeispiel
- Gedanken zur Bedeutung der Haltung des lösungsorientierten Ansatzes
- Praktische methodische Überlegungen zur Anwendung des lösungsorientierten Ansatzes bei Menschen mit Trisomie 21
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem lösungsorientierten Ansatz nach Steve de Shazer und seinen Möglichkeiten und Grenzen in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM). Der Fokus liegt darauf, den Ansatz in der Praxis anzuwenden und zu untersuchen, wie er die Kommunikation und Unterstützung von Menschen mit Trisomie 21 verbessern kann.
- Vorstellung des lösungsorientierten Ansatzes und seiner theoretischen Grundlagen
- Einblick in die Thematik der geistigen Behinderung, insbesondere Trisomie 21
- Analyse der Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes in der Arbeit mit Menschen mit Trisomie 21
- Reflexion über die Rolle der Haltung des lösungsorientierten Ansatzes in der Praxis
- Entwicklung praktischer methodischer Überlegungen für den Einsatz des Ansatzes bei Menschen mit Trisomie 21
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des lösungsorientierten Ansatzes und seine Relevanz für die Arbeit in einer WfbM ein. Teil A stellt den Ansatz ausführlich vor, einschließlich seiner Geschichte, theoretischen Grundlagen, fachlichen Werte und Beziehungstypen sowie der Phasen des Lösungsfindens.
Teil B gibt einen Einblick in das Thema der geistigen Behinderung, wobei der Fokus auf Trisomie 21 als häufigste Ursache angeborener geistiger Behinderung liegt. Dieser Teil beleuchtet die klinischen Grundlagen, Phänotypische Entwicklung, Fehlbildungen, medizinische Probleme, Prävalenz und Sprachentwicklung von Menschen mit Trisomie 21.
Teil C widmet sich der Anwendung des lösungsorientierten Ansatzes in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung, insbesondere mit Trisomie 21. Es werden praktische methodische Überlegungen und ein Fallbeispiel präsentiert, um die Anwendung des Ansatzes zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Lösungsorientierter Ansatz, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, geistige Behinderung, Trisomie 21, Down-Syndrom, Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM), Sozialarbeit, Kommunikation, Unterstützung, Praxis, Anwendungsmöglichkeiten, Grenzen, Haltung, Methoden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der lösungsorientierte Ansatz nach Steve de Shazer?
Es ist ein Beratungsansatz, der sich nicht auf die Analyse von Problemen konzentriert, sondern direkt nach Zielen, Wünschen und bereits funktionierenden Ausnahmen sucht.
Was versteht man unter der "Wunder-Frage"?
Die Wunder-Frage ist eine Technik, bei der sich Klienten vorstellen, ein Wunder hätte ihr Problem über Nacht gelöst. Dies hilft dabei, konkrete Ziele und Visionen zu formulieren.
Welche Beziehungstypen gibt es im lösungsorientierten Modell?
Man unterscheidet zwischen den Typen "Besucher" (kein klares Anliegen), "Klagender" (sieht das Problem bei anderen) und "Kunde" (bereit für eigene Veränderungen).
Kann der Ansatz bei Menschen mit Trisomie 21 angewendet werden?
Ja, durch methodische Anpassungen wie Leichte Sprache, Visualisierungen und Skalierungsfragen kann er helfen, die Selbstbestimmung dieser Menschen zu fördern.
Was sind zentrale fachliche Werte dieses Ansatzes?
Dazu gehören der Respekt vor der menschlichen Würde, die Förderung von Visionen und das Prinzip der Normalisierung.
- Citar trabajo
- Helvi Geiger (Autor), 2010, Möglichkeiten und Grenzen in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Der lösungsorientierte Ansatz nach Steve de Shazer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154689