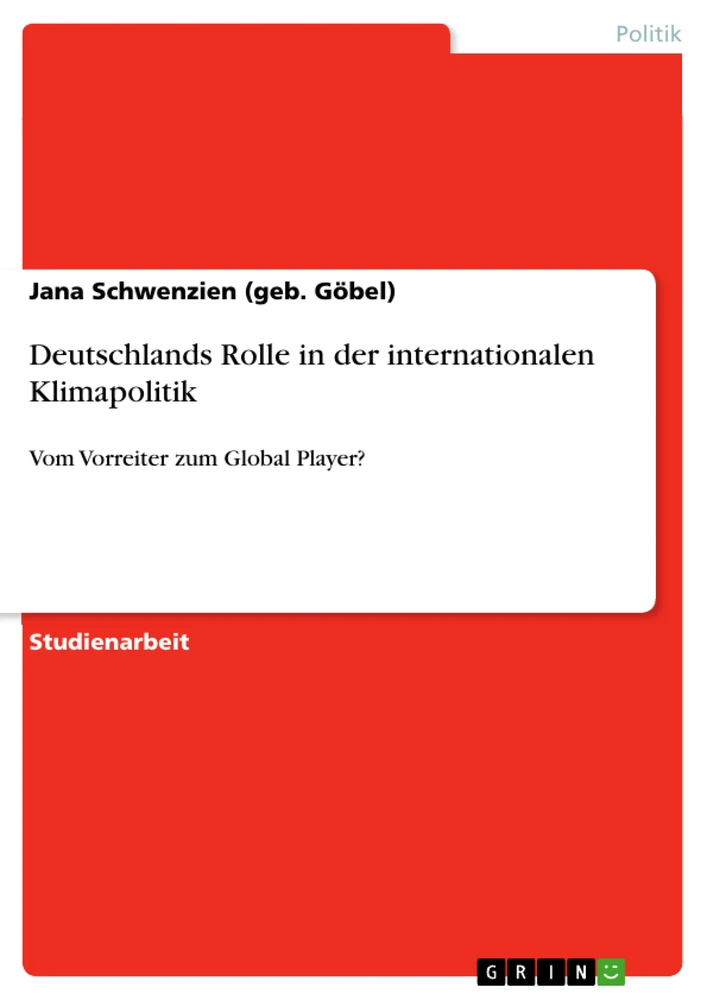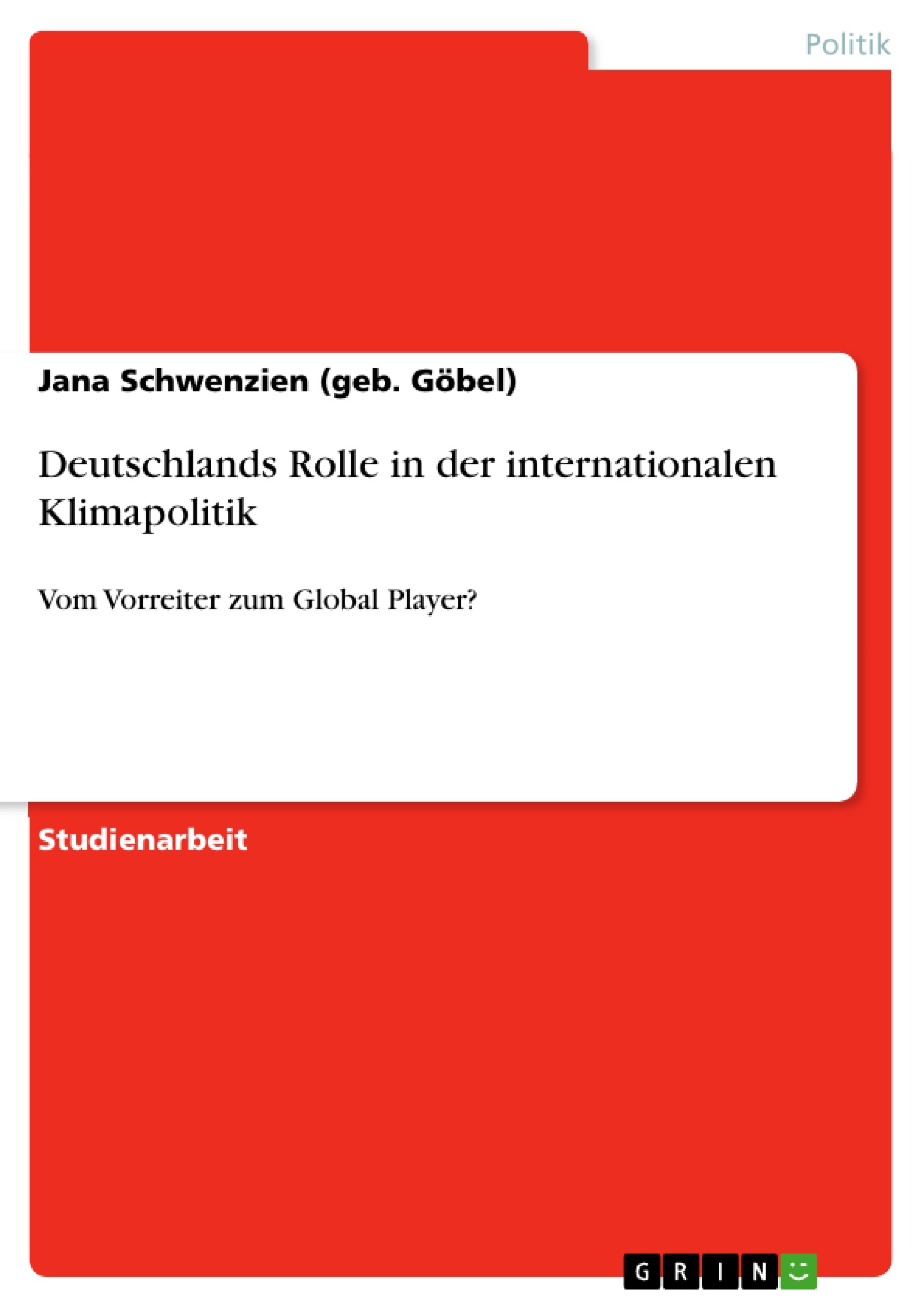Spätestens seit der Veröffentlichung des alarmierenden vierten
Weltklimaberichts des IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) hat das Thema Klimawandel Hochkonjunktur. Laut dem noch unveröffentlichten dritten Teil des Berichts hat die Menschheit nur noch circa 15 Jahre Zeit, um eine unumkehrbare Klimakatastrophe zu verhindern. Das heißt, dass der Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2020 substanziell abnehmen muss. Die EU hat auf ihrem Frühjahrsgipfel vom 8. und 9. März 2007 einen ersten Schritt in diese Richtung getan. Im Mittelpunkt des Treffens der Staats‐ und
Regierungschefs stand die Festlegung verbindlicher Ziele zur Reduktion der Treibhausgase bis 2020, was unter der energischen Führung von Bundeskanzlerin Merkel auch gelang. Inwieweit der EU‐Gipfel als klimapolitischer Erfolg gewertet werden kann, wird in dieser Arbeit genauer untersucht. Fakt ist, dass es trotz dieser erfreulichen Entwicklung keinen Grund zum Aufatmen gibt. Die weltweite klimapolitische Lage bleibt weiterhin angespannt. Die EU wird aller Voraussicht nach das im Kyoto-Protokoll festgeschriebene Reduktionsziel von 8 Prozent nicht erreichen. Auch ist noch nicht klar, wie es nach 2012, dem Ende der ersten Kyoto-Phase, weitergeht. Die Verhandlungen für einen Post-Kyoto-Prozess sollen noch in diesem Jahr beginnen. Doch wie sollte das internationale Folge-Regime ausgestaltet sein? Wie können die USA und wichtige Schwellen‐ und Entwicklungsländer wie China, Indien und Brasilien in einen Post-Kyoto-Prozess einbezogen werden? Deutschlands Rolle in diesem Verhandlungsprozess ist von großer Bedeutung, da die Bundesregierung in diesem Halbjahr sowohl die EU‐ als auch die G8‐
Präsidentschaft innehat und somit die internationale politische Agenda entscheidend beeinflusst. Diese Arbeit befasst sich daher mit Deutschlands Rolle in der internationalen Klimapolitik. Welchen Beitrag können Deutschland und die EU leisten, um ein effizientes Kyoto-Folge-Regime und somit verbindliche Reduktionsziele zu gewährleisten? Wie ist die Rolle Deutschlands und der EU in der internationalen Klimapolitik überhaupt zu bewerten? Ist Deutschland in der Lage seine derzeitige Vorreiterposition im
Bereich umweltfreundlicher Technologien politisch so auszubauen, dass das Land sich zum Global Player und somit zum entscheidenden Zugpferd in der internationalen Klimapolitik entwickeln kann?
Diese Fragen sollen im Verlauf der Arbeit geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Problematik des Klimawandels
- Klimaschutz aus ökonomischer Perspektive
- Der EU-Klimabeschluss als Erfolg der Bundesregierung
- Die EU in der internationalen Klimapolitik - Vom Vorbild zum Zugpferd
- Wie weiter nach 2012?
- Nicht ohne die USA
- Fazit: Deutschland und die EU als Mittler in der internationalen Klimapolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Deutschlands Rolle in der internationalen Klimapolitik. Sie analysiert, welchen Beitrag Deutschland und die EU zur Bewältigung der globalen Herausforderungen im Bereich des Klimawandels leisten können. Dabei werden die Handlungsspielräume Deutschlands und der EU im Rahmen der internationalen Klimapolitik beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung eines effektiven Post-Kyoto-Regimes. Die Arbeit untersucht außerdem, ob Deutschland seine Vorreiterrolle im Bereich umweltfreundlicher Technologien politisch so ausbauen kann, dass es zum entscheidenden Zugpferd in der internationalen Klimapolitik wird.
- Die Problematik des Klimawandels
- Die Rolle Deutschlands in der EU-Klimapolitik
- Möglichkeiten für einen Post-Kyoto-Prozess
- Die Handlungsspielräume Deutschlands und der EU
- Die Bewertung von Deutschlands Rolle in der internationalen Klimapolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Klimawandel heraus und bezieht sich auf aktuelle Forschungsergebnisse des IPCC. Die Arbeit analysiert Deutschlands Rolle in der internationalen Klimapolitik, insbesondere im Hinblick auf die EU-Präsidentschaft und die Gestaltung eines effektiven Post-Kyoto-Regimes.
Zur Problematik des Klimawandels
Dieses Kapitel beleuchtet die Problematik des Klimawandels als globales Umweltproblem und diskutiert die ökonomischen Aspekte. Das Kapitel verdeutlicht die Herausforderungen und Chancen, die mit der Bekämpfung des Klimawandels verbunden sind.
Klimaschutz aus ökonomischer Perspektive
Dieses Kapitel untersucht die ökonomischen Aspekte des Klimaschutzes und argumentiert gegen die oft vermutete Unvereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Der Fokus liegt auf den ökonomischen Kosten des Klimawandels und den Vorteilen von Investitionen in Klimaschutz.
Der EU-Klimabeschluss als Erfolg der Bundesregierung
Dieser Abschnitt analysiert den EU-Klimabeschluss aus dem Jahr 2007, wobei die Rolle der deutschen Bundesregierung und die Bedeutung des Beschlusses für die internationale Klimapolitik im Vordergrund stehen.
Die EU in der internationalen Klimapolitik - Vom Vorbild zum Zugpferd
Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der EU in der internationalen Klimapolitik, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Kyoto-Protokolls und die Gestaltung eines Nachfolge-Abkommens.
Wie weiter nach 2012?
Der Abschnitt befasst sich mit den Herausforderungen, die sich nach dem Ende der ersten Kyoto-Phase stellen, und analysiert die Notwendigkeit eines globalen und verbindlichen Post-Kyoto-Regimes.
Nicht ohne die USA
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der USA für die internationale Klimapolitik und der Notwendigkeit, die Vereinigten Staaten in einen Post-Kyoto-Prozess einzubeziehen.
Schlüsselwörter
Klimawandel, internationale Klimapolitik, Deutschland, EU, Kyoto-Protokoll, Post-Kyoto-Prozess, Treibhausgase, Reduktionsziele, Global Player, Umweltpolitik, ökonomische Aspekte, Marktversagen, Emissionen, internationale Kooperation, nachhaltige Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Deutschland in der internationalen Klimapolitik?
Deutschland gilt oft als Vorreiter und Vermittler, insbesondere während seiner EU- und G8-Präsidentschaften, um verbindliche Reduktionsziele durchzusetzen.
Was war der Erfolg des EU-Klimabeschlusses 2007?
Unter Führung von Kanzlerin Merkel wurden erstmals verbindliche Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen bis zum Jahr 2020 festgelegt.
Warum ist ein Post-Kyoto-Regime notwendig?
Nach dem Auslaufen der ersten Kyoto-Phase 2012 bedurfte es eines neuen globalen Abkommens, um den Klimawandel wirksam zu begrenzen.
Schließt sich Klimaschutz und Ökonomie gegenseitig aus?
Nein, die Arbeit argumentiert, dass Investitionen in Klimaschutz langfristig ökonomisch vorteilhafter sind als die Kosten einer ungebremsten Klimakatastrophe.
Wie wichtig ist die Einbindung von Schwellenländern wie China?
Ein effizientes Folge-Regime ist nur möglich, wenn große Emittenten wie die USA, China, Indien und Brasilien verbindlich einbezogen werden.
- Quote paper
- Jana Schwenzien (geb. Göbel) (Author), 2007, Deutschlands Rolle in der internationalen Klimapolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154847