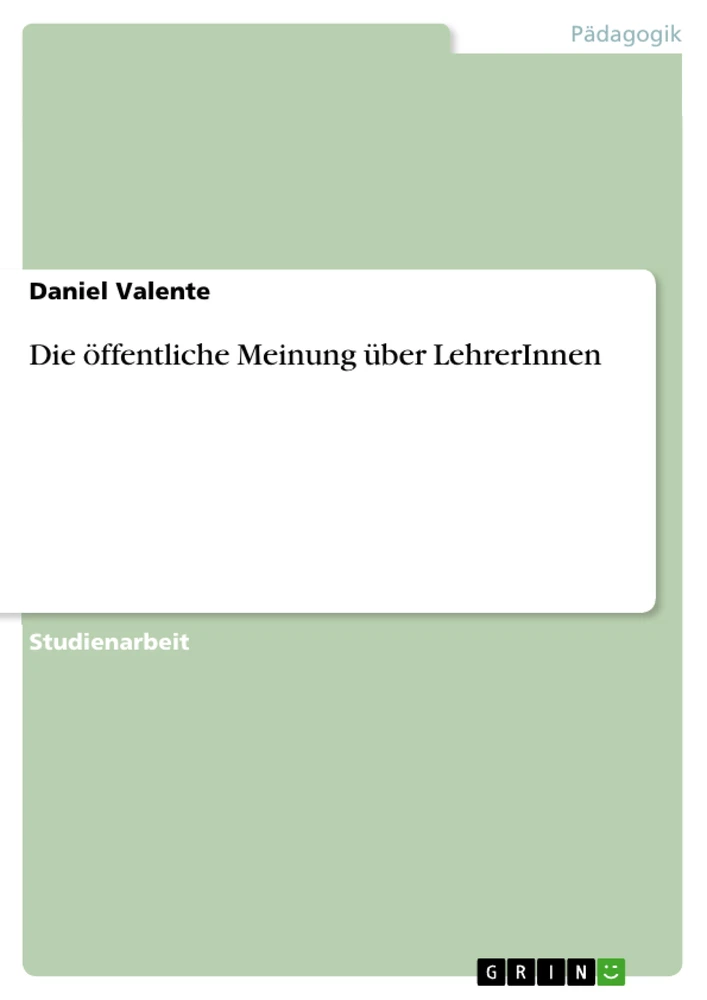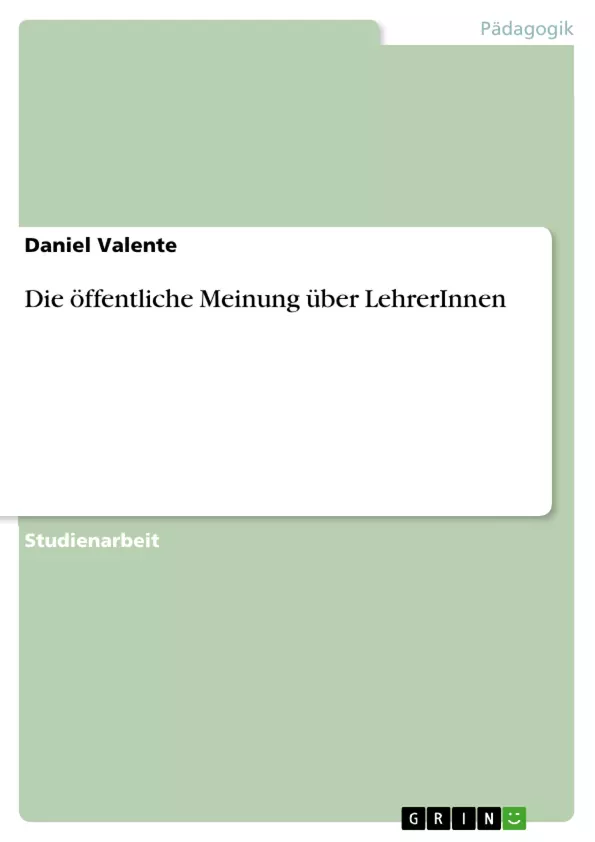Nicht zuletzt durch die bescheidenen Ergebnisse der internationalen PISA-Studie stehen deutsche Lehrkräfte wieder verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Die öffentliche Meinung über Lehrerinnen und Lehrer war jedoch stets eine uneindeutige, von Vorurteilen und Stereotypisierungen geprägte Sicht. Jeder hat wohl seine Meinung über „die Lehrer“, waren die meisten Menschen doch jahrelang mit ihnen in Kontakt. Die Perspektive ändert sich dabei natürlich zwangsläufig im Laufe der Zeit: So sind die eigenen Lehrer dem Einen aus der vergangenen Schulzeit noch bekannt, der Andere sieht sich als Elternteil eines Schulkindes mit ihnen konfrontiert und wieder Andere entscheiden sich, nach der Schulzeit selbst den Lehrerberuf zu ergreifen. Selten wird man zwei identische Vorstellungen und Meinungen über „den Lehrer“ oder „die Lehrerin“ finden können, da jegliche Erfahrungen und somit entstehende Meinungsbilder stets an gewissen Stellen divergieren werden. Trotz allem ist in der Vergangenheit immer wieder über das Image der Lehrer spekuliert, gemutmaßt, gesprochen und vor allem geschrieben worden. Dabei ergeben sich natürlich ebenfalls sehr differenzierte Bilder. Demnach beschreibt Theodor W. Adorno den Lehrer als eine Person, welcher „[...] ein gewisses Aroma des gesellschaftlich nicht ganz Vollkommenen“ anhafte. Lehrerinnen und Lehrer gelten demnach als Intellektuelle zweiter Klasse, zwar Akademiker, aber keineswegs öffentlich anerkannt wie bspw. Ärzte oder Anwälte.
In seiner Funktion ist der Lehrer darauf bedacht, der folgenden Generation die Ausübung gesellschaftlicher Funktionen zu vermitteln, obwohl er diese selbst nie praktisch kennen gelernt hat. Der Lehrende befindet sich stets in einer Art Schutzraum und braucht sich nicht in der freien Wirtschaft seinen Platz erkämpfen. Er erscheint oft als Einzelkämpfer, der sich durch seine Berufswahl Unmündigen gegenüber Macht verschafft hat, die er in anderer Funktion nicht erreicht hätte. Es ließen sich an dieser Stelle weitere unzählige, pauschale Schelten gegenüber Lehrerinnen und Lehrern aufzählen, da ihr Beruf wie kaum ein Zweiter der öffentlichen und stets kritisch bis einseitigen Diskussion ausgesetzt ist. In diesem Fall interessieren aber weniger die verbreiteten Stereotype des Lehrers. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht vielmehr das Interesse, das öffentliche Ansehen über Lehrerinnen und Lehrer genauer zu betrachten und dabei mögliche Gründe für das kritische Bild innerhalb der Öffentlichkeit zu zeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II.1 Erziehung im Verständnis der Gesellschaft und ungeklärte Position der Lehrerrolle
- II.2 Begriffsbestimmung
- II.3 Die öffentliche Meinung über Lehrerinnen und Lehrer
- II.3.1 Ein geschichtlicher Überblick
- II.3.2 Die öffentliche Meinung über Lehrerinnen und Lehrer im Vergleich
- II.4 Die öffentliche Meinung über Lehrerinnen und Lehrer am Beispiel Bayern
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das öffentliche Ansehen von Lehrkräften in Deutschland und untersucht die Gründe für das oft kritische Bild der Lehrerinnen und Lehrer in der Öffentlichkeit. Sie bezieht sich auf die Zeitspanne zwischen den späten 1950er Jahren und den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts und betrachtet die Entwicklung des Lehrerbildes in der Gesellschaft.
- Die Rolle von Erziehung und Bildung im Verständnis der Gesellschaft
- Die Wahrnehmung der Lehrerrolle und ihre gesellschaftliche Bewertung
- Der Einfluss von Stereotypen und Vorurteilen auf das öffentliche Bild von Lehrkräften
- Die Bedeutung von sozialem Status und Image für den Lehrerberuf
- Die Auswirkungen der öffentlichen Meinung auf die Motivation und Zufriedenheit von Lehrerinnen und Lehrern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des öffentlichen Ansehens von Lehrkräften dar, die durch die PISA-Studie verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind. Sie betont die Ambivalenz der öffentlichen Meinung und die Entstehung von Stereotypen, die mit verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven auf den Lehrerberuf verbunden sind.
Kapitel II.1 beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Bewertung von Erziehung und der ungeklärten Position der Lehrerrolle. Es analysiert die Unterschiede zwischen der traditionellen Familienerziehung und der professionellen Erziehung in der Schule und zeigt die Herausforderungen auf, die sich aus dieser Unterscheidung ergeben.
Kapitel II.2 befasst sich mit der Begriffsbestimmung und der Definition relevanter Begriffe wie „öffentliche Meinung“, „sozialer Status“ und „Image“. Es untersucht die unterschiedlichen Bedeutungen dieser Begriffe und deren Einfluss auf die Wahrnehmung von Lehrkräften.
Kapitel II.3 befasst sich mit der öffentlichen Meinung über Lehrerinnen und Lehrer, wobei ein geschichtlicher Überblick und ein Vergleich des Lehrerbildes in verschiedenen Zeiträumen gegeben wird. Die Ausführungen konzentrieren sich auf die Entwicklung der öffentlichen Meinung und die Ursachen für die bestehenden Vorurteile.
Kapitel II.4 analysiert die öffentliche Meinung über Lehrerinnen und Lehrer am Beispiel des Bundeslandes Bayern. Es untersucht die Besonderheiten der bayerischen Schullandschaft und die dort vorherrschenden Meinungen und Stereotypen über Lehrkräfte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie öffentliche Meinung, Lehrerrolle, Sozialprestige, Image, Erziehung, Bildung, Stereotypisierung, Vorurteile und gesellschaftliche Bewertung.
- Citar trabajo
- Daniel Valente (Autor), 2008, Die öffentliche Meinung über LehrerInnen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154903