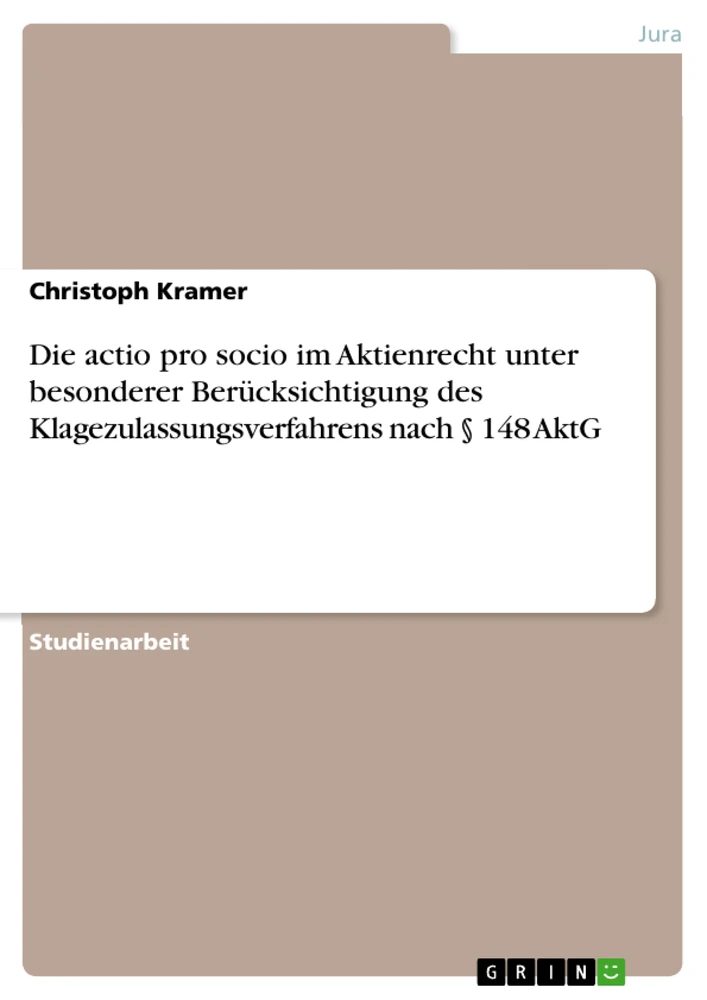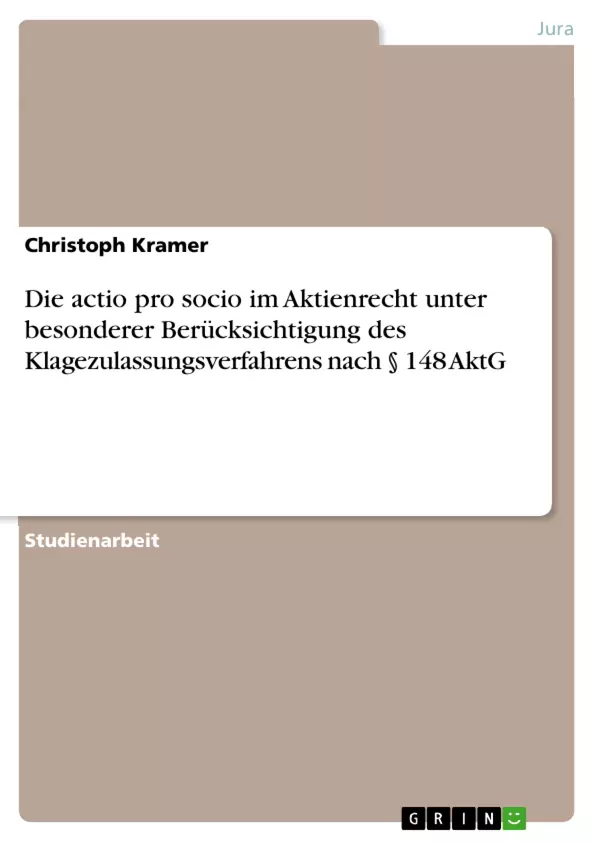Ist „die Zulassung von Aktionärsklagen […] der Versuch, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben“ oder kann sich der Aktionär als „Robin Hood“ erweisen? Dass (Klein-)Aktionäre eine problematische Kontrollinstanz sind, ist spätestens mit der Zunahme missbräuchlicher Anfechtungsklagen durch sog. „räuberische Aktionäre“ allgemein bekannt. Im Rahmen der Diskussion um die Klage-rechte des Aktionärs spielt auch die actio pro socio eine wichtige Rolle. Im Kern geht es dabei um die Frage, wie der einzelne Aktionär Ansprüche der Gesellschaft geltend machen kann. Die Frage verschließt sich einer pauschalen Antwort schon deshalb, weil sich die Kontroverse um die actio pro socio in der AG im Spannungsfeld zwischen innerer Kompetenzordnung der Aktiengesellschaft und der Erhaltung ihrer Handlungsfähigkeit einerseits, und dem Schutz des Aktionärs vor gesellschaftsschädigendem Verhalten von Verwaltungsmitgliedern und Mitaktionären andererseits, bewegt. Die vorliegende Arbeit nähert sich daher dem Problem um die actio pro socio in mehreren Untersuchungsschritten.
In einem ersten Schritt soll nach der historischen Herleitung der actio pro socio die besondere Problematik aufgezeigt werden, die die Übertragung dieses Instituts auf das Aktienrecht mit sich bringt. Den zweiten Schritt stellt eine Analyse der für das Aktienrecht gesetzlich geregelten Fälle der actio pro socio vor dem Hintergrund der erläuterten Problematik dar. Den Kern dieser Darstellung bildet die Untersuchung des Klagezulassungsverfahrens nach § 148 AktG. In einem dritten Schritt ist zu fragen, ob über die gesetzlich geregelten Fälle hinaus noch weitere Anwendungsbereiche der actio pro socio im Aktienrecht möglich sind. Daran schließt sich in einem vierten Schritt die Analyse eines möglichen Vorgehens des Aktionärs aus eigenem Recht an. Abschließend werden die gefundenen Ergebnisse in einem Fazit zusammengefasst.
Anmerkung: Die Arbeit wurde als Abschlussarbeit für das erste juristische Staatsexamen im Jahre 2010 mit dem Schindhelm Förderpreis ausgezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit der actio pro socio im Aktienrecht, insbesondere im Hinblick auf das Klagezulassungsverfahrens nach § 148 AktG. Die Arbeit untersucht die Rechtsnatur dieser Klagebefugnis und analysiert die damit verbundenen rechtlichen Fragestellungen.
- Die Rechtsnatur der actio pro socio
- Das Klagezulassungsverfahren nach § 148 AktG
- Die Anforderungen an die Zulässigkeit der Klage
- Die Abgrenzung zu anderen Klagemöglichkeiten
- Die praktische Relevanz der actio pro socio im Aktienrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Actio pro socio, Aktienrecht, Klagezulassungsverfahrens, § 148 AktG, Gesellschafterklage, Aktien Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Studienarbeit: Actio pro socio im Aktienrecht
Was ist der Gegenstand der Studienarbeit?
Die Studienarbeit befasst sich mit der actio pro socio im Aktienrecht, insbesondere im Hinblick auf das Klagezulassungsverfahren nach § 148 AktG. Sie untersucht die Rechtsnatur dieser Klagebefugnis und analysiert die damit verbundenen rechtlichen Fragestellungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: die Rechtsnatur der actio pro socio, das Klagezulassungsverfahren nach § 148 AktG, die Anforderungen an die Zulässigkeit der Klage, die Abgrenzung zu anderen Klagemöglichkeiten und die praktische Relevanz der actio pro socio im Aktienrecht.
Enthält die HTML-Vorschau ein Inhaltsverzeichnis?
Nein, die bereitgestellte Textvorlage enthält kein Inhaltsverzeichnis, daher konnte keins erstellt werden.
Gibt es Kapitelzusammenfassungen in der HTML-Vorschau?
Nein, die bereitgestellte Textvorlage enthält keine Kapitel im Sinne von strukturierten Abschnitten mit Überschriften, die eine Zusammenfassung ermöglichen würden. Daher konnten keine Kapitelzusammenfassungen erstellt werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Studienarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Actio pro socio, Aktienrecht, Klagezulassungsverfahren, § 148 AktG, Gesellschafterklage, Aktiengesellschaft.
- Citation du texte
- Christoph Kramer (Auteur), 2010, Die actio pro socio im Aktienrecht unter besonderer Berücksichtigung des Klagezulassungsverfahrens nach § 148 AktG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154989