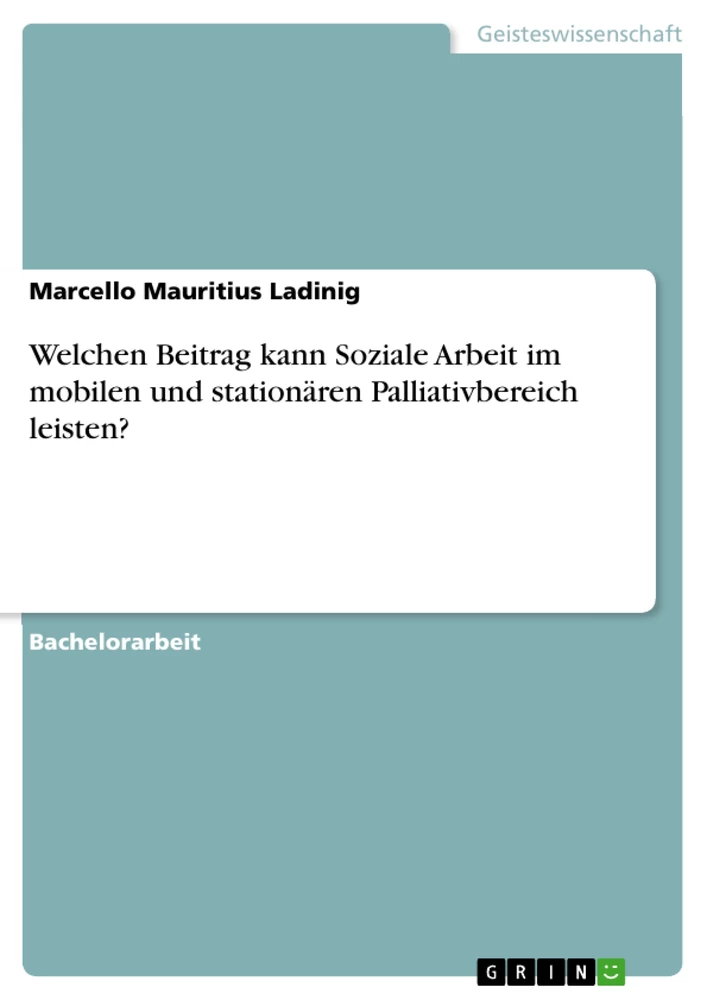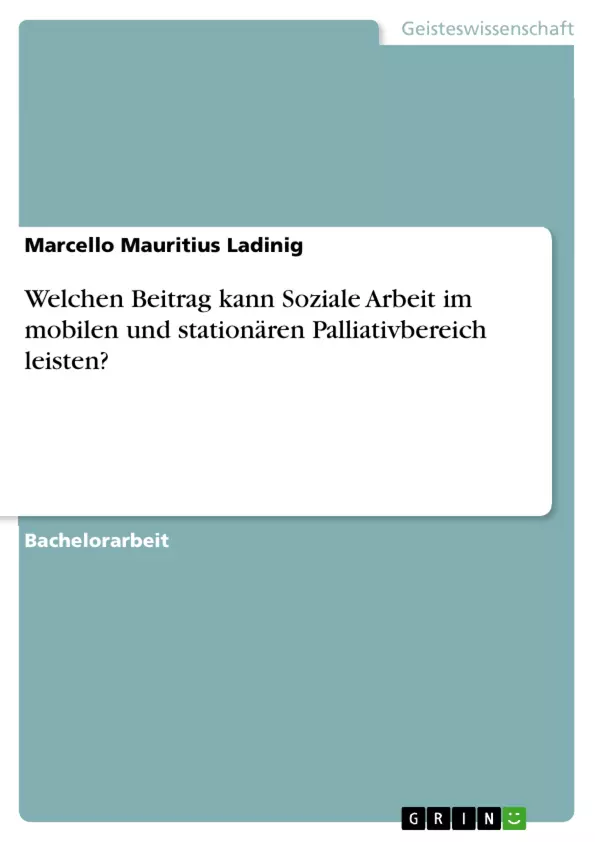Gegenstand dieser Arbeit ist die Situation krebskranker bzw. sterbenskranker Menschen, welche institutionell also in einem Krankenhaus betreut werden und zum Großteil auch dort versterben. Nachgehend, mit der Intention konkrete Aufgaben und Umgangsformen der Sozialen Arbeit im mobilen und stationären Palliativbereich zu verorten, entstand die Motivation, mich mit diesem relativ jungen Handlungsfeld Sozialer Arbeit zu beschäftigen. Bezug wird nicht auf den gesamten Verlauf einer eventuell tödlichen Erkrankung, sondern auf die letzen Monate, Wochen oder Tage im Leben sterbenskranker Menschen genommen. Hauptaufgabe in diesem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit ist es, für das Casemanagement verantwortlich zu sein. Dies sind generalistische Tätigkeiten um z. B. als Ansprechpartner für Betroffene und Angehörige zur Verfügung zu stehen. Das Casemanagement sorgt dafür, dass das soziale Umfeld, sowie alle tätigen Institutionen und Akteure im Handlungsfeld berücksichtigt und koordiniert werden. Professionelles sozialarbeiterisches Handeln kann somit seinen eigenen fachlichen Beitrag im Kontext verschiedenster Disziplinen leisten, um die letzte Phase schwerstkranker Personen so erträglich und angenehm wie möglich zu gestalten. Umgesetzt wird dies durch eine klare Positionsbestimmung, durch vorhandene fachliche Qualifikationen und durch einen professionell reflexiven Umgang mit Leid und Tod.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- Beschreibung der Einrichtung
- Leitbild und Organisation des Krankenhauses
- Palliativmedizinische Betreuung am Krankenhaus
- KlientInnen - Wünsche & Wirklichkeit - Eindrücke aus der Palliativabteilung
- Reflexion zur Situation sterbender PatientInnen
- Aufgaben & Projekte im Rahmen des Praktikums
- A - Administrative Tätigkeiten
- S― Stationstätigkeiten
- B - Beratungsgespräche
- P – Projekttätigkeiten
- Fallanalyse im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
- Zentrale Aufgaben, Methoden und Zugänge der Sozialen Arbeit
- Das Handlungsfeld der Sozialen Arbeit im Palliativbereich
- Herausforderungen für die Soziale Arbeit
- Psychosoziale Begleitung von PatientInnen
- Psychosoziale Begleitung von Angehörigen
- Trauerbegleitung
- Qualitätskriterien im Begleit- und Beratungsprozess
- Methoden Sozialer Arbeit im Palliativkontext
- Fachliche Voraussetzungen für SozialarbeiterInnen
- Soziale Arbeit im Krankenhaus versus Klinische Sozialarbeit
- Berufliche Positionsbestimmung der Sozialen Arbeit im Krankenhaus
- Falldarstellung des Herrn B. im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
- Anamnese - Sammlung an Vorinformationen
- Diagnose - Problemdefinition
- Intervention - Handlungsstrategien und Methoden
- Evaluation - sozialarbeiterische Bewertung des Falls
- Beantwortung der Fragestellung
- Reflexion & Epilog
- Mehrdimensionale Betrachtung des Todes und Reflexivität
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Situation krebskranker bzw. sterbenskranker Menschen, die in einem Krankenhaus betreut werden und zum Großteil auch dort versterben. Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Sozialen Arbeit im Palliativkontext und reflektiert die Frage, welchen Beitrag die Soziale Arbeit leisten kann, um sowohl PatientInnen als auch deren Angehörige zu unterstützen.
- Organisation und Struktur des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder
- Palliativmedizinische Betreuung und die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext
- Theoretische Grundlagen und Praxisanwendung der Sozialen Arbeit im Palliativbereich
- Fallanalyse eines Patienten und die Anwendung sozialarbeiterischer Methoden in der Praxis
- Reflexion über die Mehrdimensionalität des Todes und die Bedeutung der Sozialen Arbeit in der Sterbebegleitung
Zusammenfassung der Kapitel
Der Prolog führt in die Thematik der Sterbebegleitung von krebskranken Menschen in einem Krankenhaus ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Beitrag der Sozialen Arbeit im Palliativkontext.
Kapitel 2 beschreibt die Einrichtung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, beleuchtet das Leitbild und die Organisation des Krankenhauses und gibt einen Überblick über die palliativmedizinische Betreuung. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der verschiedenen Angebote und Dienste für PatientInnen und Angehörige.
Kapitel 3 befasst sich mit der Fallanalyse eines Patienten im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Es werden die zentralen Aufgaben, Methoden und Zugänge der Sozialen Arbeit im Palliativbereich beleuchtet und die Herausforderungen für die Soziale Arbeit in diesem Kontext diskutiert. Darüber hinaus werden die Methoden der Sozialen Arbeit im Palliativkontext, die fachlichen Voraussetzungen für SozialarbeiterInnen und die Positionierung der Sozialen Arbeit im Krankenhaus im Vergleich zur Klinischen Sozialarbeit erläutert.
Kapitel 4 reflektiert die Mehrdimensionalität des Todes und die Bedeutung der Sozialen Arbeit in der Sterbebegleitung.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Palliativmedizin, Sterbebegleitung, Krankenhaus, Krebskranke, Angehörige, Psychosoziale Begleitung, Trauerbegleitung, Fallanalyse, Methoden, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Mehrdimensionalität des Todes
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit im Palliativbereich?
Die Soziale Arbeit ist primär für das Casemanagement, die psychosoziale Begleitung von Patienten und Angehörigen sowie die Trauerarbeit zuständig.
Was ist Casemanagement im Krankenhauskontext?
Es umfasst die Koordination aller beteiligten Institutionen und Akteure, um eine lückenlose Versorgung des Patienten im sozialen Umfeld sicherzustellen.
Wie unterstützt die Soziale Arbeit die Angehörigen von Sterbenden?
Durch Beratungsgespräche, psychosoziale Entlastung und die Vermittlung von weiterführenden Hilfen für die Zeit nach dem Verlust.
Was unterscheidet Soziale Arbeit im Krankenhaus von Klinischer Sozialarbeit?
Die Arbeit analysiert die berufliche Positionsbestimmung und die spezifischen fachlichen Qualifikationen, die für den Palliativsektor nötig sind.
Warum ist Reflexivität für Sozialarbeiter im Palliativbereich wichtig?
Ein professioneller Umgang mit Leid und Tod erfordert die ständige Reflexion der eigenen Belastung und der mehrdimensionalen Bedeutung des Sterbens.
- Quote paper
- BA Marcello Mauritius Ladinig (Author), 2010, Welchen Beitrag kann Soziale Arbeit im mobilen und stationären Palliativbereich leisten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154998