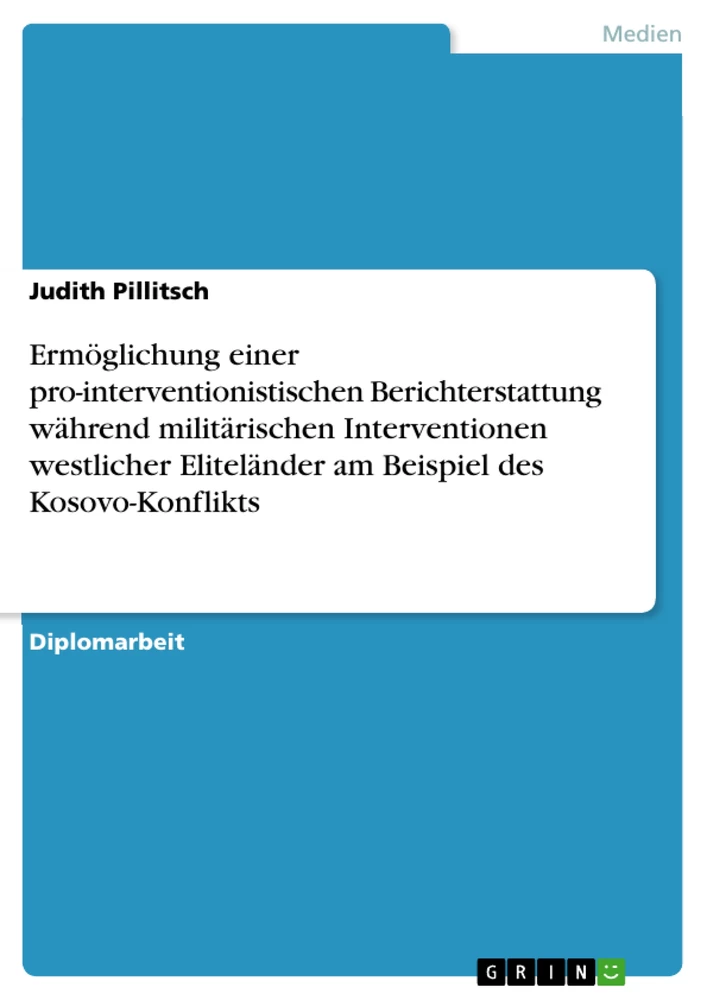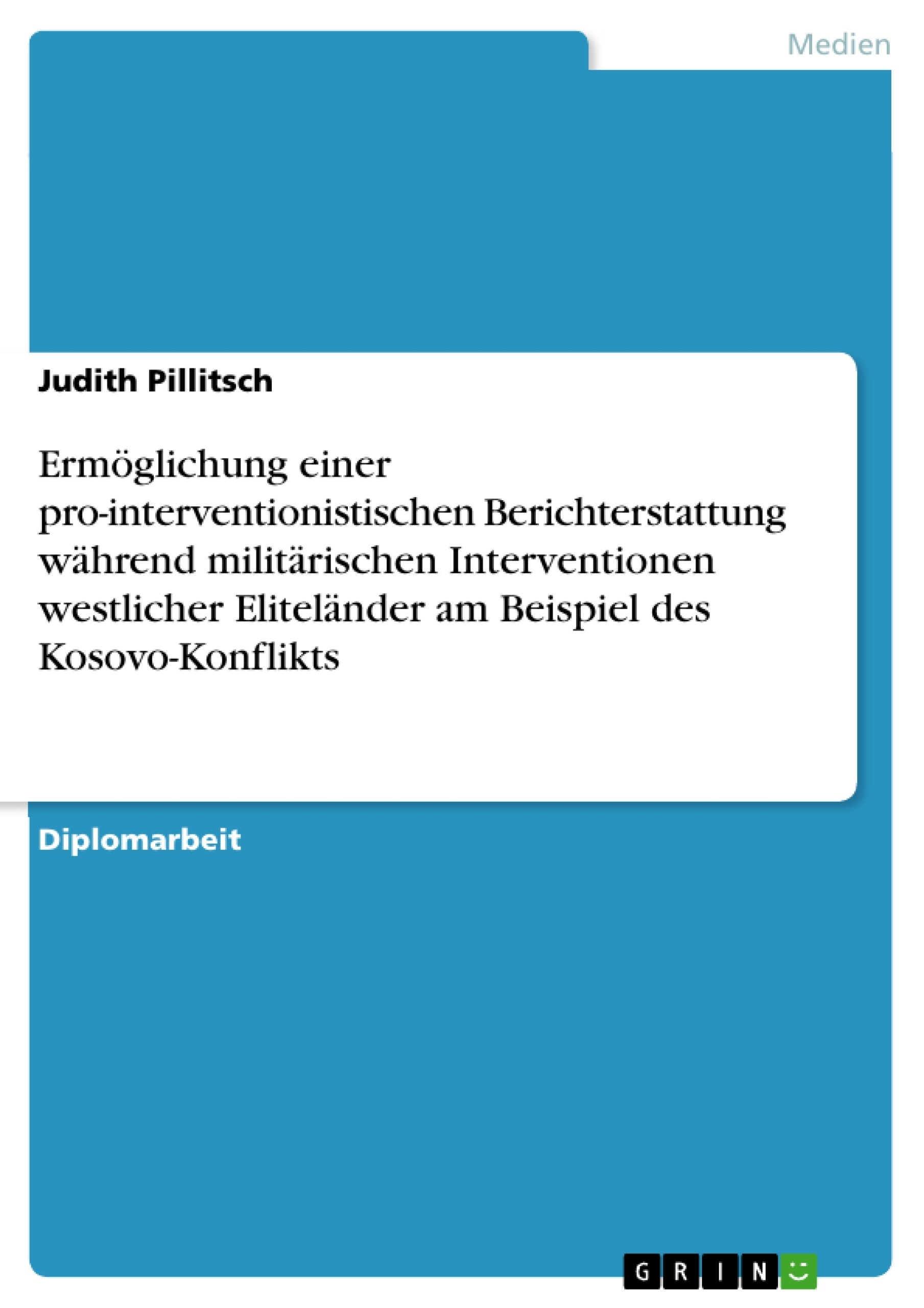Einleitung und Standortbestimmung der Diplomarbeit
Berichterstattung in Kriegs- und Krisenzeiten stellt die Presse vor eine besondere Herausforderung. Journalisten haben die Macht, eine Realität zu konstruieren, die von den Rezipienten hingenommen werden muß, da ihnen meist die Möglichkeit fehlt, das von der Presse postulierte Geschehen anhand eigener Erfahrungen zu überprüfen. Dies gilt nicht zuletzt in der Kriegsberichterstattung. Die Gefahr, die von dem Kriegsgebiet ausgeht, die Bedrohung des eigenen Lebens läßt vor dem Krisengebiet zurückschrecken und weckt in den Rezipienten nicht unbedingt den Wunsch, sich an Ort und Stelle von dem Geschehen
zu überzeugen. Auch für Kriegsberichterstatter ist es schwierig, sich im Kriegsgebiet frei zu bewegen und adäquate Informationen zu sammeln und zu überprüfen. Alle Kriegsparteien versuchen, ein möglichst vorteilhaftes Bild von sich selbst zu zeichnen und
es der Öffentlichkeit zu präsentieren. Als Vermittler dienen dazu Kriegsberichterstatter, die sich im Geflecht von Zensur und Manipulationsversuchen von militärischer Seite her zurechtfinden müssen. Kriegsberichterstatter und ihre Berichte sind deshalb so wichtig, weil ein Krieg oder ein militärischer Eingriff in eine Krise, wie z. B. die Einmischung der USA und ihrer Alliierten in den Kosovo-Konflikt, publizistisch legitimiert oder entlegitimiert wird.
Es stellt sich die Frage, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit Journalisten für eine Seite Partei ergreifen und pro oder kontra eines militärischen Angriffs publizistisch Stellung beziehen. Es greift zu kurz, nur den einzelnen Journalisten für seine
Berichterstattung verantwortlich zu machen. So wie schon Winfried B. Lerg feststellte, ist es mit der Untersuchung der Rolle des Kommunikators nicht abgetan, denn ebenso müssen die publizistischen Rahmenbedingungen, unter denen Journalisten ihrer Arbeit nachgehen
im Rahmen der Medienforschung mitberücksichtigt werden.(1)
[...]
_______
1 Vgl. Winfried B. Lerg: „Geschichte der Kriegsberichterstattung – Ein Literaturbericht“, in: Publizistik,
Heft 3, Juli-September 1992, S. 405.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung und Standortbestimmung
- II. Die politischen Voraussetzungen für die Akzeptanz einer militärischen Intervention
- II. 1. Internationale Politik und „ethnischer Konflikt“
- II.2. Krieg als akzeptierte und institutionalisierte Möglichkeit der Konfliktlösung
- II. 3. Die „neue Weltordnung“
- III. Die Strategien der Clinton-Administration
- III. 1. Neoisolationism
- III. 2. Selecitve Engagement
- III. 3. Cooperativ Security
- III. 4. Primacy
- III. 5. Der Clinton-Strategiemix
- IV. Die Beziehung zwischen Medien und Militär in lokal begrenzten Konflikten
- IV. 1. Korea
- IV. 2. Vietnam
- IV. 3. Falkland
- IV. 4. Grenada
- IV. 5. Lateinamerika
- IV. 6. Irak
- IV. 7. Somalia
- IV. 8. Ex-Jugoslawien
- IV. 8. 1. Die „neue NATO“ und der Krieg in Jugoslawien
- IV. 8. 2. Bosnien
- IV. 9. Zusammenfassung von Kapitel IV
- V. Der Kosovo-Konflikt, die Propagandalinie der NATO, der Aufbau und die Weiterverbreitung der Kriegsagenda
- V. 1. Vom Berliner Kongreß zur Konferenz von Rambouillet
- V. 2. Die NATO-Pressekonferenzen
- V. 3. Die Sprachmanipulation während der Konferenzen
- V. 4. Der Aufbau einer Kriegsagenda mit Hilfe der journalistischen Elite
- V. 4. 1. Instrumentelle Aktualisierung im Kosovo-Konflikt
- V. 4. 2. PR im Vorfeld der Nachrichtenselektion
- V. 4. 3. Nachrichtenwerte und Relevanzkriterien der Kriegsberichterstattung
- V. 4. 4. Die Verbreitungsmechanismen im Nachrichtengeschäft
- V. 4. 5. Journalistische Selektivität und ihre Folgen
- V. 5. Zusammenfassung von Kapitel V
- VI. Bedingungen für eine pro-interventionistische Berichterstattung
- VI. 1. Die Konstruktion von Scheinrealität oder „Public opinion wins war“
- VI. 2. Beschränkung und Kontrolle der Journalisten
- VI. 3. Wahl und Aufrechterhaltung von Bedrohungsszenarien
- VI. 4. Massaker und Greueltaten als Anlaßfall zum militärischen Eingreifen
- VI. 5. Der Kampf um die höheren Werte: Demokratie und Menschenrechte
- VII. Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Rahmenbedingungen, die eine pro-interventionistische Berichterstattung während militärischer Interventionen westlicher Staaten ermöglichen. Am Beispiel des Kosovo-Konflikts 1998-1999 wird analysiert, wie eine Kriegsagenda aufgebaut und verbreitet wird. Die Arbeit beleuchtet die Interaktion zwischen Politik, Medien und Militär und hinterfragt die Rolle der Journalisten in der Konstruktion von öffentlicher Meinung.
- Die politischen Voraussetzungen für die Akzeptanz militärischer Interventionen
- Die Strategien der Clinton-Administration im Umgang mit internationalen Konflikten
- Die Beziehung zwischen Medien und Militär in Kriegsberichterstattung
- Die Manipulation und Selektion von Nachrichten im Kosovo-Konflikt
- Die Bedingungen für eine pro-interventionistische Berichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung und Standortbestimmung: Die Einleitung beschreibt die Herausforderung der Kriegsberichterstattung und die Macht der Medien, Realitäten zu konstruieren. Sie hebt die Schwierigkeit hervor, Informationen im Kriegsgebiet zu überprüfen und die Tendenz der Kriegsparteien, ein vorteilhaftes Bild von sich zu vermitteln. Die Arbeit untersucht die Bedingungen, unter denen Journalisten Partei ergreifen und die Rolle der publizistischen Rahmenbedingungen wird betont. Der Einfluss von Nachrichtenagenturen und US-amerikanischen Elitemedien wird als Schlüsselfaktor für einheitliche Tendenzen in der Kriegsberichterstattung hervorgehoben.
II. Die politischen Voraussetzungen für die Akzeptanz einer militärischen Intervention: Dieses Kapitel analysiert die internationalen politischen Rahmenbedingungen, die die Akzeptanz militärischer Interventionen beeinflussen. Es untersucht den Begriff des „ethnischen Konflikts“ im Kontext internationaler Politik und beleuchtet, wie Krieg als akzeptierte Konfliktlösung institutionalisiert werden kann. Die Rolle der „neuen Weltordnung“ und deren Einfluss auf die Entscheidungsfindung in Bezug auf militärische Interventionen wird ebenfalls untersucht.
III. Die Strategien der Clinton-Administration: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Strategien der Clinton-Administration im Umgang mit internationalen Konflikten, darunter Neoisolationismus, selektives Engagement, kooperative Sicherheit und Primat. Es analysiert den "Clinton-Strategiemix" und dessen Anwendung in Bezug auf militärische Interventionen. Die Kapitel unterstreichen die komplexen Überlegungen und die verschiedenen strategischen Ansätze, die die Entscheidungsprozesse beeinflussen.
IV. Die Beziehung zwischen Medien und Militär in lokal begrenzten Konflikten: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Medien und Militär anhand verschiedener historischer Beispiele, darunter Korea, Vietnam, Falkland, Grenada, Lateinamerika, Irak und Somalia. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie Medienberichterstattung in diesen Konflikten beeinflusst und manipuliert wurde. Der Abschnitt über Ex-Jugoslawien bildet eine Brücke zum folgenden Kapitel über den Kosovo-Konflikt. Die Zusammenfassung des Kapitels synthetisiert die Erkenntnisse über die wiederkehrenden Muster der Medien-Militär-Interaktion in verschiedenen Kontexten.
V. Der Kosovo-Konflikt, die Propagandalinie der NATO, der Aufbau und die Weiterverbreitung der Kriegsagenda: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Kosovo-Konflikt und analysiert, wie die NATO eine spezifische Kriegsagenda konstruiert und verbreitet hat. Es untersucht die Rolle der Medien, insbesondere der NATO-Pressekonferenzen, bei der Manipulation der öffentlichen Meinung. Die Analyse deckt verschiedene Techniken der Sprachmanipulation und die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der journalistischen Elite auf. Unterschiedliche Strategien wie instrumentelle Aktualisierung, PR und die Selektion von Nachrichtenwerten werden im Detail beleuchtet.
VI. Bedingungen für eine pro-interventionistische Berichterstattung: Das Kapitel analysiert die Bedingungen, die eine pro-interventionistische Berichterstattung begünstigen. Es untersucht die Konstruktion von Scheinrealitäten, die Beschränkung und Kontrolle von Journalisten, die Wahl und Aufrechterhaltung von Bedrohungsszenarien sowie die Nutzung von Massakern und Greueltaten als Rechtfertigung für militärische Interventionen. Die Rolle des Kampfes um "höhere Werte" wie Demokratie und Menschenrechte in der Legitimierung von Interventionen wird ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Kosovo-Konflikt, Kriegsberichterstattung, Medienmanipulation, Propaganda, NATO, Clinton-Administration, Internationale Politik, Ethnischer Konflikt, Öffentliche Meinung, Interventionismus, Journalismus, Scheinrealität, Demokratie, Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Medien und Militärintervention im Kosovo-Konflikt
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Rahmenbedingungen für pro-interventionistische Berichterstattung während militärischer Interventionen westlicher Staaten, insbesondere am Beispiel des Kosovo-Konflikts 1998-1999. Sie analysiert den Aufbau und die Verbreitung einer Kriegsagenda und beleuchtet die Interaktion zwischen Politik, Medien und Militär.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die politischen Voraussetzungen für die Akzeptanz militärischer Interventionen, die Strategien der Clinton-Administration, die Beziehung zwischen Medien und Militär in der Kriegsberichterstattung, die Manipulation und Selektion von Nachrichten im Kosovo-Konflikt und die Bedingungen für eine pro-interventionistische Berichterstattung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung und Standortbestimmung; Die politischen Voraussetzungen für die Akzeptanz einer militärischen Intervention; Die Strategien der Clinton-Administration; Die Beziehung zwischen Medien und Militär in lokal begrenzten Konflikten; Der Kosovo-Konflikt, die Propagandalinie der NATO, der Aufbau und die Weiterverbreitung der Kriegsagenda; Bedingungen für eine pro-interventionistische Berichterstattung; und schließlich eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Thematik.
Welche Rolle spielen die Medien im Kosovo-Konflikt laut der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass die Medien eine zentrale Rolle im Kosovo-Konflikt spielten. Sie analysiert, wie die NATO und die journalistische Elite eine Kriegsagenda konstruierten und verbreiteten, indem sie Nachrichten manipulierten und selektierten. Dabei werden verschiedene Techniken wie instrumentelle Aktualisierung, PR und die gezielte Auswahl von Nachrichtenwerten untersucht.
Welche Strategien verfolgte die Clinton-Administration?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Strategien der Clinton-Administration im Umgang mit internationalen Konflikten, darunter Neoisolationismus, selektives Engagement, kooperative Sicherheit und Primat. Der sogenannte "Clinton-Strategiemix" und seine Anwendung im Kontext militärischer Interventionen werden analysiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kosovo-Konflikt, Kriegsberichterstattung, Medienmanipulation, Propaganda, NATO, Clinton-Administration, Internationale Politik, Ethnischer Konflikt, Öffentliche Meinung, Interventionismus, Journalismus, Scheinrealität, Demokratie und Menschenrechte.
Welche historischen Konflikte werden als Vergleichsbeispiele herangezogen?
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Medien und Militär anhand verschiedener historischer Beispiele wie Korea, Vietnam, Falkland, Grenada, Lateinamerika, Irak, Somalia und Ex-Jugoslawien, um Muster der Medien-Militär-Interaktion zu identifizieren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass pro-interventionistische Berichterstattung durch verschiedene Faktoren ermöglicht wird, darunter die Konstruktion von Scheinrealitäten, die Beschränkung und Kontrolle von Journalisten, die gezielte Auswahl von Bedrohungsszenarien und die Nutzung von Massakern und Greueltaten als Rechtfertigung für militärische Interventionen. Die Rolle des Kampfes um "höhere Werte" wie Demokratie und Menschenrechte in der Legitimierung von Interventionen wird ebenfalls hervorgehoben.
- Quote paper
- Judith Pillitsch (Author), 2000, Ermöglichung einer pro-interventionistischen Berichterstattung während militärischen Interventionen westlicher Eliteländer am Beispiel des Kosovo-Konflikts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154