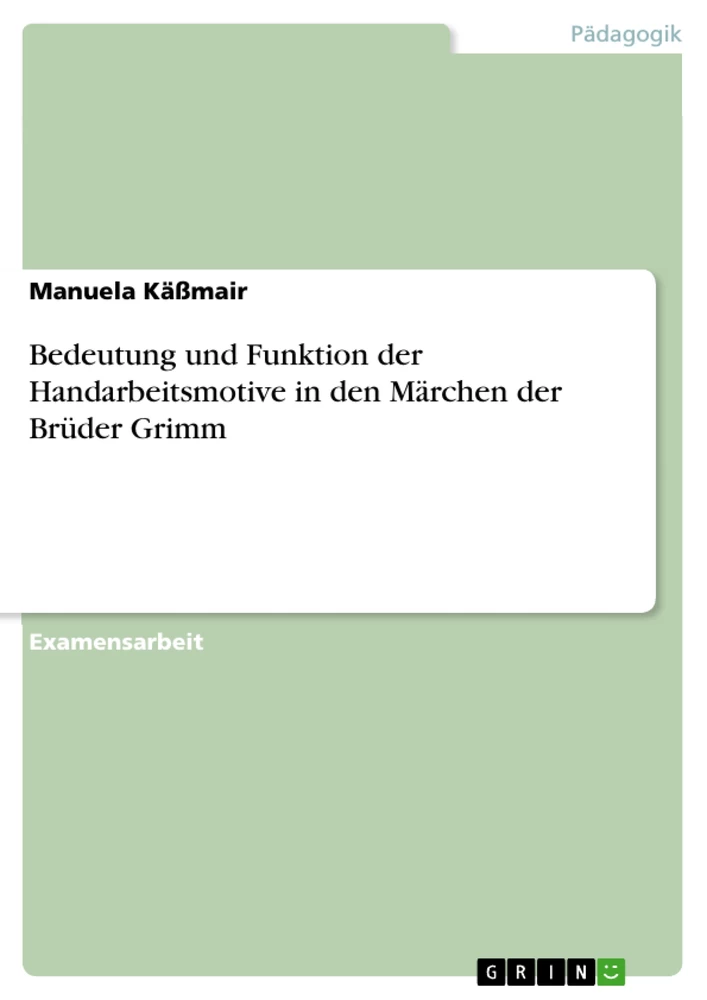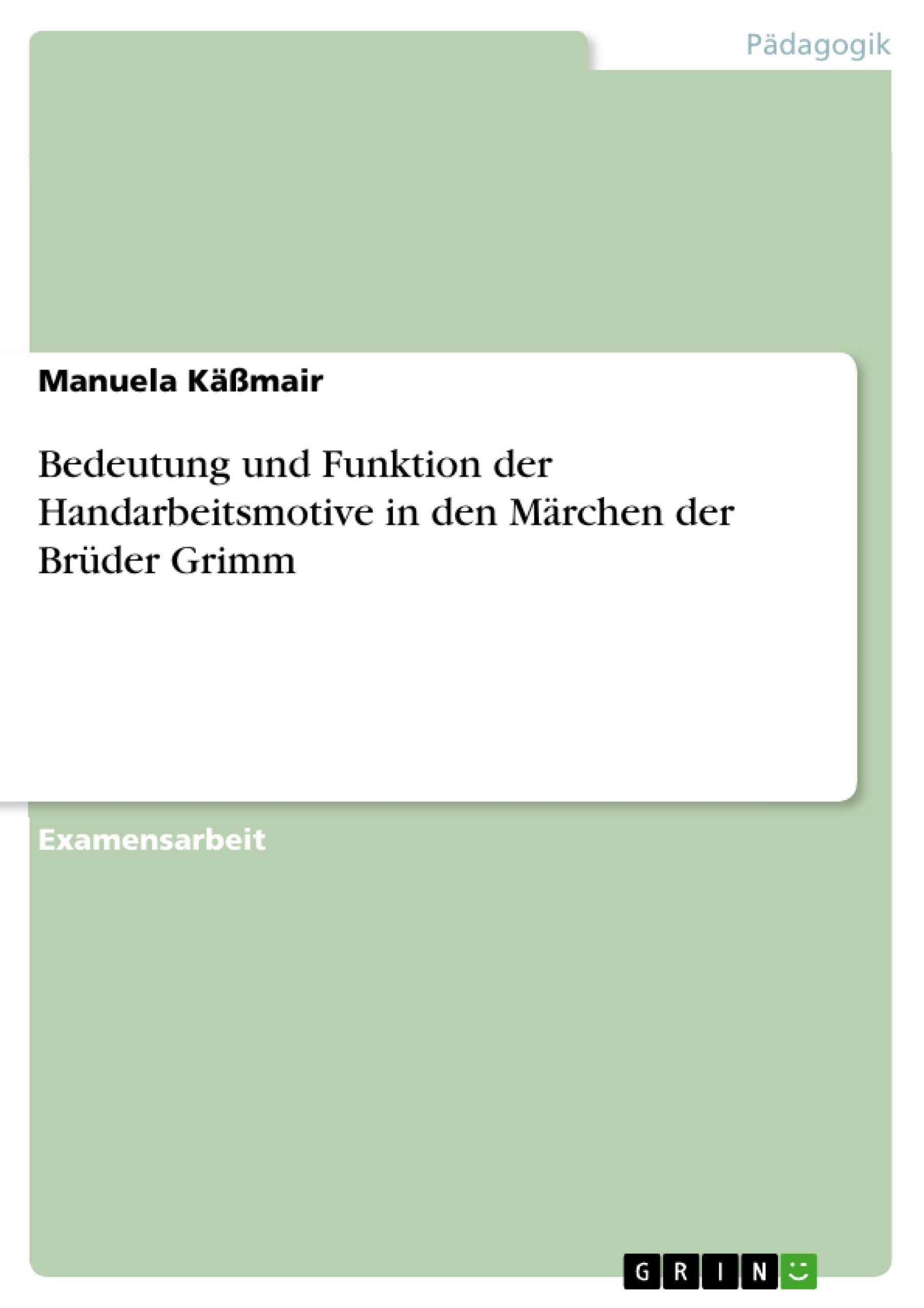Die Brüder Grimm sammelten ihre Kinder- und Hausmärchen (KHM) im 19. Jahrhundert, wobei ihr großer Erfolg vor dem kulturhistorischen Hintergrund jener Zeit gesehen werden muss. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung und Herkunft der Handarbeitsmotive in den KHM. Anhand ausgewählter Erzählungen, in denen die Heldinnen textile Arbeiten verrichten, soll zum einen veranschaulicht werden, wo diese als typisch weibliche geltende Beschäftigungen ihren Ursprung haben und zum anderen erörtert werden, wie dadurch das vorherrschende Frauenbild des 19.Jahrhundert in den Märchen widergespiegelt wird. So wird zunächst die Entstehungsgeschichte der KHM betrachtet und die Entwicklung zum Erziehungsbuch skizziert, um dann die Frau, als vorrangige Rezipientin der Märchen, und ihr entsprechendes Rollenbild im 19. Jahrhundert zu erörtern. Nachdem die Bedeutung der Handarbeit in der Mädchenerziehung jener Zeit betrachtet wurde, werden verschiedene Märchen angeführt, in denen diese Formen der textilen Beschäftigungen eine große Rolle spielen. Dabei stößt man auf mythologische Ursprünge der Handarbeitsmotive und die verschiedenen Bedeutungen dieser Tätigkeiten sowohl im Märchen als auch die überragende Bedeutung für die Rezipierenden. Schließlich kann man den großen Erfolg der KHM damit begründen, dass das Lesepublikum Parallelen zwischen Realitätselementen im Märchen und ihrer eigenen Lebenswirklichkeit herzustellen vermochten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
- 2.1 Definition des Begriffs Märchen
- 2.2 Entstehungsgeschichte und Erfolg der KHM
- 2.3 Die pädagogische Bedeutung der KHM
- 3 Die handarbeitende Frau im 19. Jahrhundert
- 3.1 Frauenbild in der bürgerlichen Gesellschaft
- 3.2 Bedeutung der Handarbeit als typisch weibliche Tätigkeit
- 3.3 Mädchenerziehung – Erziehung durch Handarbeiten
- 4 Die Handarbeitsmotive in den Märchen der Brüder Grimm
- 4.1 Ursprung und Wesen des Spinnens und Webens
- 4.2 Bedeutung und Funktion des Spinnens und Webens in den KHM
- 4.3 Mythologische Vorbilder und übernatürliche Spinnhelfer
- 5 Wirkung der Märchen
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung und den Ursprung von Handarbeitsmotiven in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Ziel ist es, die Verbindung zwischen den in den Märchen dargestellten weiblichen Handarbeiten und dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert, wie diese typisch weiblichen Beschäftigungen in den Märchen dargestellt werden und welche Rolle sie im Kontext der damaligen Mädchenerziehung spielen.
- Entstehung und Entwicklung der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
- Das Frauenbild im 19. Jahrhundert und die Rolle der Handarbeit
- Die Bedeutung von Spinnen und Weben in ausgewählten Märchen
- Mythologische und übernatürliche Aspekte der Handarbeitsmotive
- Der Einfluss der Märchen auf das Verständnis von Frauen und Handarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung, nämlich die Untersuchung der Bedeutung und Herkunft von Handarbeitsmotiven in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der darin besteht, ausgewählte Märchen zu analysieren, um die Verbindung zwischen den weiblichen Handarbeiten und dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts aufzuzeigen. Die Arbeit beginnt mit einem Überblick über die Entstehungsgeschichte der Kinder- und Hausmärchen und deren Entwicklung zum Erziehungsbuch, um den Kontext für die folgende Analyse zu schaffen.
2 Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm (KHM). Es definiert den Begriff "Märchen" und beleuchtet die Entstehungsgeschichte und den Erfolg der KHM vor dem kulturhistorischen Hintergrund des 19. Jahrhunderts. Besonders wird die pädagogische Bedeutung der KHM für die damalige Gesellschaft diskutiert, wobei der Fokus auf der Rolle der Märchen als Erziehungsmittel liegt und die Zielgruppe, das weibliche Publikum, in den Vordergrund gestellt wird.
3 Die handarbeitende Frau im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt das Frauenbild der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert und die zentrale Rolle der Handarbeit im Leben der Frauen. Es untersucht die Bedeutung der Handarbeit als typisch weibliche Tätigkeit und beleuchtet die Methoden der Mädchenerziehung, bei der Handarbeiten eine wichtige Rolle spielten. Die Analyse verdeutlicht, wie Handarbeiten zum gesellschaftlichen Rollenverständnis der Frau beitrugen und welches Bild von Weiblichkeit vermittelt wurde.
4 Die Handarbeitsmotive in den Märchen der Brüder Grimm: Dieses Kapitel analysiert die Handarbeitsmotive (Spinnen und Weben) in den ausgewählten Märchen der Brüder Grimm. Es untersucht deren Ursprung und Wesen, beleuchtet die Bedeutung und Funktion dieser Tätigkeiten innerhalb der Erzählungen und setzt diese in Beziehung zu mythologischen Vorbildern und übernatürlichen Spinnhelfern. Die Analyse zeigt, wie die handwerklichen Tätigkeiten die Handlung und die Charaktere der Märchen beeinflussen und symbolisch aufgeladen sind.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bedeutung von Handarbeitsmotiven in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und den Ursprung von Handarbeitsmotiven (insbesondere Spinnen und Weben) in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen den in den Märchen dargestellten weiblichen Handarbeiten und dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts sowie deren Rolle in der damaligen Mädchenerziehung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Kinder- und Hausmärchen, das Frauenbild im 19. Jahrhundert und die Rolle der Handarbeit darin, die Bedeutung von Spinnen und Weben in ausgewählten Märchen, mythologische und übernatürliche Aspekte der Handarbeitsmotive und den Einfluss der Märchen auf das Verständnis von Frauen und Handarbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm (inkl. Definition des Begriffs Märchen, Entstehungsgeschichte und pädagogischer Bedeutung), ein Kapitel zum Frauenbild und der Handarbeit im 19. Jahrhundert, ein Kapitel zur Analyse der Handarbeitsmotive in den Märchen (inkl. Ursprung, Bedeutung und mythologischer Aspekte), sowie eine Zusammenfassung und Schlussfolgerung.
Welche Märchen werden analysiert?
Die konkrete Auswahl der analysierten Märchen wird im Text nicht explizit genannt. Die Zusammenfassung deutet aber darauf hin, dass ausgewählte Märchen verwendet werden, um die Verbindung zwischen weiblichen Handarbeiten und dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts aufzuzeigen.
Welche Methoden werden angewendet?
Der methodische Ansatz besteht in der Analyse ausgewählter Märchen der Brüder Grimm. Der Fokus liegt darauf, die dargestellten weiblichen Handarbeiten im Kontext des Frauenbildes des 19. Jahrhunderts zu interpretieren und deren Bedeutung für die damalige Mädchenerziehung zu beleuchten.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Verbindung zwischen den in den Märchen dargestellten weiblichen Handarbeiten (Spinnen und Weben) und dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts aufzuzeigen. Es soll analysiert werden, wie diese typisch weiblichen Beschäftigungen in den Märchen dargestellt werden und welche Rolle sie im Kontext der damaligen Mädchenerziehung spielen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die konkreten Schlussfolgerungen werden nicht im FAQ-Format aufgeführt, sondern sind im Kapitel "Zusammenfassung" der Arbeit selbst zu finden. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse der einzelnen Kapitel zusammen und gibt einen Überblick über die gewonnenen Erkenntnisse.
- Citar trabajo
- Manuela Käßmair (Autor), 2010, Bedeutung und Funktion der Handarbeitsmotive in den Märchen der Brüder Grimm, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155040