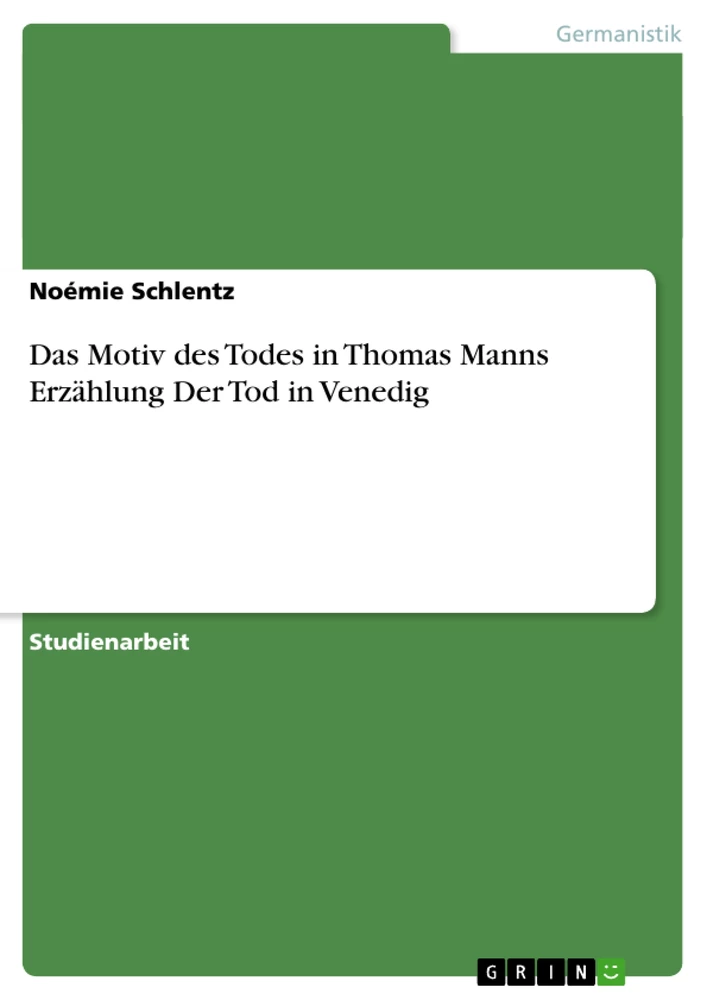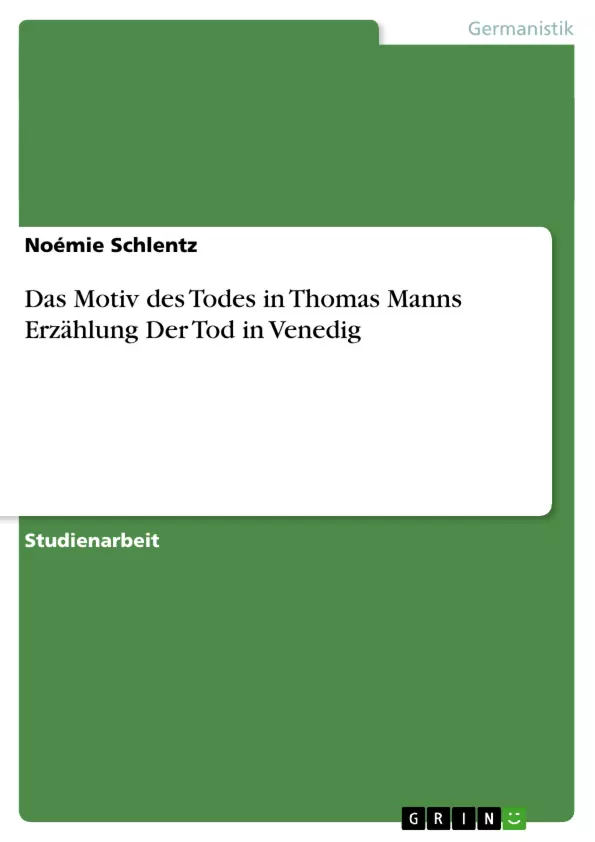Neben dem Motiv des Todes, das unverkennbar schon zu Beginn der Erzählung
gegenwärtig ist und in der gesamten Handlung vorherrscht, gibt es auch noch andere
Leitmotive, die zwar nur indirekt, aber dennoch mit dem Tod in Zusammenhang stehen.
Ich werde kurz auf diese eingehen, weil sie wichtig sind, um die von Thomas Mann
angewandte Leitmotivtechnik besser zu erfassen.
Ein erstes Beispiel ist die zunehmende Verfremdung der gewohnten Welt Aschenbachs:
noch in seiner Heimatstadt München spürt er, dass sein gewohntes Leben irgendwie aus
den Fugen geraten ist. Er steckt nicht nur in einer Schaffens-, sondern in einer
Lebenskrise. So reicht seine alltägliche Bewegung an der frischen Luft nicht aus und er
muss „einen weiteren Spaziergang“ unternehmen, um innerlich zur Ruhe zu kommen.
Dabei hat Gustav von Aschenbach dann ein befremdendes Erlebnis, als er dem
mysteriösen Wanderer begegnet, durch den er sich zum Reisen animiert fühlt. Die
Verfremdung seiner gewohnten Welt setzt sich in einer traumartigen Vision von einer
Urwaldwildnis, in der dionysische „Tiger“ lauern, fort. Auf der Reise nach Venedig
begegnet er zwei weiteren Gestalten, geheimen Todesboten1, deren Erscheinen
Aschenbach zutiefst beunruhigt und die ihn auf dem Weg in die andere, fremde Welt,
welche die Stadt Venedig darstellt, begleiten. Die Verfremdung nimmt im Laufe seines
Venedig-Aufenthaltes immer weiter zu, bis seine bisherige, streng apollinische
Lebenshaltung in eine ungehemmt dionysische Lebensweise übergeht.2
Leitmotivische Bedeutung hat ebenfalls das Meer. Es steht hier für das Maßlose, das
Nichts. Aschenbach wählt sein Reiseziel so aus, dass er in Meeresnähe sein kann. So
hält er sich während seines Aufenthaltes bevorzugt am Meeresstrand auf, wo er seinen
„Geliebten“ ungestört beim Spielen beobachten kann. Nicht zuletzt sind Meer und
Strand Schauplatz seines eigenen Todes, wobei das Meer hier für den Strom Acheron
steht, über den der Fährmann Charon in der griechischen Mythologie die Toten in den
Hades führt.
1 Die Todesboten werden in Kapitel 2.1. ausführlich behandelt.
2 Das Dionysische und Apollinische und alle weiteren mythologischen Bezüge werden in Kapitel 2.2.
behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Das Motiv des Todes in Thomas Manns Erzählung „Der Tod in Venedig❝
- Leitmotivtechnik
- Leitmotive (allgemein)
- Leitmotive mit Todessymbolik
- Die Todesboten – den Tod vorausdeutende Leitfiguren
- Beschreibung der einzelnen Todesboten
- Der Wanderer – eine Vereinigung vieler antiker Todesgestalten
- Der ziegenbärtige Zahlmeister
- Der,,falsche Jüngling“
- Der Gondolier – mythologischer Fährmann Charon
- Der Bademeister
- Tadzio - Psychagog und Todesengel
- Der Bänkelsänger – eine „Kreuzung von Luzifer und Clown“
- Der Clerk und der Hotelfriseur
- Aschenbach – sein eigener Todesbote
- Mythologische Vorbilder der Todesboten
- Hermes – Psychopompos, der Seelenführer
- Hades Herrscher der Unterwelt
- Charon – Fährmann der Verstorbenen
- Thanatos – der personifizierte Tod
- Psychagogos / Pychopompos - Führer und Verführer der Seelen
- Apollon und Dionysos - Zucht und Zügellosigkeit
- Gustav Aschenbachs Tod in Venedig
- (Künstler-)Würde - Tod: Entwicklung eines Lebens auf den Tod hin
- Eros Tod: Tadzios Rolle
- Aschenbachs Tod
- Das Motiv des Todes als zentrales Element in „Der Tod in Venedig“
- Die Rolle der Leitmotivtechnik in der Gestaltung des Todesmotivs
- Die Bedeutung der Todesboten und ihrer mythologischen Vorbilder
- Die Entwicklung von Aschenbachs Lebenshaltung im Kontext des Todesmotivs
- Die Beziehung zwischen Tod und Eros in der Erzählung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Motiv des Todes in Thomas Manns Erzählung „Der Tod in Venedig“. Sie untersucht die Leitmotivtechnik, die Thomas Mann verwendet, um das Motiv des Todes in der Erzählung zu veranschaulichen und ergründet die Rolle verschiedener Todesboten. Der Fokus liegt auf den verschiedenen mythologischen Vorbildern der Todesboten und der Bedeutung von Gustav Aschenbachs Tod im Kontext der Erzählung.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Leitmotivtechnik, die Thomas Mann in „Der Tod in Venedig“ anwendet. Es wird hervorgehoben, wie Leitmotive, wie die zunehmende Verfremdung der gewohnten Welt Aschenbachs, das Meer und das Wetter, in ihrer Bedeutung mit dem Tod in Verbindung stehen. Das zweite Kapitel widmet sich den Todesboten in der Erzählung und analysiert ihre einzelnen Eigenschaften, die jeweils eine Verbindung zu antiken Todesgestalten aufweisen. Neben den einzelnen Todesboten werden auch ihre mythologischen Vorbilder, wie Hermes, Hades, Charon, Thanatos, Psychagogos und Apollon/Dionysos, vorgestellt. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf Gustav Aschenbachs Tod in Venedig und beleuchtet die Entwicklung seines Lebens auf den Tod hin sowie die Rolle Tadzios als Todesengel und die Ursachen für Aschenbachs Tod.
Schlüsselwörter
Der Tod in Venedig, Leitmotivtechnik, Todessymbolik, Todesboten, mythologische Vorbilder, Hermes, Hades, Charon, Thanatos, Psychagogos, Apollon, Dionysos, Gustav Aschenbach, Tadzio, Eros, Tod.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Motiv in Thomas Manns "Der Tod in Venedig"?
Das zentrale Motiv ist der Tod, der durch verschiedene Leitmotive und Symbole von Beginn der Erzählung an präsent ist.
Wer sind die "Todesboten" in der Erzählung?
Figuren wie der mysteriöse Wanderer, der Gondolier (Charon) und Tadzio (Todesengel) fungieren als Vorboten für Aschenbachs Ende.
Welche mythologischen Bezüge nutzt Thomas Mann?
Mann nutzt Figuren der griechischen Mythologie wie Hermes (Seelenführer), Charon (Fährmann) und Thanatos (personifizierter Tod).
Was symbolisiert das Meer in der Erzählung?
Das Meer steht für das Maßlose, das Nichts und dient als Schauplatz für Aschenbachs Tod, vergleichbar mit dem Strom Acheron.
Wie verändert sich Gustav Aschenbach im Laufe der Geschichte?
Aschenbach wandelt sich von einer strengen, apollinischen Lebenshaltung hin zu einer ungehemmten, dionysischen Leidenschaft, die in seinen Tod führt.
- Citar trabajo
- Noémie Schlentz (Autor), 2002, Das Motiv des Todes in Thomas Manns Erzählung Der Tod in Venedig, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15508