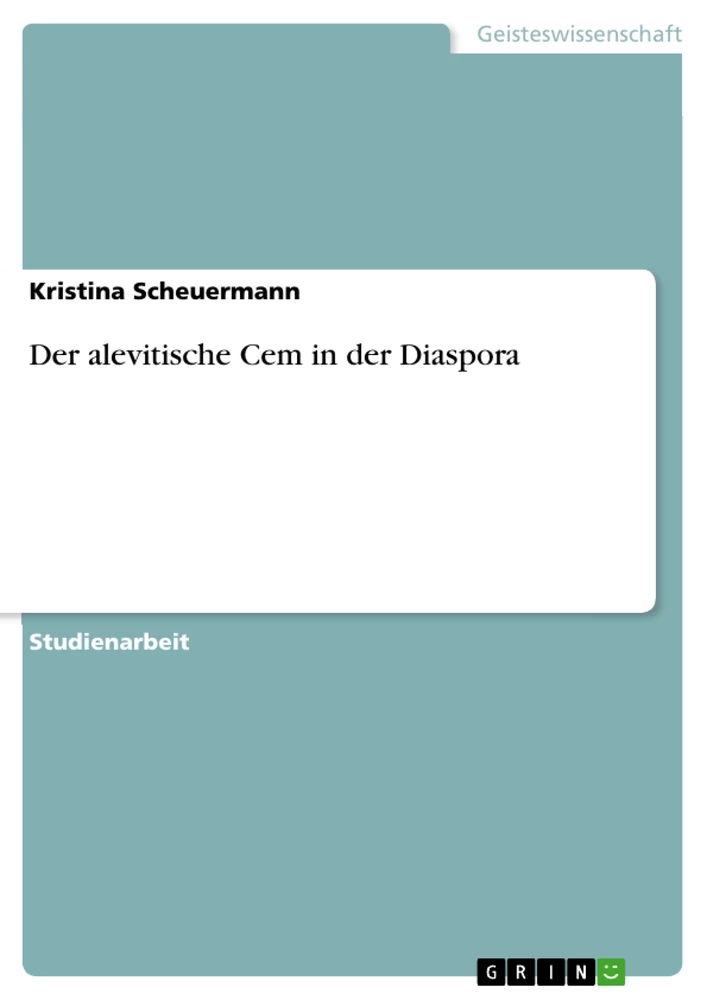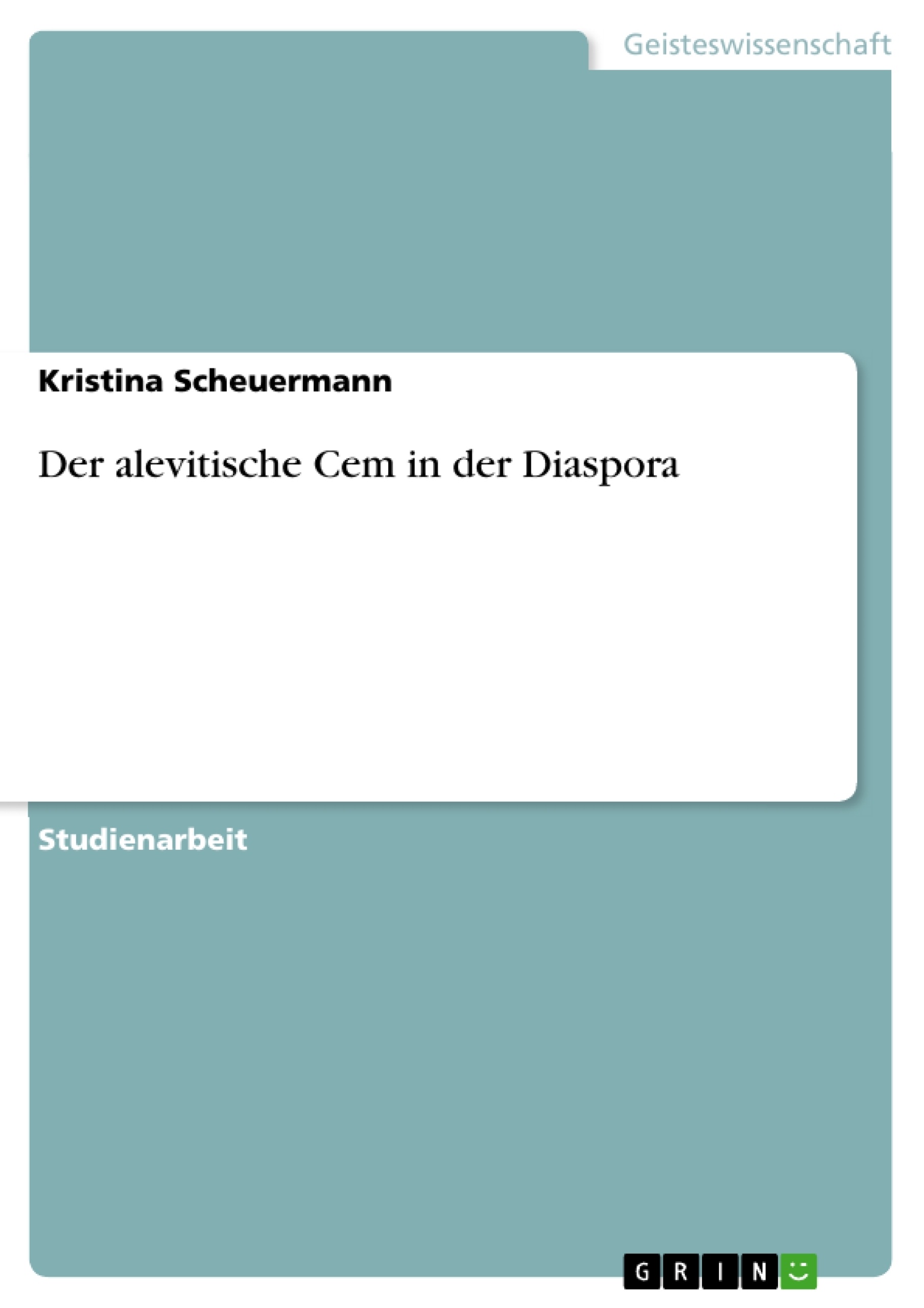Obwohl Aleviten schätzungsweise
etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung der Türkei ausmachen (Wunn 2007:98) und
ungefähr eine halbe Mio. in Deutschland leben ( Motika/ Langer 2005: 74)1. Es gibt jedoch
vielfältige Gründe, weshalb die Aleviten lange wert darauf legten auch unbekannt zu bleiben.
In der Türkei bietet sich dieser Bevölkerungsgruppe folgende Situation: „Aleviten […] zählen
zu den traditionell durch die sunnitische Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzten Gruppen.
Erlittene Diskriminierungen und die ökonomische Marginalisierung setzen diese unter
zusätzlichen Migrationsdruck.“ (Motika/ Langer 2005: 75) Diese Unterdrückung hat sie -
zum einen- in der Vergangenheit dazu bewogen ihre Identität geheim zu halten (dieses
Verhalten wird takiye genannt) und sich in Randbezirken (z.B. im Gebirge) anzusiedeln. Zum
anderen tendierten viele im letzten Jahrhundert zur Migration. Während des Revivals des
Alevitentums in den 80er Jahren in Deutschland -während dessen die Aleviten die takiye
aufgaben- wurden hier zahlreiche alevitische Vereine gegründet. Diese Vereine arbeiteten und
arbeiten immer noch an einer alevitischen Erinnerungskultur und waren von da an Träger der
rituellen Praxis. Das wichtigste Ritual der Aleviten ist der Cem. In dieser Hausarbeit möchte
ich mich nun mit der Art der Ausführung dieses Rituals in der deutschen Diaspora
beschäftigen. Um mich diesem Phänomen des sozusagen „mit-immigrierten“ Rituals
anzunähern möchte ich mich des Konzeptes des „Ritualtransfers“ bedienen. Dieses wurde an
der Ruprecht-Karls-Universität im Rahmen des SFB 619 RITUALDYNAMIK entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Alevitentum
- Ein historischer Abriss zur Unterdrückung der Aleviten
- Religiöse Vorstellungen
- Theoretischer Unterbau
- Ritual
- Ritualtransfer/ Ritualwanderung
- Migration
- Hybridisierung
- Der traditionelle bzw. idealtypische Cem
- Formale Beschreibung des Cem
- Zu Ablauf und Inhalt eines idealtypischen Cem
- Funktion und Interpretation des traditionellen Cem
- Cem heute
- Veränderte Kontextfaktoren
- Cem in Hamburg
- Formale Bedingungen
- Zum Inhalt und Ablauf der Cems in Hamburg
- Interpretation der Cems
- Cem in Heilbronn
- Formale Beschreibung
- Zu Ablauf und Inhalt
- Interpretation
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das alevitische Ritual des Cem in der deutschen Diaspora, insbesondere in Hinblick auf Veränderungen, die durch den Ritualtransfer im Kontext der Migration entstanden sind.
- Historische Unterdrückung und Marginalisierung der Aleviten in der Türkei
- Alevitische religiöse Vorstellungen und Praxis, insbesondere das Ritual des Cem
- Das Konzept des Ritualtransfers im Kontext der Migration
- Veränderungen des Cem in der Diaspora im Vergleich zum traditionellen Ritual
- Der Einfluss von Kontextfaktoren auf die Ritualpraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einem Überblick über die Geschichte der Verfolgung und Unterdrückung der Aleviten im Osmanischen Reich und der Türkischen Republik. Es werden die Gründe für die Geheimhaltung des Alevitentums (Takiye) und die Migration der Aleviten in die Diaspora beleuchtet. Im Anschluss werden wichtige Begriffe wie Ritual, Ritualtransfer, Migration und Hybridisierung eingeführt. Das Kapitel über den traditionellen Cem zeichnet ein Bild des Rituals in seiner idealtypischen Form und betrachtet seinen Ablauf, Inhalt und seine Funktion.
Das fünfte Kapitel fokussiert auf die veränderten Kontextfaktoren in Deutschland, die einen Einfluss auf die Ritualpraxis haben. Anschliessend wird ein Beispiel für einen Cem aus der Anfangszeit des alevitischen Revivals in Deutschland vorgestellt, der sich deutlich vom traditionellen Cem unterscheidet. Das Kapitel untersucht den Einfluss der kulturellen Amnesie des Alevitentums auf das Ritual.
Zum Abschluss werden Beobachtungen zu einem aktuellen Cem in Heilbronn beschrieben und die Veränderungen des Rituals im Kontext der Diaspora analysiert.
Schlüsselwörter
Alevitentum, Cem, Ritual, Ritualtransfer, Migration, Hybridisierung, Takiye, Diaspora, Kultur, Religion, Türkei, Deutschland, Kontextfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das alevitische Cem-Ritual?
Der Cem ist das wichtigste religiöse Ritual der Aleviten, das traditionell gemeinschaftlich durchgeführt wird und soziale sowie spirituelle Funktionen erfüllt.
Was bedeutet der Begriff „Takiye“?
Takiye bezeichnet das Verbergen der eigenen religiösen Identität zum Schutz vor Verfolgung, was die Aleviten aufgrund jahrhundertelanger Unterdrückung praktizierten.
Wie verändert sich das Cem-Ritual in der Diaspora?
Durch den „Ritualtransfer“ nach Deutschland passt sich der Cem an neue Kontextfaktoren an, was zu Hybridisierung und Veränderungen im Ablauf führt.
Welche Rolle spielen alevitische Vereine in Deutschland?
Seit dem Revival des Alevitentums in den 80er Jahren sind Vereine die Träger der rituellen Praxis und arbeiten an einer kollektiven Erinnerungskultur.
Was ist ein „Ritualtransfer“?
Es ist ein wissenschaftliches Konzept, das untersucht, wie Rituale bei der Migration in einen neuen kulturellen Kontext „mitwandern“ und sich dabei transformieren.
- Citation du texte
- Kristina Scheuermann (Auteur), 2010, Der alevitische Cem in der Diaspora, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155186