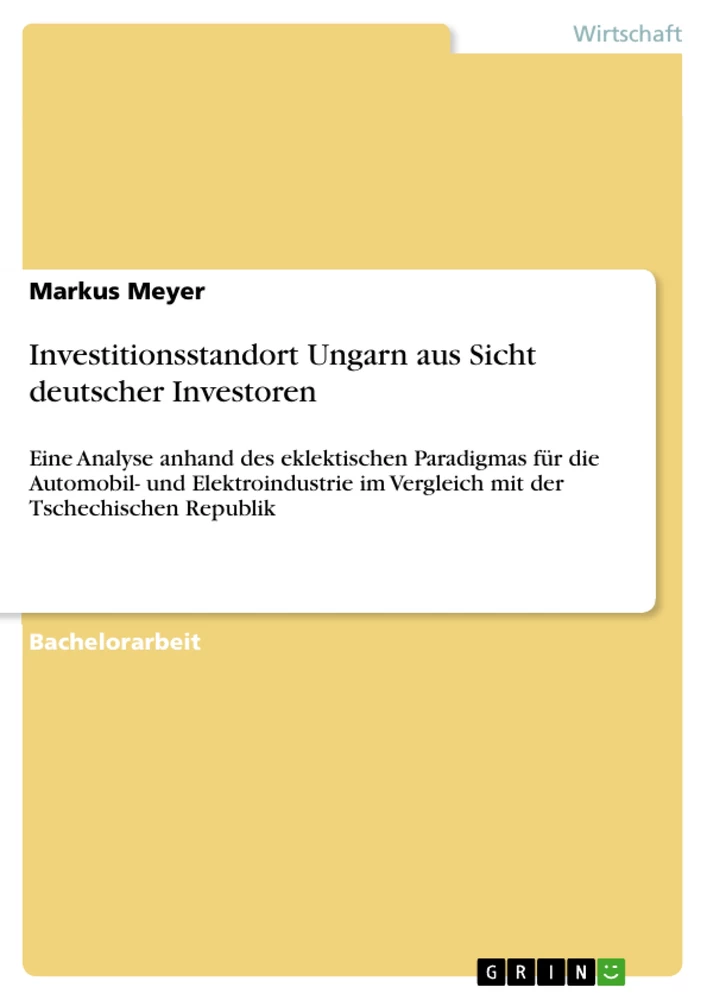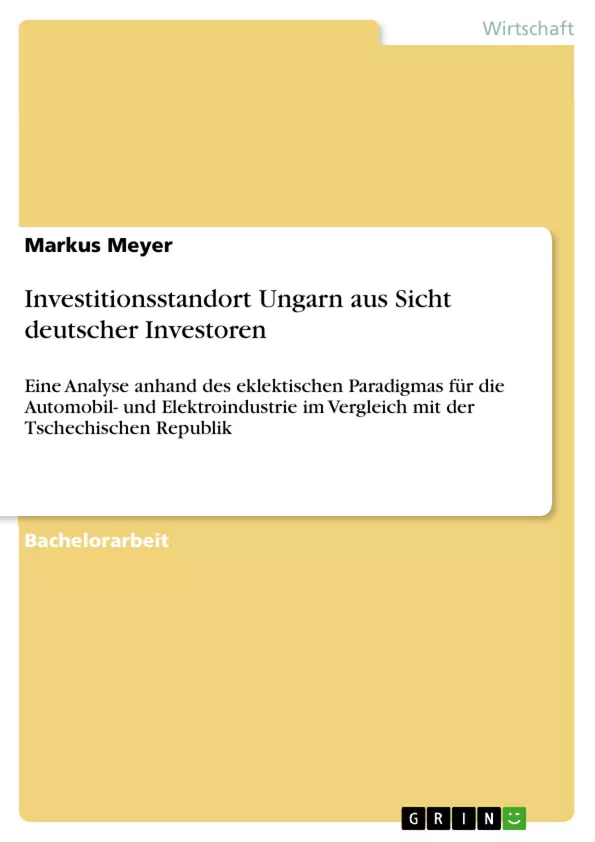Die weltweite Direktinvestitionstätigkeit hat als treibende Kraft der globalen wirtschaftlichen Verflechtung insbesondere seit Ende des zweiten Weltkrieges zunehmend an Bedeutung gewonnen. Im europäischen Raum wurde diese Entwicklung durch die wirtschaftliche und politische Öffnung der osteuropäischen Staaten 1989/1990 beeinflusst, wobei deutsche Unternehmen zu Beginn hauptsächlich die im Jahr 2004 bzw. 2007 der Europäischen Union beigetretenen Mitgliedsstaaten Osteuropas als Ziel ihrer Investitionen sahen. In dieser Ländergruppe bildete sich die ungarische Volkswirtschaft als Investitionsstandort von großer Bedeutung heraus. Begründet war dies mit der ungarischen Rolle als Reformvorreiter im Öffnungsprozess und der proaktiven Akquise ausländischer Investoren. Ungarn behauptete diese Rolle bis etwa 1999; ab diesem Zeitpunkt rückte auch die Tschechische Republik immer mehr in den Fokus der Kapitalgeber. So konnten diese beiden Staaten im Jahr 2004 jeweils rund 31 Prozent der deutschen Direktinvestitionsbestände in den zehn neuen Mitgliedsstaaten auf sich vereinen. In den darauf folgenden Jahren zeigte sich deutlich, dass die Tschechische Republik die Spitzenposition vor Ungarn einnimmt. Ziel dieser Arbeit ist es, durch die Anwendung des eklektischen Paradigmas von Dunning als verbindende Direktinvestitionstheorie zu bestimmen, welche Faktoren den oben beschriebenen Attraktivitätsverlust Ungarns als Investitionsstandort für deutsche Investoren begründen, und zugleich den empirischen Erklärungswert genannter Theorie zu prüfen. Speziell dieser Erklärungsansatz wird gewählt, da ein zusätzlicher Erklärungswert aus der Verknüpfung unternehmens-, standort- und transaktionstheoretischer Aspekte einzelner partialanalytischer Theorien hervorgeht. So wird ermöglicht, zugleich der Verteilung von Fähigkeiten und Ressourcen auf Unternehmensebene, den unterschiedlichen Standortgegebenheiten zwischen Deutschland und Ungarn sowie den Erfolgsaussichten der Koordinationsformen Markt und Hierarchie in Ungarn Rechnung zu tragen, also das „Warum“, das „Wo“ und das „Wie“ als die drei determinierenden Bestimmungsgrößen der Direktinvestitionen zu erläutern. Um den Attraktivitätsverlust Ungarns als Direktinvestitionsstandort zu erläutern, bietet es sich an, Ungarn einem Konkurrenten um Direktinvestitionen gegenüberzustellen, welcher eine vergleichbare Wirtschaftsleistung aufweist und ein vergleichbares Entwicklungsstadium im Transformationsprozess erreicht hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Theoretische Grundlagen ausländischer Direktinvestitionen
- 2.1 Begriffsbestimmung und Wesen
- 2.2 Formen der Auslandsaktivität
- 2.3 Formen von Direktinvestitionen
- 2.4 Betrachtungsebenen von Direktinvestitionen
- 2.5 Die multinationale Unternehmung als Träger von Direktinvestitionen
- 2.6 Motive von Direktinvestitionen
- 2.6.1 Beschaffungsorientierte Motive („resource-seeking“)
- 2.6.2 Absatzorientierte Motive („market-seeking“)
- 2.6.3 Effizienzorientierte Motive („efficiency-seeking“)
- 2.6.4 Strategische Motive („strategic asset-seeking“)
- 2.6.5 Sonstige Motive
- 3. Das eklektische Paradigma als verbindender Erklärungsansatz für Direktinvestitionen
- 3.1 Zugrundeliegende Theorien
- 3.2 Vorteilsarten der Auslandsaktivität
- 3.2.1 Eigentumsvorteile
- 3.2.2 Internalisierungsvorteile
- 3.2.3 Standortvorteile des Ziellandes
- 3.3 Formen der Auslandsaktivität
- 3.4 Kritische Würdigung
- 4. Die Attraktivität Ungarns als Investitionsstandort für die deutsche Automobil- und Elektroindustrie im Vergleich mit der Tschechischen Republik
- 4.1 Branchenübersicht
- 4.2 Direktinvestitionsbestände
- 4.3 Motive der deutschen Automobil- und Elektroindustrie
- 4.4 Bestimmung der Einflussfaktoren
- 4.4.1 Eigentumsvorteile
- 4.4.1.1 Materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter
- 4.4.1.2 Transaktionelle Vorteile
- 4.4.1.3 Internalisierungsvorteile
- 4.4.1.4 Institutionelle Werte
- 4.4.1.5 Zentrale Unternehmenssteuerung
- 4.4.1.6 Institutionelle Rahmenbedingungen
- 4.4.1.7 Zusammenfassung
- 4.4.2 Standortvorteile
- 4.4.2.1 Humankapital
- 4.4.2.2 Infrastrukturelle Rahmenbedingungen
- 4.4.2.3 Fiskalpolitik
- 4.4.2.4 Industrielle Cluster und Spezialisierung
- 4.4.2.5 Charakteristika des Marktes
- 4.4.2.6 Zusammenfassung
- 4.5 Zusammenführung der Vorteilsarten
- 4.6 Kritische Würdigung der erzielten Ergebnisse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Thesis „Investitionsstandort Ungarn aus Sicht deutscher Investoren“ analysiert die Attraktivität Ungarns als Investitionsstandort für die deutsche Automobil- und Elektroindustrie. Die Arbeit untersucht die relevanten Einflussfaktoren aus der Perspektive deutscher Investoren, die sich für eine Expansion nach Ungarn oder die Tschechische Republik entscheiden.
- Analyse der theoretischen Grundlagen ausländischer Direktinvestitionen
- Anwendung des eklektischen Paradigmas zur Erklärung von Direktinvestitionen
- Vergleich der Investitionsbedingungen in Ungarn und der Tschechischen Republik
- Bewertung der Attraktivität Ungarns als Investitionsstandort für die Automobil- und Elektroindustrie
- Ableitung von Schlussfolgerungen für zukünftige Investitionsentscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Problemstellung und Zielsetzung der Untersuchung. Es wird die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage der Arbeit dargelegt. Kapitel 2 liefert eine theoretische Grundlage für das Verständnis von Direktinvestitionen. Es werden verschiedene Definitionen, Formen und Motive von Direktinvestitionen sowie das eklektische Paradigma als Erklärungsansatz vorgestellt. Kapitel 3 beleuchtet die Attraktivität Ungarns als Investitionsstandort im Vergleich zur Tschechischen Republik. Dabei werden die jeweiligen Standortvorteile der beiden Länder untersucht und in Bezug auf die deutsche Automobil- und Elektroindustrie analysiert. Die Analyse konzentriert sich auf die Faktoren Humankapital, Infrastruktur, Fiskalpolitik, Clusterbildung, Marktentwicklung sowie die Attraktivität des Marktes für deutsche Investoren. Kapitel 4 diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung und leitet Schlussfolgerungen für zukünftige Investitionsentscheidungen ab.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Direktinvestitionen, Investitionsstandort, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Ungarn, Tschechische Republik, Standortvorteile, eklektisches Paradigma, deutsche Investoren und die relevanten Einflussfaktoren wie Humankapital, Infrastruktur und Fiskalpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Warum verlor Ungarn an Attraktivität als Investitionsstandort für deutsche Unternehmen?
Ungarn war zunächst Reformvorreiter, verlor jedoch ab etwa 1999 an Boden gegenüber der Tschechischen Republik, die eine Spitzenposition bei deutschen Direktinvestitionen einnahm. Die Arbeit untersucht diesen Attraktivitätsverlust anhand des eklektischen Paradigmas von Dunning.
Was ist das eklektische Paradigma von Dunning?
Es ist eine Theorie zur Erklärung von Direktinvestitionen, die unternehmens-, standort- und transaktionstheoretische Aspekte verknüpft, um das „Warum“, „Wo“ und „Wie“ von Auslandsaktivitäten zu erläutern.
Welche Branchen stehen im Fokus der Untersuchung?
Die Analyse konzentriert sich speziell auf die deutsche Automobil- und Elektroindustrie im Vergleich zwischen Ungarn und der Tschechischen Republik.
Welche Standortvorteile werden in der Arbeit analysiert?
Es werden Faktoren wie Humankapital, infrastrukturelle Rahmenbedingungen, Fiskalpolitik, industrielle Clusterbildung sowie Marktcharakteristika untersucht.
Welche Motive für Direktinvestitionen werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen beschaffungsorientierten (resource-seeking), absatzorientierten (market-seeking), effizienzorientierten (efficiency-seeking) und strategischen Motiven.
- Quote paper
- Markus Meyer (Author), 2009, Investitionsstandort Ungarn aus Sicht deutscher Investoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155204