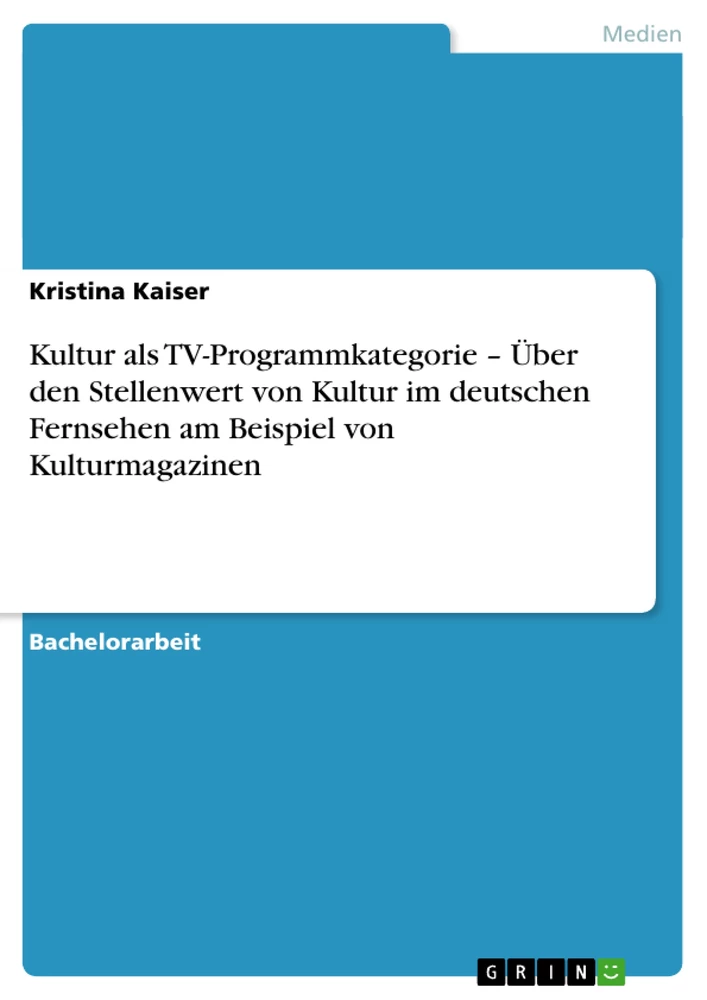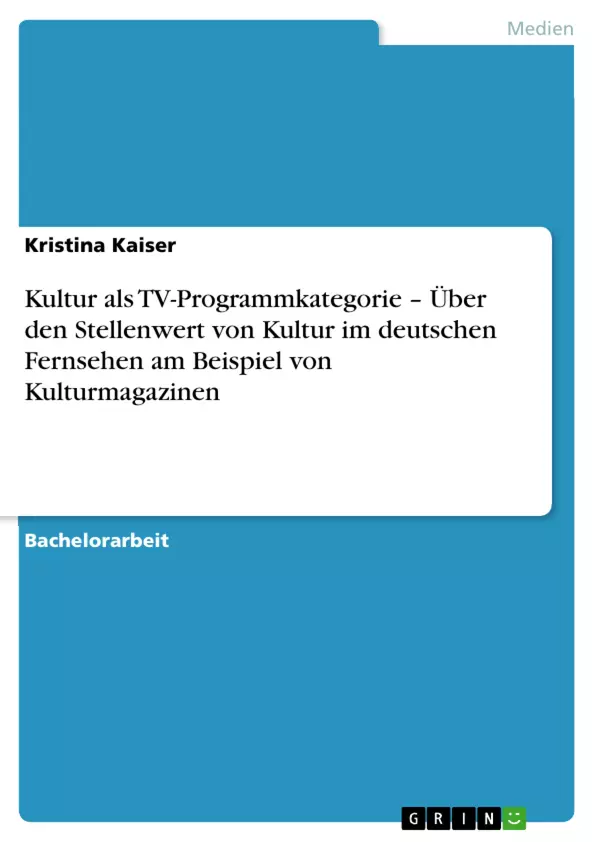Kultur als TV-Programmkategorie –
über den Stellenwert von Kultur im deutschen Fernsehen am Beispiel von Kulturmagazinen.
Die Rundfunkanstalten setzen heute zunehmend auf Werbeeinnahmen um ihren Betrieb zu finanzieren. Während sie mehr denn je ihr Programmangebot auf eine Maximierung der Zuschauerzahlen ausrichten, haben die Kultursendungen im deutschen Fernsehen mit immer schwierigeren Rahmenbedingungen zu kämpfen. Sendeplatzverlegungen auf unattraktive Sendeplätze spät abends, die Abschiebung von Kultursendungen in Spartenkanäle für Minderheiten oder das Absetzen von Kulturformaten wie Polylux aus Kostengründen sind Folgen des immer größer werdenden Quotendrucks. Doch neben den ökonomischen Abwägungen, müssen die Programmverantwortlichen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten bei ihren Entscheidungen auch immer den Auftrag um die kulturelle Verantwortung, der ihnen gegeben ist, berücksichtigen.
Doch wie steht es tatsächlich um den Kulturauftrag des deutschen Fernsehens?
Das Fernsehen stellt als gesellschaftliches Leitmedium zweifellos einen bedeutenden kulturellen Faktor dar, transportiert kulturelle Vorstellungen und prägt Gesellschaft und Kultur unserer Zeit. Hauptinteresse dieser Arbeit ist jedoch nicht die besagte Fernsehkultur, vielmehr geht es um die vom Medium Fernsehen transportierten kulturellen Inhalte und Kulturformen. Ziel ist es herauszufinden, welchen Stellenwert Kultursendungen, und dabei insbesondere Kulturmagazine, die seit Beginn der 60er Jahre wohl meist verbreiteteste Form der TV-Kulturvermittlung, im Programm der deutschen Sendeanstalten einnehmen.
Neben einer allgemeinen Analyse des Verhältnisses von Kultur und Fernsehen im zweiten Kapitel soll im dritten Kapitel am Beispiel der Kulturmagazine untersucht werden, wie es um die Kultur im deutschen Fernsehen bestellt ist.
Dabei wird es um den kulturellen Programmauftrag der Öffentlich-Rechtlichen gehen um im Anschluss einen Überblick auf das den Entscheidungen zugrunde liegende Kulturverständnis der Programmverantwortlichen zu geben und dann eine Bestandsaufnahme über den Stellenwert der Kultur und der Kulturmagazine im deutschen Fernsehen zu geben. Bevor Entwicklung und Charakteristika des Subgenres Kulturmagazin dargestellt werden soll es zunächst um die Entstehungsgeschichte der Gattung Fernsehmagazin gehen. Im vierten Kapitel erfolgt dann die Analyse zur Standortbestimmung der Kulturmagazine in der deutschen Programmlandschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kulturbegriff
- Das deutsche Kulturverständnis nach 1945
- Der medienrechtliche Kulturbegriff
- Der TV-Kulturbegriff
- Kultur und Fernsehen
- Fernsehen - Unterhaltungsindustrie und Bildungsinstitut
- Fernsehen als Kulturvermittler
- Fernsehen als Kulturfaktor
- Kultur im deutschen Fernsehen
- Der kulturelle Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender
- Das Kulturverständnis der Programmverantwortlichen
- 60er Jahre: Reproduktion von Bewährtem
- Ende 60er/ Anfang 70er Jahre: Politisierung der Kultur
- 70er Jahre: Neuer Konservatismus
- 80er Jahre: Wettbewerb im dualen System
- Aktuelle Situation
- Der Stellenwert der Programmkategorie Kultur
- Bestandsaufnahme
- Kulturinteresse in der Bevölkerung
- Kompetenz der Kulturanbieter
- Kulturmagazine
- Das Genre Fernsehmagazin
- Historische Entwicklung
- Ästhetik
- Inhalte
- Aktuelle Lage
- Der Fall Polylux
- Untersuchung der Programmschemata
- Bewertungskriterien
- Aufbau der Analyse
- Begründung der Methodik
- Senderauswahl
- Stichprobengröße und Repräsentativität
- Wahl des untersuchten Sendevolumens
- Kulturmagazine der Sender
- ARD
- ZDF
- Dritten Programme
- Kommerzielle Sender
- Spartenkanäle
- Kernaussagen der Analyse
- Kulturanteil
- Sendezeiten
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Stellenwert von Kultursendungen, insbesondere Kulturmagazinen, im deutschen Fernsehen. Ziel ist die Analyse des Anteils von Kulturmagazinen am durchschnittlichen Fernsehprogramm, ihrer Sendezeiten und der Reaktion der Programmverantwortlichen auf den Quotendruck. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss des ökonomischen Drucks auf den kulturellen Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender.
- Der Kulturbegriff im Wandel
- Der kulturelle Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens
- Das Verhältnis von Kultur, Massenmedien und Gesellschaft
- Die Entwicklung und Charakteristika von Kulturmagazinen
- Der Einfluss des Quotendrucks auf die Programmgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht den Stellenwert von Kultursendungen, insbesondere Kulturmagazinen, im deutschen Fernsehen vor dem Hintergrund des zunehmenden ökonomischen Drucks und des kulturellen Programmauftrags der öffentlich-rechtlichen Sender. Sie analysiert den Anteil der Kulturmagazine am Gesamtprogramm, ihre Sendezeiten und die Reaktionen der Programmverantwortlichen auf den Quotendruck.
Der Kulturbegriff: Dieses Kapitel erörtert den vielschichtigen Kulturbegriff in Deutschland, von der klassischen Hochkultur bis zur Alltagskultur. Es differenziert zwischen dem allgemeinen Kulturverständnis, dem medienrechtlichen und dem spezifischen TV-Kulturbegriff, wobei die Unschärfe des Begriffs und seine unterschiedliche Interpretation hervorgehoben werden.
Kultur und Fernsehen: Der Abschnitt analysiert das Fernsehen als Massenmedium mit sowohl unterhaltenden als auch bildungsorientierten Funktionen. Es wird die Rolle des Fernsehens als Kulturvermittler und als Kulturfaktor selbst betrachtet, wobei sowohl die positiven als auch die kritischen Perspektiven auf den Einfluss des Mediums auf die Kultur beleuchtet werden.
Kultur im deutschen Fernsehen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem kulturellen Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender, dem Kulturverständnis der Programmverantwortlichen in verschiedenen Epochen und dem tatsächlichen Stellenwert der Programmkategorie "Kultur". Es analysiert die Entwicklung des Kulturverständnisses von der Reproduktion von Bewährtem bis hin zum heutigen Ansatz der Alltagskultur. Der Einfluss des Wettbewerbs mit kommerziellen Sendern und der Quotendruck werden ebenfalls diskutiert.
Untersuchung der Programmschemata: Dieser Abschnitt beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung der Programmschemata ausgewählter Sender im März 2010. Es werden die Bewertungskriterien, der Aufbau der Analyse und die Begründung der gewählten Methodik (Senderauswahl, Stichprobengröße, Sendevolumen) detailliert erläutert. Die Ergebnisse der Analyse der Kulturmagazine verschiedener Sender (ARD, ZDF, Dritte Programme, 3sat) werden zusammengefasst und interpretiert.
Schlüsselwörter
Kultur im Fernsehen, Kulturmagazine, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Quotendruck, kultureller Programmauftrag, Kulturbegriff, Massenmedien, Medienlandschaft, Programmgestaltung, Alltagskultur, Hochkultur, Analyse, Programmschemata.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: "Kultur im deutschen Fernsehen"
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Stellenwert von Kultursendungen, insbesondere Kulturmagazinen, im deutschen Fernsehen. Sie analysiert den Anteil dieser Sendungen am Gesamtprogramm, ihre Sendezeiten und den Einfluss des ökonomischen Drucks und des Quotendrucks auf die Programmgestaltung der öffentlich-rechtlichen Sender.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Kulturbegriffs, den kulturellen Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das Verhältnis von Kultur, Massenmedien und Gesellschaft, die Entwicklung und Charakteristika von Kulturmagazinen sowie den Einfluss des Quotendrucks auf die Programmgestaltung. Sie analysiert auch die Programmschemata verschiedener Sender (ARD, ZDF, Dritte Programme, Kommerzielle Sender und Spartenkanäle).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Kulturbegriff (inkl. medienrechtlichem und TV-spezifischem Kulturbegriff), Kultur und Fernsehen, Kultur im deutschen Fernsehen (inkl. Entwicklung des Kulturverständnisses der Programmverantwortlichen in verschiedenen Epochen), sowie eine Kapitel zur Untersuchung der Programmschemata mit detaillierter Methodikbeschreibung (Senderauswahl, Stichprobengröße etc.) und Ergebnisinterpretation. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und Schlüsselwörtern.
Welche Methodik wird in der empirischen Untersuchung angewendet?
Die empirische Untersuchung analysiert die Programmschemata ausgewählter Sender im März 2010. Es werden detaillierte Bewertungskriterien angewendet, und die Methodik umfasst die Begründung der Senderauswahl, der Stichprobengröße und des untersuchten Sendevolumens. Die Ergebnisse werden hinsichtlich des Kulturanteils, der Sendezeiten und des Ausblicks interpretiert.
Welche Sender wurden in der Untersuchung berücksichtigt?
Die Untersuchung umfasst Kulturmagazine der ARD, des ZDF, der Dritten Programme, kommerzieller Sender und Spartenkanäle.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Analyse konzentrieren sich auf den Anteil von Kultursendungen am Gesamtprogramm, die Sendezeiten dieser Sendungen und die Reaktionen der Programmverantwortlichen auf den Quotendruck. Die Arbeit analysiert, wie der ökonomische Druck den kulturellen Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender beeinflusst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kultur im Fernsehen, Kulturmagazine, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Quotendruck, kultureller Programmauftrag, Kulturbegriff, Massenmedien, Medienlandschaft, Programmgestaltung, Alltagskultur, Hochkultur, Analyse, Programmschemata.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich mit dem Thema Kultur im Fernsehen, dem Einfluss von Quotendruck auf die Programmgestaltung und dem kulturellen Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks befassen.
- Citar trabajo
- Kristina Kaiser (Autor), 2010, Kultur als TV-Programmkategorie – Über den Stellenwert von Kultur im deutschen Fernsehen am Beispiel von Kulturmagazinen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155235