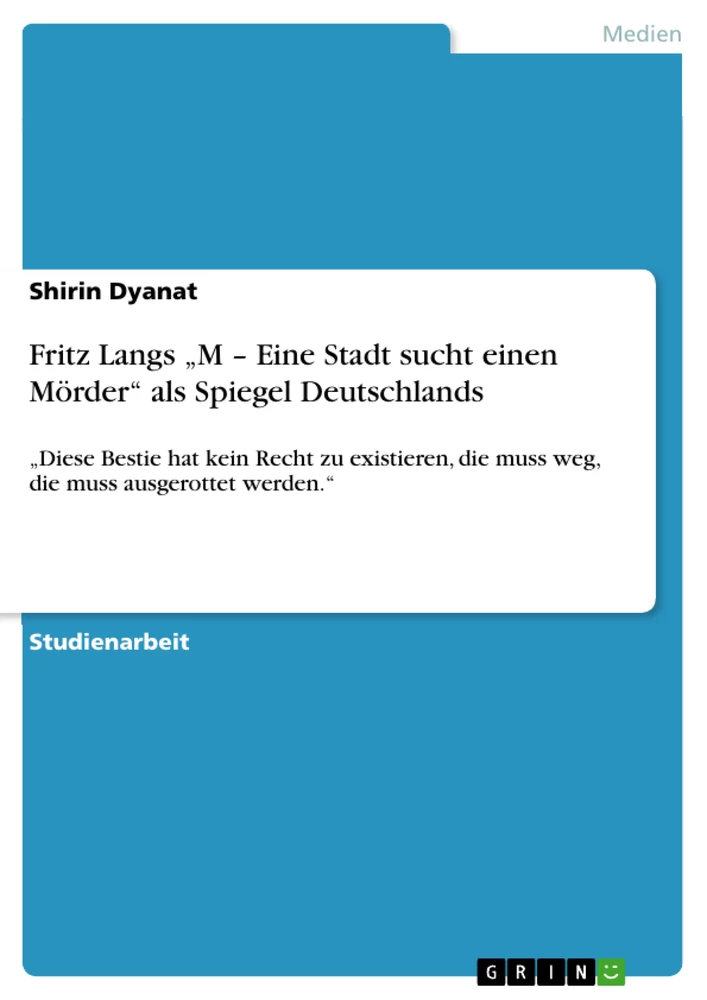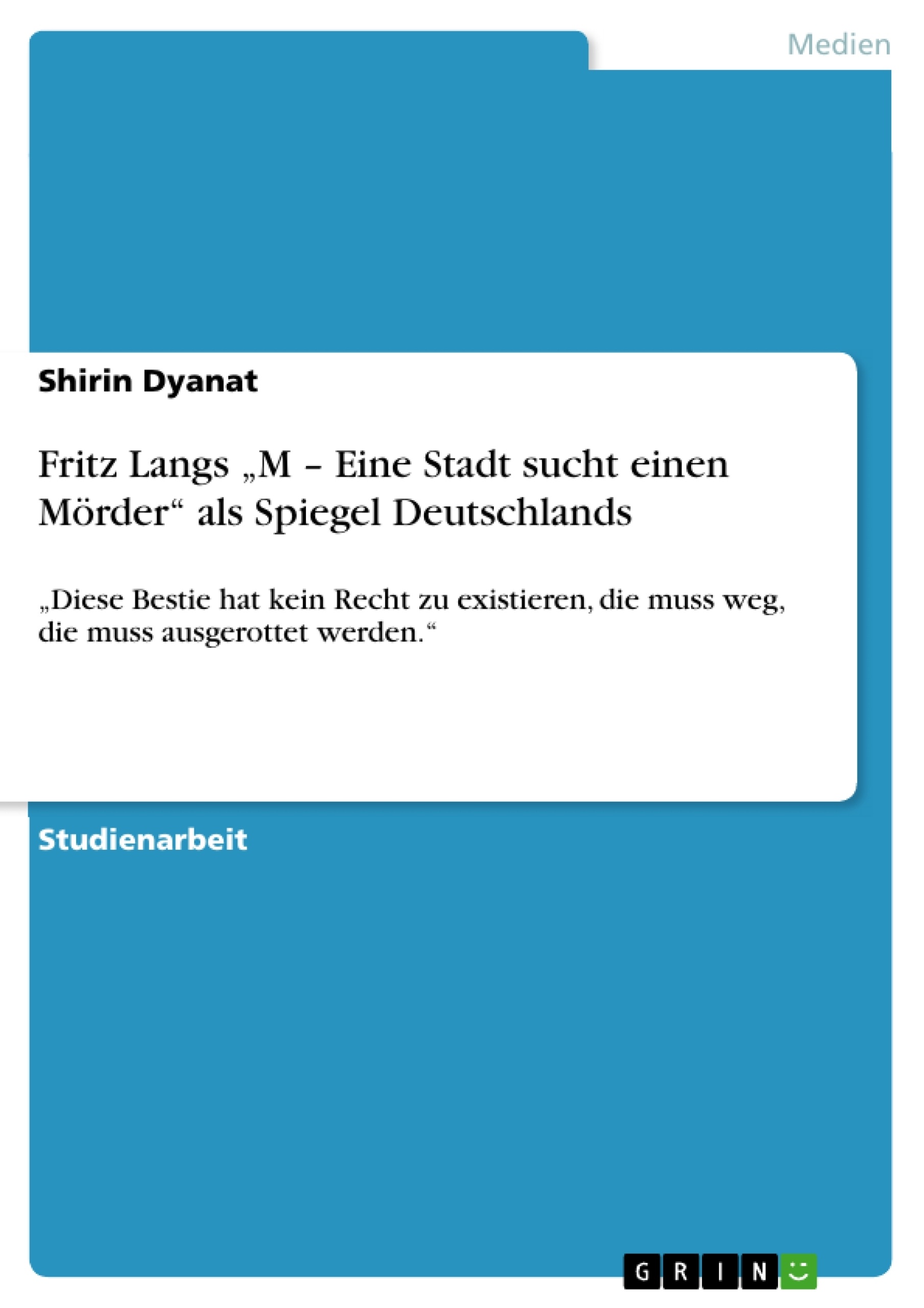Jedes Kunstwerk ist von dem Geist seiner Zeit beeinflusst. Fritz Langs ersten Tonfilm aus dem Jahr
1931 betrifft dies in besonders hohem Maße. In M – Eine Stadt sucht einen Mörder versetzt ein
Kindermörder eine Großstadt in Angst und Schrecken, was in den Jahren vor dem Filmdreh in zwei
deutschen Städten grausame Realität gewesen war.
Der Film ist voll von Bildern, die am Vorabend des Nationalsozialismus als Allegorie für die Krise
der Weimarer Republik, die schwache Demokratie und die Nationalsozialisten gedeutet werden
können. So wird Lang in der Forschung für seinen dokumentarischen und psychologisch
analysierenden Blick, hinsichtlich der ihn umgebenden Situation, als einer der bedeutendsten
Regisseure angesehen.
In der folgenden Seminararbeit soll geklärt werden, inwieweit der Zeitgeist Individuen formen kann
und wie gesellschaftlichen Gruppierungen mit ihrem jeweiligen Selbstverständnis auf
Krisensituationen reagieren. Wichtige Forschungsbeiträge dazu, auf die in dieser Arbeit auch
eingegangen wird, leisteten Joseph Chang, Siegfried Kracauer und Horst Lange.
Im Folgenden werden zuerst die historischen Hintergründe des Films erläutert, die Geschehnisse,
die auf Lang und seine Zeitgenossen einwirkten. Darauf aufbauend soll bewiesen werden, dass die
Figuren und Gruppen in M – Eine Stadt sucht einen Mörder ihre Zeit widerspiegeln.
Speziell wird hierbei auf den Mörder, die Polizei, die Ringvereine und deren symbolische
Bedeutung eingegangen.
Dabei werden filmische Mittel untersucht, die zur Verdeutlichung der inhaltlichen Aussagen dienen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Hintergründe des Films
- 2.1 Hinführung
- 2.2 Nachkriegszeit, Weltwirtschaftskrise – am Vorabend des Nationalsozialismus
- 2.3 Einfluss der Großstadt auf das Individuum
- 2.4 Historische Vorbilder Hans Beckerts
- 3. Der Mörder
- 3.1 Hans Berckert als Täter/ Opfer
- 3.2 Hans Beckert als Symbol für die gesellschaftliche Krise
- 4. Polizei/Ringvereine
- 4.1 Die Polizei als Symbol für die kränkelnde Weimarer Republik
- 4.2 Die Ringvereine als Symbol für den Nationalsozialismus
- 4.3 Parallelen beider Organisationen
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Fritz Langs Film "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" (1931) als Spiegel der krisenhaften Zeit der Weimarer Republik. Die Arbeit analysiert, inwieweit der Zeitgeist Individuen prägte und wie gesellschaftliche Gruppen auf die Krisensituation reagierten. Dabei werden die symbolische Bedeutung verschiedener Figuren und Gruppen im Film beleuchtet.
- Der Einfluss des Zeitgeists auf Individuen
- Die Weimarer Republik als kränkelnde Demokratie
- Der Aufstieg des Nationalsozialismus
- Die symbolische Darstellung gesellschaftlicher Krisen im Film
- Die Rolle der Medien und Massenhysterie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss des Zeitgeists auf die Gestaltung von Individuen und dem Umgang gesellschaftlicher Gruppen mit Krisensituationen im Kontext von Fritz Langs Film "M" dar. Sie benennt wichtige Forschungsbeiträge von Chang, Kracauer und Lange, auf die sich die Arbeit stützt und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Historische Hintergründe des Films: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext der Entstehung des Films, einschließlich der Herausforderungen bei der Produktion aufgrund der aufkommenden nationalsozialistischen Ideologie. Es beschreibt die sozio-politische Situation Deutschlands in der Zeit der Weimarer Republik, geprägt von der Nachkriegszeit, Weltwirtschaftskrise und dem Erstarken nationalsozialistischer Kräfte. Der Abschnitt verdeutlicht die atmosphärische Dichte der Zeit, die von sozialer Unsicherheit, Not und Angst geprägt war, und deren Einfluss auf die Entstehung des Films. Die Arbeit hebt die Bedeutung der wachsenden Unterstützung der NSDAP und die Folgen der Weltwirtschaftskrise für die Stimmung und die politische Instabilität hervor.
Schlüsselwörter
Fritz Lang, M – Eine Stadt sucht einen Mörder, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Weltwirtschaftskrise, Massenhysterie, Kindermörder, Symbolismus, Filmsprache, Zeitgeist, Gesellschaftliche Krise.
Häufig gestellte Fragen zu "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert Fritz Langs Film "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" (1931) als Spiegel der krisenhaften Weimarer Republik. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung des Einflusses des Zeitgeists auf Individuen und das Reaktionsverhalten gesellschaftlicher Gruppen auf die damalige Krisensituation.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Themen, darunter der Einfluss des Zeitgeists auf Individuen, die Weimarer Republik als kränkelnde Demokratie, der Aufstieg des Nationalsozialismus, die symbolische Darstellung gesellschaftlicher Krisen im Film und die Rolle der Medien und Massenhysterie. Die symbolische Bedeutung verschiedener Figuren und Gruppen im Film wird beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Historische Hintergründe) beleuchtet den historischen Kontext des Films, einschließlich der sozio-politischen Situation der Weimarer Republik. Kapitel 3 (Der Mörder) analysiert die Figur Hans Beckert als Täter und Opfer sowie als Symbol für die gesellschaftliche Krise. Kapitel 4 (Polizei/Ringvereine) untersucht die Polizei und die Ringvereine als Symbole für die kränkelnde Republik und den aufkommenden Nationalsozialismus. Kapitel 5 (Zusammenfassung) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie der Zeitgeist die Gestaltung von Individuen und den Umgang gesellschaftlicher Gruppen mit Krisensituationen im Kontext von Fritz Langs Film "M" prägte.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Fritz Lang, M – Eine Stadt sucht einen Mörder, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Weltwirtschaftskrise, Massenhysterie, Kindermörder, Symbolismus, Filmsprache, Zeitgeist, Gesellschaftliche Krise.
Auf welche Quellen stützt sich die Arbeit?
Die Arbeit stützt sich auf die Forschungsbeiträge von Chang, Kracauer und Lange (genaue Quellenangaben fehlen im vorliegenden Auszug).
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Der methodische Ansatz ist eine Film- und Gesellschaftsanalyse, die den Film "M" als Spiegel der Zeit interpretiert und symbolische Bedeutungen verschiedener Figuren und Gruppen untersucht.
Für wen ist diese Seminararbeit gedacht?
Diese Seminararbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, welches sich für Filmgeschichte, die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus interessiert. Der Fokus liegt auf der Analyse gesellschaftlicher und politischer Themen im Kontext des Films.
- Quote paper
- Shirin Dyanat (Author), 2010, Fritz Langs „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ als Spiegel Deutschlands, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155266