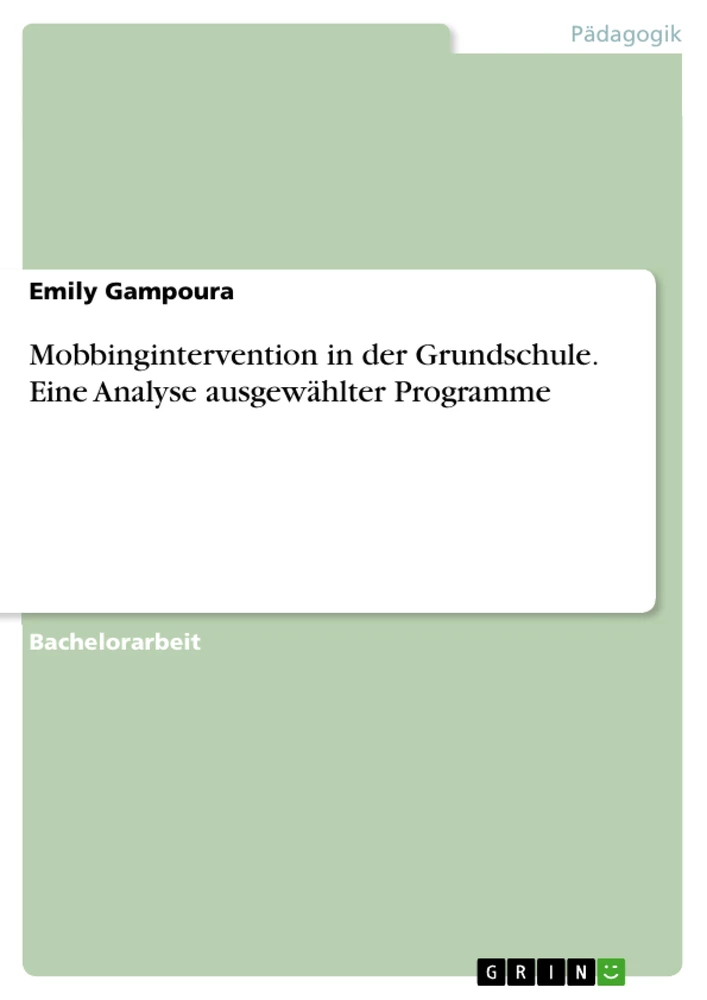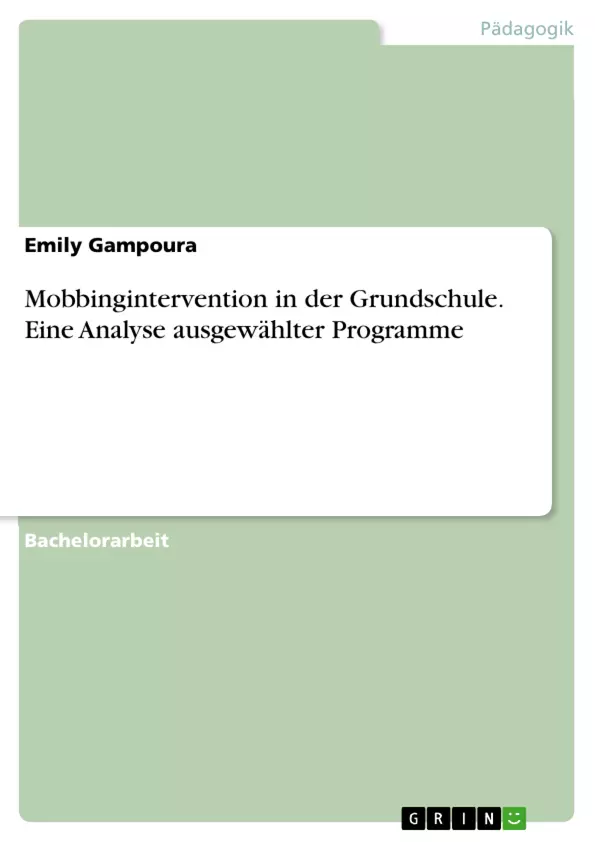Das Interesse dieser Arbeit zeigt sich darin, dass Lehrerinnen und Lehrer dem Phänomen Mobbing oft ratlos gegenüberstehen. Angehenden und bereits tätigen Lehrkräften fehlt deshalb oftmals das nötige Repertoire an Handlungsmöglichkeiten und sogar die Kenntnis über die Charakteristika von Mobbing. Als Folge dessen werden Situationen oft falsch eingeschätzt und Maßnahmen zur Prävention und Intervention zu spät wirksam gemacht. Die Arbeit verfolgt daher das Ziel, ein Grundwissen über das Phänomen Mobbing zu schaffen. Ferner wird aus dem breiten Gefüge der Interventionsprogramme der No Blame Approach in seiner praktischen Anwendbarkeit näher analysiert, um sich der Frage zu stellen, ob sich das Programm für den Einsatz zur Bewältigung der Mobbingfälle in der Primarstufe eignet und auf welche Chancen und Grenzen bei der Programmdurchführung gestoßen werden könnte.
Im Sinne eine Handlungsanleitung teilt sich die Arbeit in zwei Teile auf: Zunächst erfolgt eine theoretische Einführung durch die terminologische Abgrenzung des Mobbings zum klassischen Konflikt und zur Gewalt. Vor diesem Hintergrund soll die Berücksichtigung der Kernmerkmale wie auch die Betrachtung unterschiedlicher Erscheinungsformen und Rollenverteilung im Mobbingprozess eine grundlegende Charakterisierung des Phänomens ermöglichen. Daran anschließend werden die Entstehung und Folgen von Mobbing im Kontext risikoerhöhender Faktoren visiert, um die Relevanz der Prävention und Intervention im darauffolgenden Teil zu unterstreichen. Auf dem Wissen der vorangegangenen Kapitel aufbauend, wird schließlich der No Blame Approach im Speziellen vorgestellt und anschließend kritisch analysiert, um Möglichkeiten seiner Implementierung an Grundschulen zu untersuchen. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung ab, die alle wichtigen vorangegangenen Erkenntnisse zusammenfasst und einen Ausblick für künftige Mobbingprävention und -intervention mittels ausgewählter Programme wie auch Impulse für weitere Forschungsfragen gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mobbing als eine besondere Form von Gewalt
- Definitorische Annäherung an das Phänomen Mobbing
- Kernmerkmale des Schülermobbings
- Charakteristika des Mobbingprozesses
- Hintergründe und Folgen von Mobbing
- Prävention und Intervention bei Mobbing
- Schulische Interventionsprogramme am Beispiel des No Blame Approach
- Steckbrief
- Voraussetzungen und Hinweise für die erfolgreiche Anwendung
- Die drei Schritte des No Blame Approach
- Kritische Betrachtung des No Blame Approach in Hinblick auf den Einsatz im Primarbereich
- Chancen des Programms
- Grenzen des Programms
- Exkurs: Arbeit auf individueller Ebene am Beispiel der ABC-Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis des Phänomens Mobbing in der Grundschule zu vermitteln und die Anwendbarkeit des No Blame Approach als Interventionsmethode zu evaluieren. Die Arbeit analysiert bestehende Programme zur Mobbingintervention und untersucht deren Eignung für den Primarbereich.
- Definition und Abgrenzung von Mobbing von anderen Gewaltformen
- Charakteristika des Mobbingprozesses, einschließlich Rollenverteilung und Erscheinungsformen
- Hintergründe, Phasen und Folgen von Mobbing für Betroffene, Täter und das Klassenklima
- Präventive und intervenierende Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen
- Analyse des No Blame Approach hinsichtlich seiner Chancen und Grenzen im Primarbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Mobbing ein, verdeutlicht dessen Brisanz anhand von aktuellen Beispielen und Statistiken und begründet die Relevanz der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Sie unterstreicht die Notwendigkeit effektiver Präventions- und Interventionsmaßnahmen und die Lücke an evaluierten Programmen. Die Motivation der Arbeit liegt in der Ratlosigkeit von Lehrkräften im Umgang mit Mobbing und dem Mangel an adäquater Ausbildung in diesem Bereich. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, der die theoretische Fundierung mit der praktischen Analyse des No Blame Approach verbindet.
Mobbing als eine besondere Form von Gewalt: Dieses Kapitel definiert Mobbing, grenzt es von anderen Gewaltformen ab und beleuchtet seine Kernmerkmale. Es beschreibt den Mobbingprozess, die Rollen der Beteiligten (Opfer, Täter, Zuschauer) und verschiedene Erscheinungsformen, einschließlich Cybermobbing. Der Fokus liegt auf einem grundlegenden Verständnis des Phänomens als Voraussetzung für effektive Intervention.
Hintergründe und Folgen von Mobbing: Dieses Kapitel erörtert die Ursachen und Folgen von Mobbing. Es beschreibt die Phasen des Mobbingprozesses, die Auswirkungen auf Betroffene, Täter und das Klassenklima. Die detaillierte Analyse der Folgen unterstreicht die Notwendigkeit von frühzeitiger Intervention und Prävention, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Prävention und Intervention bei Mobbing: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen präventiven und intervenierenden Maßnahmen auf Schulebene, Klassenebene und individueller Ebene. Es klärt die Terminologie und differenziert zwischen verschiedenen Interventionsansätzen. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende detaillierte Analyse des No Blame Approach.
Schulische Interventionsprogramme am Beispiel des No Blame Approach: Dieses Kapitel präsentiert den No Blame Approach als ein spezifisches Interventionsprogramm. Es beschreibt die Hintergründe, Prinzipien und die Durchführung des Programms in drei Schritten (Screening, Gespräche mit Betroffenen und Unterstützungsgruppe, Nachgespräche und Nachsorge). Der Fokus liegt auf dem Verständnis des Programms als Grundlage für die anschließende kritische Bewertung.
Kritische Betrachtung des No Blame Approach in Hinblick auf den Einsatz im Primarbereich: Dieses Kapitel analysiert kritisch den No Blame Approach hinsichtlich seiner Anwendbarkeit in der Grundschule. Es beleuchtet sowohl die Chancen als auch die Grenzen des Programms, berücksichtigt organisatorische Herausforderungen und die Frage der Nachhaltigkeit. Ein Exkurs zur ABC-Methode bietet einen Vergleich und erweitert den Blick auf individuelle Interventionsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Mobbing, Schülermobbing, Gewaltprävention, Intervention, No Blame Approach, ABC-Methode, Grundschule, Primarbereich, Cybermobbing, Opfer, Täter, Klassenklima, Präventionsprogramme.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit über Mobbing?
Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis des Phänomens Mobbing in der Grundschule zu vermitteln und die Anwendbarkeit des No Blame Approach als Interventionsmethode zu evaluieren.
Was sind die Themenschwerpunkte dieser Arbeit?
Die Themenschwerpunkte sind: Definition und Abgrenzung von Mobbing von anderen Gewaltformen; Charakteristika des Mobbingprozesses, einschließlich Rollenverteilung und Erscheinungsformen; Hintergründe, Phasen und Folgen von Mobbing für Betroffene, Täter und das Klassenklima; Präventive und intervenierende Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen; Analyse des No Blame Approach hinsichtlich seiner Chancen und Grenzen im Primarbereich.
Was wird in der Einleitung der Arbeit behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema Mobbing ein, verdeutlicht dessen Brisanz anhand von aktuellen Beispielen und Statistiken und begründet die Relevanz der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Sie unterstreicht die Notwendigkeit effektiver Präventions- und Interventionsmaßnahmen und die Lücke an evaluierten Programmen.
Was wird im Kapitel "Mobbing als eine besondere Form von Gewalt" behandelt?
Dieses Kapitel definiert Mobbing, grenzt es von anderen Gewaltformen ab und beleuchtet seine Kernmerkmale. Es beschreibt den Mobbingprozess, die Rollen der Beteiligten (Opfer, Täter, Zuschauer) und verschiedene Erscheinungsformen, einschließlich Cybermobbing.
Welche Aspekte werden im Kapitel "Hintergründe und Folgen von Mobbing" untersucht?
Dieses Kapitel erörtert die Ursachen und Folgen von Mobbing. Es beschreibt die Phasen des Mobbingprozesses, die Auswirkungen auf Betroffene, Täter und das Klassenklima.
Womit befasst sich das Kapitel "Prävention und Intervention bei Mobbing"?
Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen präventiven und intervenierenden Maßnahmen auf Schulebene, Klassenebene und individueller Ebene. Es klärt die Terminologie und differenziert zwischen verschiedenen Interventionsansätzen.
Was wird im Kapitel "Schulische Interventionsprogramme am Beispiel des No Blame Approach" vorgestellt?
Dieses Kapitel präsentiert den No Blame Approach als ein spezifisches Interventionsprogramm. Es beschreibt die Hintergründe, Prinzipien und die Durchführung des Programms in drei Schritten (Screening, Gespräche mit Betroffenen und Unterstützungsgruppe, Nachgespräche und Nachsorge).
Was wird im Kapitel "Kritische Betrachtung des No Blame Approach in Hinblick auf den Einsatz im Primarbereich" analysiert?
Dieses Kapitel analysiert kritisch den No Blame Approach hinsichtlich seiner Anwendbarkeit in der Grundschule. Es beleuchtet sowohl die Chancen als auch die Grenzen des Programms, berücksichtigt organisatorische Herausforderungen und die Frage der Nachhaltigkeit. Ein Exkurs zur ABC-Methode bietet einen Vergleich und erweitert den Blick auf individuelle Interventionsmöglichkeiten.
Welche Schlüsselwörter sind mit dieser Arbeit verbunden?
Die Schlüsselwörter sind: Mobbing, Schülermobbing, Gewaltprävention, Intervention, No Blame Approach, ABC-Methode, Grundschule, Primarbereich, Cybermobbing, Opfer, Täter, Klassenklima, Präventionsprogramme.
- Citar trabajo
- Emily Gampoura (Autor), 2023, Mobbingintervention in der Grundschule. Eine Analyse ausgewählter Programme, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1552993